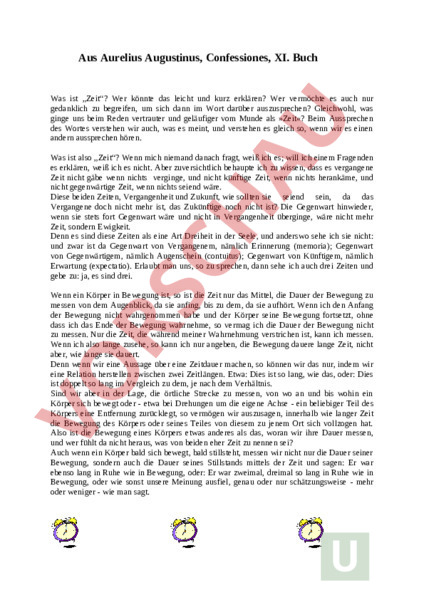Arbeitsblatt: Zeit
Material-Details
Philosophische Aspekte
Diverses / Fächerübergreifend
Anderes Thema
12. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
194341
522
1
15.04.2020
Autor/in
Dagi (Spitzname)
Land: Österreich
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Aus Aurelius Augustinus, Confessiones, XI. Buch Was ist „Zeit? Wer könnte das leicht und kurz erklären? Wer vermöchte es auch nur gedanklich zu begreifen, um sich dann im Wort darüber auszusprechen? Gleichwohl, was ginge uns beim Reden vertrauter und geläufiger vom Munde als »Zeit«? Beim Aussprechen des Wortes verstehen wir auch, was es meint, und verstehen es gleich so, wenn wir es einen andern aussprechen hören. Was ist also „Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich einem Fragenden es erklären, weiß ich es nicht. Aber zuversichtlich behaupte ich zu wissen, dass es vergangene Zeit nicht gäbe wenn nichts verginge, und nicht künftige Zeit, wenn nichts herankäme, und nicht gegenwärtige Zeit, wenn nichts seiend wäre. Diese beiden Zeiten, Vergangenheit und Zukunft, wie sollten sie seiend sein, da das Vergangene doch nicht mehr ist, das Zukünftige noch nicht ist? Die Gegenwart hinwieder, wenn sie stets fort Gegenwart wäre und nicht in Vergangenheit überginge, wäre nicht mehr Zeit, sondern Ewigkeit. Denn es sind diese Zeiten als eine Art Dreiheit in der Seele, und anderswo sehe ich sie nicht: und zwar ist da Gegenwart von Vergangenem, nämlich Erinnerung (memoria); Gegenwart von Gegenwärtigem, nämlich Augenschein (contuitus); Gegenwart von Künftigem, nämlich Erwartung (expectatio). Erlaubt man uns, so zu sprechen, dann sehe ich auch drei Zeiten und gebe zu: ja, es sind drei. Wenn ein Körper in Bewegung ist, so ist die Zeit nur das Mittel, die Dauer der Bewegung zu messen von dem Augenblick, da sie anfing, bis zu dem, da sie aufhört. Wenn ich den Anfang der Bewegung nicht wahrgenommen habe und der Körper seine Bewegung fortsetzt, ohne dass ich das Ende der Bewegung wahrnehme, so vermag ich die Dauer der Bewegung nicht zu messen. Nur die Zeit, die während meiner Wahrnehmung verstrichen ist, kann ich messen. Wenn ich also lange zusehe, so kann ich nur angeben, die Bewegung dauere lange Zeit, nicht aber, wie lange sie dauert. Denn wenn wir eine Aussage über eine Zeitdauer machen, so können wir das nur, indem wir eine Relation herstellen zwischen zwei Zeitlängen. Etwa: Dies ist so lang, wie das, oder: Dies ist doppelt so lang im Vergleich zu dem, je nach dem Verhältnis. Sind wir aber in der Lage, die örtliche Strecke zu messen, von wo an und bis wohin ein Körper sich bewegt oder etwa bei Drehungen um die eigene Achse ein beliebiger Teil des Körpers eine Entfernung zurücklegt, so vermögen wir auszusagen, innerhalb wie langer Zeit die Bewegung des Körpers oder seines Teiles von diesem zu jenem Ort sich vollzogen hat. Also ist die Bewegung eines Körpers etwas anderes als das, woran wir ihre Dauer messen, und wer fühlt da nicht heraus, was von beiden eher Zeit zu nennen sei? Auch wenn ein Körper bald sich bewegt, bald stillsteht, messen wir nicht nur die Dauer seiner Bewegung, sondern auch die Dauer seines Stillstands mittels der Zeit und sagen: Er war ebenso lang in Ruhe wie in Bewegung, oder: Er war zweimal, dreimal so lang in Ruhe wie in Bewegung, oder wie sonst unsere Meinung ausfiel, genau oder nur schätzungsweise mehr oder weniger wie man sagt. Denke dir: eine körperliche Stimme hebt an zu ertönen und tönt und tönt, und mit einemmal hört sie auf, und nun ist es still, und die Stimme ist vergangen, und es „ist keine Stimme mehr. Sie war künftig, bevor sie ertönte, und man konnte sie gar nicht messen, weil sie noch nicht „war, jetzt kann man sie nicht messen, weil sie nicht mehr „ist. Also nur während sie erklang, konnte man sie messen, denn da „war, was gemessen werden konnte. Aber auch da stand sie nicht unbewegt; sie ging und verging. Konnte sie gerade deshalb gemessen werden? Denn nur während sie vorüberging, dehnte sie sich zu einer gewissen Dauer aus, so dass sie eben hieran zu messen war, da ja Gegenwart als solche keine Ausdehnung hat. War diese Stimme während ihrer Dauer meßbar, so stelle dir nun weiter vor, eine zweite Stimme habe zu erklingen begonnen und klinge noch ohne Unterbrechung fort. Messen wir sie doch, solange sie erklingt, denn wird sie aufgehört haben zu erklingen, wird sie bereits vergangen sein, und es wird nichts mehr da sein, was sich messen ließe. Messen wir sie genau und sagen dann, wie lang sie ist! Aber noch erklingt sie ja, und gemessen werden kann sie nur von dem Zeitpunkt an, da sie anhebt, bis zu dem, da sie aufhört. Denn was Zeitspanne ist, messen wir von einem Anfang bis zu einem Ende. Deshalb kann man eine Stimme, die noch nicht zu Ende gekommen ist, nicht messen, so dass man sagen könnte, wie lang oder kurz sie dauere, noch lässt sich sagen, sie ist gleich lang mit einer andern, sie ist im Verhältnis zu einer andern das Einfache, das Doppelte oder sonst dergleichen. Wenn die Stimme aber aufgehört hat zu erklingen, „ist sie nicht mehr. Wie soll man sie da noch messen können? Und gleichwohl messen wir die Zeiten und messen doch die Zeiten nicht, die noch nicht „sind, auch nicht solche, die nicht mehr „sind, nicht solche, die sich über keine Dauer erstrecken, noch solche, die keine Grenzen haben. Weder künftige Zeiten, also messen wir noch vergangene noch gegenwärtige noch solche, die vorüberziehen – und dennoch messen wir die Zeiten . Was also ist es, was ich da messe? Wo ist die kurze Silbe, mit der ich messen will? Wo ist die lange, die ich messen will? Beide sind verklungen, verflogen, vorbei, sie „sind nicht mehr. Und ich, ja, ich messe und sage mit allem Verlass auf einen geübten Sinn, soweit da Verlass ist, die kurze Silbe sei das Einfache, die lange das Doppelte, nämlich der Zeitdauer nach; und ich vermag das nur, weil sie vorbei und beendigt sind. Daraus folgt: Nicht die gehörten Silben selbst, die nicht mehr „sind, messe ich, ich messe etwas in meinem Gedächtnis, was dort als Eindruck haftet. In dir, mein Geist, messe ich die Zeiten. Nein, lärme nicht dagegen an! Es ist so; lärme mir nicht dagegen mit dem Schwall deiner sinnlichen Eindrücke! In dir, sage ich, messe ich die Zeiten. Der Eindruck, der von den Erscheinungen bei ihrem Vorüberziehen in dir erzeugt wird und dir zurückbleibt, wenn die Erscheinungen vorüber sind, der ist es, den ich messe als etwas Gegenwärtiges, nicht das, was da den Eindruck erzeugend, vorüberging; nur ihn, den Eindruck, messe ich, wenn ich Zeiten messe. Also sind entweder die Eindrücke Zeiten oder ich messe die Zeiten überhaupt nicht.