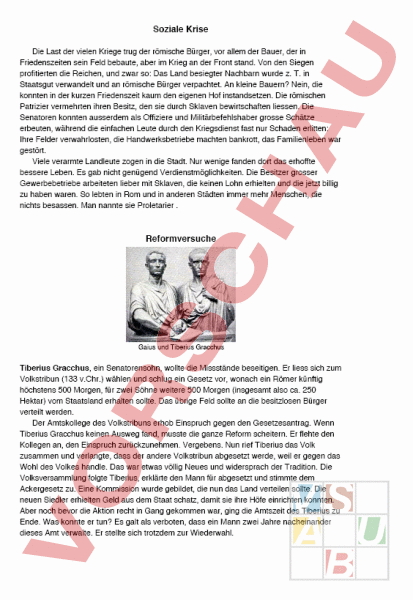Arbeitsblatt: Rom_Staendekampf.pdf
Material-Details
Illustrierter Text über die sozialen Spannungen und Bürgerkriege Im Vorfeld des Kaisertums
Darstellung speziell zur Anwendung der 5-Gang-Lesetechnik
Geschichte
Altertum
klassenübergreifend
4 Seiten
Statistik
20883
881
10
07.06.2008
Autor/in
Don (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Soziale Krise Die Last der vielen Kriege trug der römische Bürger, vor allem der Bauer, der in Friedenszeiten sein Feld bebaute, aber im Krieg an der Front stand. Von den Siegen profitierten die Reichen, und zwar so: Das Land besiegter Nachbarn wurde z. T. in Staatsgut verwandelt und an römische Bürger verpachtet. An kleine Bauern? Nein, die konnten in der kurzen Friedenszeit kaum den eigenen Hof instandsetzen. Die römischen Patrizier vermehrten ihren Besitz, den sie durch Sklaven bewirtschaften liessen. Die Senatoren konnten ausserdem als Offiziere und Militärbefehlshaber grosse Schätze erbeuten, während die einfachen Leute durch den Kriegsdienst fast nur Schaden erlitten: Ihre Felder verwahrlosten, die Handwerksbetriebe machten bankrott, das Familienleben war gestört. Viele verarmte Landleute zogen in die Stadt. Nur wenige fanden dort das erhoffte bessere Leben. Es gab nicht genügend Verdienstmöglichkeiten. Die Besitzer grosser Gewerbebetriebe arbeiteten lieber mit Sklaven, die keinen Lohn erhielten und die jetzt billig zu haben waren. So lebten in Rom und in anderen Städten immer mehr Menschen, die nichts besassen. Man nannte sie Proletarier Reformversuche Gaius und Tiberius Gracchus Tiberius Gracchus, ein Senatorensohn, wollte die Missstände beseitigen. Er liess sich zum Volkstribun (133 v.Chr.) wählen und schlug ein Gesetz vor, wonach ein Römer künftig höchstens 500 Morgen, für zwei Söhne weitere 500 Morgen (insgesamt also ca. 250 Hektar) vom Staatsland erhalten sollte. Das übrige Feld sollte an die besitzlosen Bürger verteilt werden. Der Amtskollege des Volkstribuns erhob Einspruch gegen den Gesetzesantrag. Wenn Tiberius Gracchus keinen Ausweg fand, musste die ganze Reform scheitern. Er flehte den Kollegen an, den Einspruch zurückzunehmen. Vergebens. Nun rief Tiberius das Volk zusammen und verlangte, dass der andere Volkstribun abgesetzt werde, weil er gegen das Wohl des Volkes handle. Das war etwas völlig Neues und widersprach der Tradition. Die Volksversammlung folgte Tiberius, erklärte den Mann für abgesetzt und stimmte dem Ackergesetz zu. Eine Kommission wurde gebildet, die nun das Land verteilen sollte. Die neuen Siedler erhielten Geld aus dem Staat schatz, damit sie ihre Höfe einrichten konnten. Aber noch bevor die Aktion recht in Gang gekommen war, ging die Amtszeit des Tiberius zu Ende. Was konnte er tun? Es galt als verboten, dass ein Mann zwei Jahre nacheinander dieses Amt verwalte. Er stellte sich trotzdem zur Wiederwahl. Im Senat herrschte grosse Empörung. Viele Senatoren stemmten sich gegen die ganze Reform. Die meisten wollten am Alten festhalten und sahen durch die Neuerungen des Volkstribuns die Ordnung des Staates gefährdet. Manche sagten, dieser Gracchus strebe nach der Alleinherrschaft. Als die Volksversammlung ohne Waffen, wie es die Vorschrift verlangte, zur Wahl der Tribunen zusammenkam, erschienen plötzlich die Senatoren. Was dann geschah, berichtet ein Schriftsteller aus dem Altertum folgendermassen: ,,Die Senatoren drängten fort, was ihnen in den Weg kam. Die Begleiter der Senatoren hatten schon Keulen und Stöcke mitgebracht, sie selbst aber ergriffen Bretter und Stuhlbeine der vom fliehenden Volk zerbrochenen Bänke und gingen geradewegs auf Tiberius los, indem sie auf die Leute, die vor ihm standen, wie wild dreinschlugen. So wurde die ganze Versammlung zum Fliehen gebracht und viele wurden getötet. Tiberius selbst ergriff die Flucht, strauchelte und wurde erschlagen. Von den andern wurden mehr als dreihundert mit Stöcken und Steinen totgeschlagen, keiner aber mit richtigen Waffen. Dies war nun, wie zuverlässig versichert wird, der erste Aufstand in Rom seit Bestehen der Republik, der durch Mord und Bürgerblut entschieden wurde. Alle anderen Konflikte hatte man immer durch gegenseitiges Nachgeben beizulegen gewusst.\ Parteien und ihre Führer Tiberius Gracchus und auch sein jüngerer Bruder Gaius, der 10 Jahre nach ihm eine ähnliche Politik versuchte, scheiterten. Die Ungerechtigkeiten blieben bestehen und damit auch die Gegensätze. Von jetzt an gab es zwei Auffassungen darüber, was für den Staat gut und notwendig sei. Die eine wurde von der Senatspartei vertreten und lautete: Wir müssen am Altbewährten festhalten; die Macht bleibt am besten in den Händen der Oberschicht, denn sie allein kann die Aufgaben meistern, sie hat Erfahrung und Überblick; das Volk braucht eine starke Führung. Die Anhänger der Gegenpartei nannten sich Popularen (von populus das Volk). Sie vertraten die Interessen des Volkes und waren für Reformen, für eine schrittweise Änderung der Verfassung. Die beiden Gruppen bildeten keine Parteien im modernen Sinn, sie dienten jedoch ehrgeizigen Männern dazu, eine breite Anhängerschaft zu gewinnen. Der politische Aufstieg eines Mannes hing jetzt, seit Rom eine Grossmacht geworden war, weniger von seinen Leistungen zuhause ab, z.B. in der Verwaltung und im politischen Alltag, sondern mehr vom Erfolg als Feldherr im Krieg. So erreichte z.B. Gaius Marius (156-86 v.Chr.), ein Mann einfacher Herkunft, der sich als Offizier emporgedient und seine Soldaten wiederholt zum Sieg geführt hatte, die Gunst der ärmeren Wähler und wurde siebenmal Konsul, was gemäss Verfassung eigentlich nicht erlaubt war. Als gelernter Soldat hatte er erkannt, dass sich das römische Heer nicht mehr allein aus wehrpflichtigen Bauern ergänzen konnte, zumal die Zahl freier Bauern schrumpfte. Er stellte auch Freiwillige ein: Proletarier aus den Armenvierteln der Stadt. Sie wurden Berufssoldaten, der Staat zahlte ihnen Sold und musste auch für ihre Ausrüstung aufkommen. So war aus dem Bürgerheer eine Berufsarmee geworden, die freilich noch immer aus römischen Bürgern in Uniform Gaius Marius bestand. Allerdings galt die Treue dieser Soldaten mehr ihren Feldherrn als der Republik. Die Feldherrn sahen in ihren Soldaten Klienten, für die sie sorgten und die ihnen zur politischen Macht verhalfen. In einem Bürgerkrieg gegen Lucius Cornelius Sulla (* um 135 v.Chr.; † 78 v.Chr.) einen Feldherrn aus den Reihen der Patrizier eroberten beide wiederholt die Stadt Rom, erannnten sich abwechselnd zu Diktatoren (Alleinherrschern mit fast uneingeschränkter Macht). Dieses Amt wäre eigentlich nur vorgesehen gewesen, wenn Rom von fremden Mächten angegriffen wurde. Dies kümmerte aber weder Marius noch Sulla. So setzten beide jeweils Gestze ein, die ihren Wählern nützten, nach dem Machtwechsel jeweils aber sofort wieder für ungültig erklärt wurden. Schliesslich gewann Sulla und sorgte dafür, dass die Kluft zwischen Plebejern und Patriziern sich vergrösserte. Lucius Cornelius Sulla Von Pompeius zu Caesar Ein besonders erfolgreicher Feldherr war Gnaeus Pompeius. Als er im Jahre 61 v. Chr. nach einem langjährigen Krieg aus Asien heimkehrte, bereitete ihm die Hauptstadt einen Triumphzug, wie ihn die Welt bis dahin nicht gesehen hatte. Auf grossen Schildern standen die Gebiete, in denen Pompeius seine Siege errungen hatte. Es waren 15, darunter Armenien, Syrien, Palästina, Arabien und Pontus am Schwarzen Meer. Die römische Macht reichte jetzt bis zum Kaukasus. Ausserdem hatte Pompeius das ganze Mittelmeergebiet von der Seeräuberplage befreit, an allen Küsten die Raubnester und Schlupfwinkel der Piraten zerstört und ihre Schiffe versenkt oder erbeutet. Die Goldschätze, die Pompeius mitbrachte und der römischen Staatskasse ablieferte, waren allein schon 20000 Talente (über 1 Milliarde SFr. [Stand 2000] wert. Er selbst besass riesige Landgüter, zahlreiche Villen mit prachtvollen Kunstschätzen, die er aus Griechenland mitgeschleppt hatte, eine unermessliche Zahl von Sklaven und dazu die Treue seiner Soldaten, die er zum Sieg geführt hatte. Die Gunst des Volkes, das ihn bewunderte, war ihm gewiss. Ein anderer, der junge Gaius Julius Caesar, machte sich beim Volk beliebt, indem er grossartige Spiele finanzierte. Er erwarb mit Hilfe von Bestechungen hohe Ämter und liess sich im Jahr 59 v. Chr. zum Konsul wählen. Zuvor schloss er mit Pompeius und einem Dritten, dem schwerreichen Crassus, ein Bündnis, das Triumvirat (Drei-Männer-Herrschaft) genannt wurde. Zu dritt beherrschten sie den Staat und liessen dem Senat kaum noch Einfluss. Während Caesar Gallien, das heutige Frankreich, für das Römische Reich eroberte, starb Crassus auf einem Feldzug, und Pompeius trennte Marcus Licinius Crassus sich von Caesar, um sich der Senatspartei anzuschliessen. Die Parteigegensätze spitzten sich zu. Caesars Alleinherrschaft Caesar entschloss sich, den Kampf um die Macht im Staat mit seinen Truppen zu entscheiden. Er marschierte mit einer Legion Soldaten gegen die Hauptstadt. Die meisten Senatoren flüchteten Hals über Kopf aus der Stadt, nicht einmal die Staatskasse nahmen sie mit. Caesar verfolgte sie, aber sie entkamen nach Griechenland. Dort gelang es dem Pompeius, ein neues starkes Heer aufzustellen. Im Jahre 48 v. Chr. kam es zur Entscheidungsschlacht. Caesar siegte über das Senatsheer. Pompeius floh nach Ägypten, wurde dort aber heimtückisch ermordet. Caesar überraschte die geschlagenen Gegner durch seine Milde. Er nahm keine Rache, er strafte nicht, sondern bot allen, die sich mit der neuen Lage abfinden wollten, die Versöhnung an. Nun liess sich Caesar von Senat und Volk zum Konsul für viele Jahre und zum Diktator auf Lebenszeit ernennen. Zugleich durfte er sich Imperator nennen, Gaius Iulius Caesar 100 v. Chr. – 44 v. Chr. womit ausgedrückt war, dass ihm der Oberbefehl über sämtliche Truppen zustand. Um sicher zu gehen, erwarb er das Recht auf Unverletzlichkeit seiner Person wie ein Volkstribun. Sein Geburtstag wurde als römischer Staatsfeiertag begangen, und von manchen empfing Caesar geradezu göttliche Ehren. Die Republik blieb nur noch dem Schein nach erhalten. In Wirklichkeit regierte Caesar wie ein König, nur dass ihm der Titel fehlte. Als Alleinherrscher (Monarch) beseitigte Caesar in kurzer Zeit viele Missstände durch Reformen. Doch viele Senatoren wollten nicht hinnehmen, dass er alle Entscheidungen allein mit seinen persönlichen Ratgebern traf und den Senat und damit die reichen Patrizier nur noch um die nachträgliche Zustimmung bat, damit der Schein gewahrt werde. Mehr als 24 von ihnen erdolchten den Diktator in einer Senatssitzung am 15. März 44 v. Chr. (Iden des März), darunter auch ein von ihm sehr geförderter Marcus Iunius Brutus. Unmittelbar nach dem Mord gewährte der Senat den Mördern Caesars Amnestie. Doch als Marcus Antonius, der Führer der caesarianischen Partei, in seiner Grabrede das Testament des Diktators bekannt gab, nach dem jeder Einwohner Roms eine beträchtliche Geldsumme erhielt, wandte sich die öffentliche Meinung in Rom gegen die Verschwörer. Um einer Anklage zu entgehen, flüchtete Brutus nach Athen. Dort widmete er sich einerseits dem Studium der Philosophie, andererseits aber rüstete er sich für den bevorstehenden Kampf gegen Caesars politische Erben Antonius und Octavian. Die Entscheidung fiel 42 v. Chr. in zwei Schlachten bei Philippi. In der ersten konnte Brutus zwar Marcus Iunius Brutus Octavian schlagen, doch Cassius unterlag Antonius und beging Selbstmord. In der zweiten Schlacht wurde auch Brutus Armee entscheidend geschlagen. Brutus konnte zunächst entkommen, liess sich jedoch kurz darauf töten. Octavian liess Brutus Kopf später vor der Statue seines Grossonkels Caesar in Rom niederlegen.