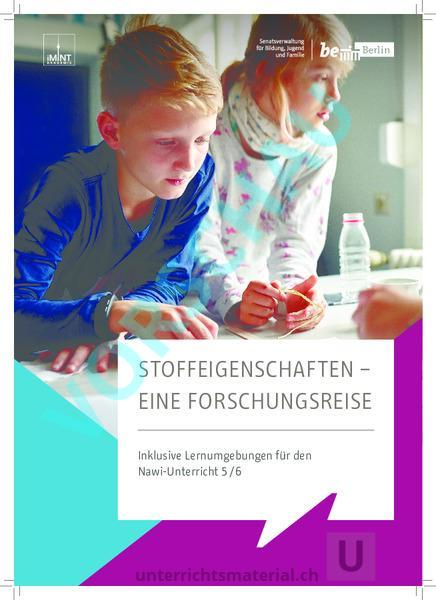Arbeitsblatt: Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise
Material-Details
STOFFEIGENSCHAFTEN –
EINE FORSCHUNGSREIS
Rumantsch
Reals - Biologia
5. Schuljahr
164 Seiten
Statistik
211956
237
4
17.02.2025
Autor/in
Idris Benselmane
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
STOFFEIGENSCHAFTEN – EINE FORSCHUNGSREISE Inklusive Lernumgebungen für den Nawi-Unterricht 5 6 Allgemeine didaktische Hinweise Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise Ein Unterrichtsmodul der iMINT-Akademie Entwickelt von Isabelle Düring, Susann Sava, Beate Kießling, Nikolai Philipp, Claudia Tessmer, Anke Travers und Jan Kube Bild: „Beagle Bild: „Professorin Bild: „Weltkarte Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 1 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise 1 2 3 4 5 6 Dokumente 3 Allgemeine Vorbemerkung zur Unterrichtsreihe „Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise 3 2.1 Fachbezogene Kompetenzen . 3 2.2 Fachübergreifende Kompetenzen, Bezug zum Basiscurriculum Sprachbildung 5 2.3 Fachübergreifende Kompetenzen, Bezug zum Basiscurriculum Medienbildung 6 2.4 Wertebildung im MINT-Unterricht 6 2.4.1 Wertebildung in der Schule oder warum sind Werte wichtig? . 6 2.4.2 Umsetzung im vorliegenden Material . 7 Übersicht über die Einheit 8 Spezielle didaktische Hinweise 8 4.1 Material . 8 4.2 Inklusive Aspekte 11 4.2.1 Unterstützung bei Lese-Rechtschreib-Schwäche . 11 4.2.2 Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler . 12 4.3 Grundprinzipien der Sprachbildung . 12 4.3.1 Raster zur Konkretisierung sprachlicher Lernziele (T. Tajmel) . 14 4.4 Schwerpunkt des Kompetenzerwerbs . 17 4.5 Medieneinsatz. 17 4.5.1 Einsatz der Arbeitsbögen der interaktiven Medien . 17 4.5.1.1 Gestufte Hilfen 18 4.5.1.2 Stationenkarten 20 4.5.1.3 Steckbriefe 20 4.5.1.4 Bestimmungskarten 20 Bewertungsmöglichkeiten 20 5.1 Checkliste: Wie erstelle ich ein Plakat? . 21 Sicherheitshinweise . 22 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 2 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise 1 Dokumente Word-Dateien Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise – Didaktische Hinweise für die Lehrkraft Arbeitsblätter, Lehrerhandreichungen, Folien und Hilfen zu den Lernumgebungen 1 bis 3 Interaktive Lernmedien Lernumgebung 1 – Stoffe sortieren: Kennst du die Stoffe? (Zuordnungsaufgabe) Lernumgebung 2 – Stoffeigenschaften: Wie kann man Trinkwasser gewinnen? (Quiz) Lernumgebung 2 – Stoffeigenschaften: Wie erstelle ich ein Protokoll? (Zuordnungsaufgabe) Lernumgebung 3 – Stoffe untersuchen: Stoffeigenschaften (Zuordnungsaufgabe) Lernumgebung 3 – Stoffe untersuchen: Wo kommen die Stoffe in größeren Mengen vor? (Zuordnungsaufgabe) Lernumgebung 3 – Stoffe untersuchen: Ordne die Stoffe der richtigen Stoffklasse zu! (Zuordnungsaufgabe) Ton-Datei Stoffeigenschaften – Nebelhorn und Meeresrauschen (Hörbeispiel) 2 Allgemeine Vorbemerkung zur Unterrichtsreihe „Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise 2.1 Fachbezogene Kompetenzen Das Material, das Hinweise, Experimentieranleitungen und Methodenwerkzeuge enthält, wurde entsprechend den inklusiven Standards der iMINT-Akademie entworfen und ermöglicht die Bearbeitung bezüglich unterschiedlicher Lernausgangslagen. Das Thema „Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise der Klassenstufe 5 und 6 wird in diesem Projekt durch drei relativ eigenständige Lernumgebungen bearbeitet. Lernumgebungen laden Schülerinnen und Schüler zu einem selbsttätigen Lernprozess in enger Kooperation miteinander ein. Dabei werden offene Aufgabenstellungen vor dem Hintergrund vorbereiteter Lernmaterialien und Medien bearbeitet. Die Rolle der Lehrkraft verändert sich. Sie agiert als Organisator, Begleiter und Berater. Die Lernenden werden während des Lernprozesses zu individuellen, kreativen, und vor allem zu selbstständig gewählten Lösungsansätzen ermutigt. Alle Schülerinnen und Schüler bearbeiten dieselbe Aufgabenstellung. Diese berücksichtigt die Heterogenität der Lernenden und bietet nach einer niedrigen Eingangsschwelle vertiefende Teilaufgaben auf unterschiedlichem Verständnis- und Abstraktionsniveau. Das individuelle Arbeits- und Lerntempo wird respektiert. Der individuelle Lösungsweg der Schülerinnen und Schüler steht im Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden selbst über den Einsatz von Arbeitsmitteln und die Art der Dokumentation. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 3 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise Der gemeinsame Austausch über die unterschiedlichen Bearbeitungswege einer Aufgabe ist unumgänglich, damit die Lernenden ihre unterschiedlichen Lösungsstrategien reflektieren können. In der Reflexion vertieft sich das Verständnis. Die Unterrichtseinheit „Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise besteht aus drei Lernumgebungen, die einer Rahmenhandlung folgen, in der die Ozeanologin Prof. Cousteau mit ihrem Forschungsschiff „Beagle auf Weltreise geht. Jede Lernumgebung beginnt mit einer E-Mail der Professorin. In der E-Mail fordert die Ozeanologin die Schüler und Schülerinnen auf, sie bei der Sortierung von Materialien (Lernumgebung 1), der Untersuchung von Stoffen (Lernumgebung 2) und bei der Bestimmung von Eigenschaften von Stoffen (Lernumgebung 3) zu unterstützen. Der niederschwellige Einstieg in die Lernumgebung 1 ermöglicht es allen Schülerinnen und Schülern, in die Thematik „Eigenschaften von Stoffen einzusteigen. Kooperierende Sozialformen in allen drei Lernumgebungen und differenzierende Aufgabenstellungen gewährleisten, dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Leistungsniveaus gemeinsam an der Bewältigung der Aufgaben beteiligt sind. Die erste und zweite Lernumgebung sind so offen gestaltet, dass die Lernenden eigene Lösungswege finden. In der Auseinandersetzung mit Phänomenen aus Natur und Technik entwickeln die Schülerinnen und Schüler naturwissenschaftliche Fragestellungen und erwerben grundlegende naturwissenschaftliche Kompetenzen, die sich in die vier Kompetenzbereiche des naturwissenschaftlichen Unterrichts aufgliedern lassen: Die Lernumgebungen des Projektes „Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise sind so gestaltet, alle Kompetenzbereiche zu entwickeln, richten ihr vorrangiges Augenmerk jedoch auf den Prozess der Erkenntnisgewinnung. Der Umgang mit dem Fachwissen, das Kommunizieren und die Bewertung sind aus keiner Lernumgebung wegzudenken. Der Rahmenlehrplan Berlin/Brandenburg weist zu den oben genannten Kompetenzbereichen definierte Standards aus. Diese beschreiben auf unterschiedlichen Niveaustufen, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schulzeit im Fachunterricht erwerben, je nachdem, über welche Lernvoraussetzungen sie verfügen und welchen Abschluss bzw. Übergang sie zu welchem Zeitpunkt anstreben. In jeder Lernumgebung des Projekts sind die angestrebten Kompetenzen und die zugeschriebenen Standards dem didaktischen Teil des Materials zu entnehmen. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 4 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise 2.2 Fachübergreifende Kompetenzen, Bezug zum Basiscurriculum Sprachbildung Die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler in den Klassenzimmern nimmt in Bezug auf deren Fähigkeiten und Fertigkeiten immer mehr zu. Mit der Entwicklung einer inklusiven Lernumgebung wird diese Diversität berücksichtigt und durch Binnendifferenzierung ein individueller Lernfortschritt ermöglicht. Die Heterogenität trifft auch auf die sprachlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu. Diese müssen im Verlauf ihrer Schullaufbahn von der Alltagssprache zur bildungssprachlichen Handlungskompetenz geführt werden, um Bildungsetappen erfolgreich zu meistern und abzuschließen. Bildungssprache betrifft allerdings nicht nur die jeweiligen Fachwörter, sondern auch das Erlernen bildungssprachlicher Satzstrukturen und Textmuster, z. B. für eine Präsentation, ein Referat oder ein Protokoll. Sprache ist in jedem Fachunterricht Lerninhalt und Medium der Fachinhalte zugleich. In den entwickelten Materialien zur Förderung der bildungssprachlichen Handlungskompetenz wurde der Schwerpunkt auf den Lerninhalt Sprache gelegt. Sowohl der Fachwortschatz als auch fachspezifische Satz- und Textmuster werden mit Methoden, die der Fremdsprachendidaktik entlehnt sind, eingeführt, geübt und gefestigt. Auch im neuen Rahmenlehrplan Berlin/Brandenburg ist die Sprachbildung im Teil (Fachübergreifende Kompetenzentwicklung) wiederzufinden. Die bildungssprachliche Handlungskompetenz (Basiscurriculum Sprachbildung) entwickelt sich in allen Fächern in vier Kompetenzbereichen: durch eine aktive Teilnahme an Diskussionen Interaktion durch das Erschließen von mündlichen und schriftlichen Texten Rezeption durch das Sprechen und Schreiben von zusammenhängenden und in sich schlüssigen Texten Produktion durch die Wahrnehmung unterschiedlicher sprachlicher Phänomene und Register Sprachbewusstheit Die bildungssprachliche Handlungskompetenz wächst fächerübergreifend in allen vier Bereichen mit dem Aufbau eines differenzierten und reichhaltigen Wortschatzes, mit dem Verfügen über vielfältige Satzmuster sowie mit einer breiten Kenntnis von Text- und Gesprächssorten. Die jeweiligen Standards des Basiscurriculums werden in den zwei Niveaustufen (ca. Ende der Klasse 6) und (ca. Ende der Klasse 10) formuliert. Exemplarisch wird an verschiedenen Beispielen innerhalb der Unterrichtseinheit „Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise aufgezeigt, wie Fachinhalte mit Sprachbildungsprozessen verknüpft werden können. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 5 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise 2.3 Fachübergreifende Kompetenzen, Bezug zum Basiscurriculum Medienbildung Medien dienen der Verbreitung von Informationen, Inhalten und Botschaften durch Sprache, Text, Töne, Bilder und Bewegtbilder. Der in den Materialien verwendete Medienbegriff schließt alle Medienarten von analog (z. B. Arbeitsblatt, Buch, Zeitung, Radio, Film) bis digital (z. B. Internet, Smartphones, Tablets und Computerspiele) ausdrücklich ein. Kinder und Jugendliche leben in einer durch Medien geprägten Welt. Da der Einfluss von Medien in allen Lebensbereichen weiter zunehmen wird, ergeben sich auch für die Gestaltung des Unterrichts neue Chancen und Herausforderungen, wobei die Sinnhaftigkeit des Einsatzes ständig neu zu bewerten ist. Schülerinnen und Schüler nutzen Medien bei der selbstständigen Beschaffung und dem Austausch von Informationen sowie der Aneignung von Wissen. Die verwendeten Medien unterstützen Kommunikations- und Verständigungsprozesse, erweitern die individuellen Ausdrucksmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler und vermitteln diesen Werte und Orientierungen. Sie werden befähigt, Informationen und deren Quellen kritisch zu bewerten. So schult der bewusste Umgang mit der Medienvielfalt auch die Formung des Welt- und Selbstverständnisses. Der Einsatz von Medien erleichtert die Umsetzung des inklusiven Lernens, da vielfältige und differenzierte Angebote und Zugänge möglich sind. Zudem können digitale Medien zur Diagnose von Lernständen herangezogen werden. Das Kompetenzmodell verdeutlicht, dass Medienbildung ausdrücklich mehr beinhaltet als die Entwicklung von Methodenkompetenz. Das Lernen mit und über Medien ist eine gemeinsame und bedeutsame Anforderung von Schule und Unterricht in der Mediengesellschaft. 2.4 Wertebildung im MINT-Unterricht 2.4.1 Wertebildung in der Schule oder warum sind Werte wichtig? Jedes Miteinander, jedes Zusammenleben in der Gesellschaft, in der Familie und auch in der Schule beruht auf Werten. Es gibt keinen einzigen Lebensbereich, in dem wir auf Werte verzichten Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 6 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise können. Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Urteilskraft, Toleranz und Teamfähigkeit sind notwendige Kompetenzen, die für eine erfolgreiche individuelle und berufliche Entwicklung grundlegend sind. Diese Werte zu haben heißt hauptsächlich, sie ernst zu nehmen, sie zu leben und für sie einzutreten. Die Unverzichtbarkeit und die große Bedeutung von Werten macht es notwendig, der Wertebildung in der Schule im Unterricht eine große Rolle zukommen zu lassen. 2.4.2 Umsetzung im vorliegenden Material Es gibt eine große Bandbreite von Werten, die für den naturwissenschaftlichen Unterricht geeignet erscheinen. In dieser Unterrichtseinheit stehen folgende Werte besonders im Vordergrund: Verantwortungsübernahme, Teamorientierung, Toleranz und Zuverlässigkeit. Im vorliegenden Material sind diese Werte auf den Lernprozess bezogen. Lernprozessbezogene Werte spielen sowohl im Umgang miteinander als auch beim selbsttätigen Handeln eine grundlegende Rolle. In allen drei Lernumgebungen stehen diese Werte im Fokus und sollen so eine Wertebildung anregen. Der Wert und seine Bedeutung Umsetzung im vorliegenden Material Verantwortung . bedeutet, Konsequenzen für eigene Entscheidungen und eigenes Handeln zu übernehmen. Teamorientierung . bedeutet, erfolgreich und effektiv zusammenzuarbeiten. Toleranz . bedeutet, unterschiedliche Meinungen anzuerkennen. Zuverlässigkeit . bedeutet, verbindliche Vereinbarung einzuhalten. verantwortungsvolle Durchführung der Experimente verantwortungsvoller Umgang mit den zur Verfügung gestellten Materialien für die Vorbereitung und die Durchführung der Versuche Verantwortung übernehmen seinen bestmöglichen Beitrag zur Lösung der Aufgabenstellung leisten gegenseitige Unterstützung bei der Durchführung der Experimente anderen Hilfe anbieten und auf sie zugehen anderen zuhören und sie ausreden lassen unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten und Lernniveaus akzeptieren Lösungswege konstruktiv diskutieren sich aufeinander verlassen können Vorgaben aus Anleitungen genau befolgen und Aufgaben pünktlich erledigen aufgestellte Regeln und Vereinbarungen einhalten Materialien wegräumen und Arbeitsplatz aufräumen Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 7 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise 3 Übersicht über die Einheit Lernumgebung Ungefährer Zeitbedarf in Stunden Thema und Lerninhalt Sortieren von Stoffen 1 2 Kennenlernen der Sortierungsmöglichkeit nach „Stoff, „Eigenschaft und „Funktionen Schülerinnen und SchülerAktivität/Sozialform Gruppenarbeit: Entwicklung eigener, begründeter Kriterien zur Sortierung Museumsrundgang, Auswertung der Sortierung im Plenum Arbeitsteilige Gruppenarbeit, Schülerinnen und Schüler entwickeln selbstständig Experimente zur Untersuchung verschiedener Stoffeigenschaften, Unterstützung durch gestufte Hilfen, Wortlisten 3 Für verschiedene Probleme werden Stoffe mit spezifischen Eigenschaften gesucht 1 Präsentation der Experimente und Ergebnisse, Übung der Verwendung der Fachsprache Schülerinnen und Schüler Für jeweils einen Stoff werden alle bisher untersuchten Eigenschaften und Zusatzinformationen zusammengestellt Arbeitsteilige Gruppenarbeit, experimentelle Stationenarbeit, erstellen von Stoffsteckbriefen auch mit Informationsmaterial Rallye zur Auswertung der Steckbriefe 2 2 3 1 4 Spezielle didaktische Hinweise 4.1 Material Es werden Stoffproben möglichst verschiedener Stoffe in verschiedener Form für die Sortierung (Lernumgebung 1) und die Experimente (Lernumgebung 2 und 3) benötigt. Je umfangreicher das Angebot ist, desto mehr müssen die Schülerinnen und Schüler in der Lernumgebung 1 überlegen und diskutieren, nach welchen Kriterien sie die Materialien ordnen. Ähnlich farbige Stoffe, bis auf die Kunststoffsorten, wären wünschenswert, um z. B. ein Sortieren nach Farben zu unterstützen. Auch Bindfäden aus verschiedenen Materialien (Sortierung nach der Funktion: Zusammenbinden) wären gut. Zur besseren Zuordnung der Kunststoffe seitens der Schülerinnen und Schüler bietet es sich an, unterschiedlich farbige Kunststoffe zu wählen. Die drei verschiedenen Kunststoffe sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Dichte und einfachen Verfügbarkeit gewählt worden. Die Dichte von PP (Polypropylen) liegt ungefähr bei 0,9 g/cm, damit schwimmt es im Wasser. PET (Polyethylenterephthalat) hat eine Dichte von 1,38 g/cm und sinkt im Wasser. Bei einer Dichte von 1,05 g/cm sinkt PS (Polystyrol) in Süßwasser und schwimmt in Salzwasser (entscheidend beim Problem „Unterwassersonden in Lernumgebung 2). Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 8 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise Für die Lehrkräfte, die im Besitz eines „Experimento 8-Kastens der Siemens Stiftung sind, informieren die kursiv geschriebenen Angaben in Klammern, wo sich das jeweilige Material in dem „Experimento 8-Kasten befindet. Es werden für die Lernumgebung 1 und 2 folgende Stoffe empfohlen: Stoff Aluminium Baumwolle Eisen Flachs Glas Holz Keramik Kork Kupfer Leder Polyethylenterephthalat (PET) Polypropylen (PP) Polystyrol (PS) Wolle Produkte Kerzenhülle, Alufolie (lose im Kasten) Bindfaden, T-Shirt (Box Nr. 10) Büroklammer (magnetisch)(Box Nr. 14), Nagel Geschenkband, Bindfaden Murmeln, kleine Dekosteine, Objektträger Spatel, Essstäbchen Tassen, Teller Untersetzer, Flaschen (lose in dem Kasten) Draht (orange-rot) (Box Nr. 10) Lederrest Viele Einwegflaschen Recyclingcode 1 Einige Platzdeckchen, Schnüre, Verpackungen, z. B. Joghurtbecher, Wurst- und Käse-Umverpackungen Recyclingcode 5 CD-Hüllen, einige Kaffeebecher, einige Teller, Verpackungen, z. B. Joghurtbecher Recyclingcode 6 als Faden Die Materialien können in Stücken von ca. 20 cm2 oder in der natürlichen Form (Büroklammer) an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden. Wir empfehlen die Bereitstellung aller Gegenstände in einer Tüte oder Kiste für jede Arbeitsgruppe. Die Arbeitsblätter für die Schülerinnen und Schüler enthalten eine Wörterliste, in der die Materialien fotografiert und benannt wurden. Die Fotos sollten für die aktuellen Proben angepasst werden. Die Experimentiermaterialien werden für die Lernumgebung 2 für alle Gruppen zugänglich im Raum aufgebaut. Da die Gruppen ihre Experimente selber entwickeln, werden die Materialien nicht nach Experimenten geordnet. Es bietet sich an, noch nicht bekannte Materialien mit Namenskärtchen zu versehen. Die Stoffe für die Experimente entnehmen die Gruppen größtenteils aus den Stoffkisten der Lernumgebung 1. Bei dem Wärmeleitfähigkeit-Experiment der Gruppen „Hitze ist es entscheidend, dass die Stoff-Proben eine möglichst einheitliche Größe besitzen, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Beim Härte-Test der Gruppe „Hai müssen die StoffProben ein Kratzen mit dem Lineal bzw. Eisennagel ermöglichen. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 9 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise In der Lernumgebung 3 werden die Experimentiermaterialien entsprechend der Experimentieranleitungen zur Verfügung gestellt. Gruppe „Bojen/Elektrische Leitfähigkeit drei Kabel (2 blaue, 1 rotes) mit zwei Krokodilklemmen (Box Nr. 8) Glühlampe/Fassung (Box Nr. 15) Flachbatterie Petrischale Gruppe „Rettungsboot/Magnetismus ein starker Magnet Becherglas Gruppe „Unterwassersonden/Verhalten im Wasser (Dichte) ein Plastikbecher/Becherglas (Plastikbecher: lose im Kasten) ein Spatel ein Glasstab/ein Löffel eine Pinzette ein großes Becherglas 500 Kochsalz Gruppe „Hitze/Wärmeleitfähigkeit ein Thermometer Stoppuhr Wasserkocher breites Becherglas Papierhandtücher Butter ein stumpfes Messer mind. 12 cm lange, mind. 0,5 cm breite, nicht runde Stücke Hartplastik (z. B. Löffel, breiter Kabelbinder aus Nylon), Stoff, Holz, Eisen, Kupfer, Aluminium (z. B. Rand des Teelichts „abwickeln), wenn möglich Glas (Objektträger o. Ä.), Keramik (z. B. Magnesiarinne, größere Bruchstücke) Gruppe „Hai/Härte ein großer Eisennagel ein Lineal Material zum Testen ähnlich wie bei der Gruppe „Hitze, muss nur nicht ganz so lang sein (kratzen ermöglichen) Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 10 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise Gruppe „Koch/Verhalten im Wasser (Löslichkeit) und Stofftrennverfahren „Filtrieren und Eindampfen 5 Kochsalz geschroteter Pfeffer/Pfefferkörner Butter ein Glasstab/ein Löffel ein Trichter (Box Nr. 2) Filterpapier ein Teelicht (Box Nr. 3) ein Metall-Teelöffel (Box Nr. 14) evtl. ein Erlenmeyerkolben Streichhölzer Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler „Trinkwasser große Glasschüssel kleine Glasschüssel Haushaltsfolie Tischlampe als Wärmequelle Glasmurmel Salz 4.2 Inklusive Aspekte In allen Lernumgebungen ist die grundlegende Sozialform die Gruppenarbeit, die die Kooperation der Schülerinnen und Schüler sowie die gemeinsame Bewältigung der Aufgabenstellungen gewährleistet. Der niederschwellige Einstieg in Lernumgebung 1 macht in der ersten Aufgabe jedes Gruppenmitglied zum Experten, da alle gemeinsam eine Sortierung für die Materialien finden, die beim anschließenden Museumsrundgang in neu gebildeten Gruppen präsentiert werden. Die Offenheit der Aufgabenstellung ohne vorgegebene Struktur ermöglicht es jeder Schülerin und jedem Schüler, an der Bewältigung dieser Aufgabe teilzuhaben. Der direkte Umgang mit den Materialien birgt für alle Lernenden einen hohen Aufforderungscharakter. In Lernumgebung 2 werden leistungshomogenen Gruppen Aufgabenstellungen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades zugeordnet. Somit sind alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Möglichkeiten an den Lösungen der vielen Probleme von Prof. Cousteau beteiligt, da eine Gruppe gar nicht alle Probleme lösen könnte. In Lernumgebung 3 stellen dagegen leistungsheterogene Gruppen sicher, dass sich die Schülerinnen und Schüler bei den komplexen Aufgaben gegenseitig unterstützen. Die Präsentationen in Lernumgebung 2 und 3 können von allen Schülerinnen und Schüler selbstständig vorbereitet werden, da Worthilfen und Skizzen zur Verfügung gestellt werden. 4.2.1 Unterstützung bei Lese-Rechtschreib-Schwäche Symbole für die zu untersuchenden Stoffeigenschaften ziehen sich durch die gesamte Einheit und ermöglichen auch leseschwachen Schülerinnen und Schülern das Erkennen und Wiedererkennen der Themen. In der Lernumgebung 3 können bestimmte Eigenschaften eines Stoffes experimentell untersucht werden, andere müssen aus Bestimmungskarten in Text- und Tabellenform herausgelesen wer Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 11 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise den. Die Bestimmungskarten sind so vorbereitet, dass es jeweils zwei Niveaustufen für die Tabellenform und zwei Niveaustufen für die Textform gibt. Die Begriffe in der Wörterliste (Lernumgebung 1) sind in Silbenstruktur zweifarbig formatiert, sodass leseschwachen Schülerinnen und Schülern das Lesen erleichtert wird. Es ist sehr sinnvoll, diese Seiten farbig auszudrucken. Sollte dies nicht möglich sein, kann man für einen SchwarzWeiß-Druck die Silbenstruktur durch fett/dünn ersetzen. Zur Erleichterung des Lesens wurde durchgehend die Schriftgröße 14 gewählt. 4.2.2 Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler Während der Erarbeitung der Lernumgebungen werden die Schülerinnen und Schüler „Fragen an die Welt aufwerfen. Diese sollten gesammelt werden und sichtbar im Unterrichtsraum verbleiben. Sie bieten sich als Zusatzrecherchen für Schülerinnen und Schüler, die schnell zu Lernergebnissen kommen, an. Mögliche Themen könnten sein: die Persönlichkeit Jaques Cousteau die historische Reise der Beagle verschiedene Quallenarten der Salzgehalt der Meere die Entstehung/Produktion von Kork, Bast etc. Die Präsentation der Ergebnisse kann z. B. in Plakatform im Rahmen des Museumsrundgangs von Lernumgebung 3 erfolgen. 4.3 Grundprinzipien der Sprachbildung Durch den Einsatz des Konkretisierungsrasters von Tanja Tajmel (2017)1 werden die von den Schülerinnen und Schüler erwarteten bildungssprachlichen Strukturen, die mit der Vermittlung des jeweiligen Fachinhaltes einhergehen, sichtbar. Das wurde exemplarisch an zwei Beispielen durchgeführt: Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise; Lernumgebung 1: Schreiben der E-Mail an Frau Cousteau zur Begründung der Ordnung der Gegenstände und Stoffeigenschaften; Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise; Lernumgebung 2: Präsentation der aus Experimenten gewonnenen Erkenntnisse. Dieses Raster stellt eine geeignete und in der Praxis erprobte Planungsgrundlage zur Erarbeitung von sprachsensiblen Materialien dar, die alle Schülerinnen und Schüler unterstützen, den sprachlichen Erwartungshorizont erfüllen zu können. Die in dem Zusatzmaterial umgesetzten drei Grundprinzipien, die an die Qualitätsmerkmale bildungssprachlichen Unterrichts (FÖRMIG 2012)2 angelehnt sind, überschneiden sich und bedingen sich gegenseitig. Dies entspricht einer ganzheitlichen sprachlichen Förderung, die die bildungssprachlichen Strukturen fest verankern lässt. 1 Konkretisierungsraster: FörMig-Material Band 9 Tanja Tajmel, Sara Hägi-Mead: Sprachbewusste Unterrichtsplanung. Prinzipien, Methoden und Beispiele für die Umsetzung. Waxmann-Verlag Münster. New Yorck 2017, S.80-82 2 Qualitätsmerkmale: FörMig-Material Band 3 Inci Dirim, Ingrig Gogolin u.a. (Hrsg.): Durchgängige Sprachbildung. Qualitätsmerkmale für den Unterricht. Waxmann-Verlag Münster 2011, S.8-10 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 12 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise 1. Einführung, Übung und Festigung des Fachwortschatzes Wortlisten mit einheitlicher Artikel- und Pluralkennzeichnung Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise; Lernumgebung 1: Memory und Zuordnungen Wortschatzübungen Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise; Lernumgebung 1: Memory und Zuordnungen 2. Handlungsorientierung durch Schaffung vielfältiger Sprech- und Schreibanlässe Veränderung der Darstellungsform Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise; Lernumgebung 3: Elfchen 3. Unterstützung durch sprachliche Gerüste (Scaffolding) strukturierte sprachliche Hilfen auf der Satzebene Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise; Lernumgebung 1: Satzbaukasten strukturierte sprachliche Hilfen auf der Textebene Protokollfächer für den Einsatz im Fach Naturwissenschaften Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise; Lernumgebung 2: Strukturierungs-Hilfe zur Präsentation Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 13 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise 4.3.1 Raster zur Konkretisierung sprachlicher Lernziele (T. Tajmel) Thema: Lernumgebung 1 – Stoffe sortieren Klasse 5/6 a) Ordnet die Stoffe in Gruppen. b) Gebt den Gruppen Namen und schreibt diese auf die Aufsteller. c) Schreibt Professorin Cousteau in einer E-Mail eure Ordnung der Stoffe auf und begründet diese. Operator/ Sprachhandlung begründen Ausformulierter Erwartungshorizont Aufgabenstellungen Mögliche Antworten: a) zum Befüllen; Metall; Kunststoff; zum Zusammenbinden; glatt; Naturstoff, weich b) Hallo Professorin Cousteau, wir haben die Tasse, die Flasche und den Joghurtbecher in eine Gruppe geordnet, weil sie alle befüllt werden können. Die Folie, den Löffel, die Büroklammer, den Nagel und die Kerzenhülle haben wir zusammengefasst, da sie alle aus Metall bestehen. Der Untersetzer und die CD-Hülle gehören zusammen, da sie beide aus Kunststoff bestehen. Den Bindfaden, die Wolle, den Draht und die Bastkordel haben wir zusammengelegt, da man Sachen damit zusammenbinden kann. Weil die Keramikfließe und die Glaskugel glatt sind, haben wir sie zusammengefasst. Den Holzspatel, haben wir zu dem Korkuntersetzer gelegt, da beide aus Naturstoffen bestehen. Die Stoffstücke gehören zu dem Lederstück, weil Stoff und Leder weich sind. Wir hoffen unsere Sortierung hilft dir weiter. Liebe Grüße Wortebene Verben: zusammenbinden, befüllen, befestigen, aufbewahren, polstern, anziehen, zusammenfassen Adjektive: weich, hart, glänzend, spiegelnd, matt, glatt, rau, rund, starr, elastisch Andere Wörter: zum, weil, da Substantivierungen: zum Zusammenbinden, zum Befüllen, Satz- und Textebene Sprachliche Mittel Substantive: das Metall, der Kunststoff, der Naturstoff Kausalsätze mit weil oder da: Wir haben zusammengefasst, weil haben wir zusammengelegt, da Weil haben wir Da , haben wir gehört zu ,weil haben wir zu gelegt, da Fazit Das Raster zur Konkretisierung sprachlicher Lernziele zeigt auf, dass bei diesen Arbeitsaufträgen neue Fachwörter (Kunststoff, Naturstoff, Metall) eingeführt werden müssen. Neben der Substantivierung von Verben müssen auch Kausalsätze gebildet werden. Damit diese sprachlichen Lernzie Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 14 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise le von allen Schülerinnen und Schülern erreicht werden, kann die Lehrkraft Übungen zur Substantivierung von Verben und zur Bildung von Kausalsätzen bereitstellen. Thema: Lernumgebung 2 – Stoffeigenschaften Klasse 5/6 Aufgabenstellungen Bewertet die Präsentationen eurer Mitschülerinnen und Mitschüler. Begründet eure Entscheidung. Ausformulierter Erwartungshorizont Operator/ Sprachhandlung bewerten, begründen Mögliche Antworten: Uns hat der Vortrag zur Wärmeleitfähigkeit (oder: zum Verhalten im Wasser, zur elektrischen Leitfähigkeit, zum Magnetismus, zur Härte, zur Löslichkeit im Wasser) am besten gefallen, da alle sechs Präsentationsteile gut ausgeführt wurden. Das Problem wurde genannt, die verwendeten Materialien und Geräte vollzählig aufgezählt, der Versuchsaufbau anhand der informativen Zeichnung mit Beschriftung erläutert, die Durchführung und Beobachtung vollständig beschrieben sowie am Ende eine nachvollziehbare Schlussfolgerung gezogen. Positiv hervorzuheben ist auch, dass alle Mitglieder der Gruppe frei gesprochen haben und gut auf Nachfragen antworten konnten. Wortebene Verben: bewerten, begründen, haben, werden, gefallen, ausführen, nennen, aufzählen, erläutern, beschreiben, ziehen, können, hervorheben, sprechen, antworten Adjektive: gut – besser – am besten, sechs, vollzählig, informativ, vollständig, nachvollziehbar, positiv, frei Andere Wörter: eurer, uns, da, alle, anhand, und, sowie, auch Satz- und Textebene Sprachliche Mittel Substantive: Wärmeleitfähigkeit, Verhalten, Wasser, Leitfähigkeit, Magnetismus, Härte, Löslichkeit, Problem, Materialien, Geräte, Versuchsaufbau, Zeichnung, Beschriftung, Durchführung, Beobachtung, Ende, Schlussfolgerung, Mitglieder, Gruppe, Fragen Präpositionalphrasen: zur Wärmeleitfähigkeit, zum Verhalten im Wasser (zu mit Dativ) Satzstrukturen: Uns hat der Vortrag (Inversion) hat gefallen (starkes Verb, Perfektbildung) ist auch, dass (dass leitet Nebensatz ein) In allen drei Lernumgebungen finden sich Beiträge der Sprachbildung zum Kompetenzerwerb wieder. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 15 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise Lernumgebung 1: Der niederschwellige Einstieg ermöglicht es allen Schülerinnen und Schülern sich sprachlich zu beteiligen, d. h. sie müssen diskutieren, nach welchen Kriterien sie ihre Sortierung vornehmen und welchen Oberbegriff sie hierfür verwenden. Anschließend verfassen sie ein Schreiben, in dem sie ihre Entscheidung durch nachvollziehbare Argumente stützen und sachlich belegen müssen. Mithilfe ihrer Aufzeichnungen können alle Schülerinnen und Schüler einen Kurzvortrag halten. Im Anschluss daran erwerben die Schülerinnen und Schüler Fachbegriffe bezüglich der Stoffe und können diese in eine Tabelle eintragen. Zur besseren Orientierung mit den vielen verschiedenen Stoffen in der Stoffkiste sowie der korrekten sprachlichen Benennungen finden die Schülerinnen und Schüler eine Wörterliste, die auf der einen Spalte das Bild der Stoffprobe zeigt und auf der anderen Spalte deren Benennung. Lernumgebung 2: In dieser Lernumgebung wird sprachlich, in Form einer niederschwelligen Herangehensweise, zunächst an die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler angeknüpft. Sowohl auf den Problemkarten als auch auf den Hilfekarten werden für das jeweilige Problem kleine Symbole verwendet. Somit ist es für jede Schülerin und jeden Schüler möglich, teilhaben zu können. Die Problemkarten regen die Schülerinnen und Schüler an, Informationen zu entnehmen und eine Fragestellung zu entwickeln, d. h. sie müssen zu einem Sachverhalt Stellung nehmen, Hypothesen formulieren und begründen. Die Schülerinnen und Schüler treten erneut in Interaktion und müssen sich sprachlich argumentativ auseinandersetzen. Ein Arbeitsblatt dient als unterstützende Hilfe für den Vortrag, indem die Schülerinnen und Schüler neben den bildhaften Elementen (hier speziell Symbole für die Eigenschaften der Stoffe) sprachliche Formulierungshilfen vorfinden, die es ihnen ermöglichen, fachlich, d. h. naturwissenschaftlich, vorzutragen und zu begründen. Lernumgebung 3: Auch diese Lernumgebung fordert die Schülerinnen und Schüler auf, in Interaktion zu treten. Während des Experimentierens werden die Schülerinnen und Schüler angehalten, sich Notizen zu machen, die sie für ihren anzufertigenden Steckbrief benötigen. In den neu zusammengesetzten Gruppen erklären Experten aus Lernumgebung 2 evtl. die Experimente der Stationenarbeit. Strukturierungsvorgaben für die Steckbriefe dienen der Entwicklung von Schreibstrategien und ermöglichen durch Textmuster die Erstellung des Steckbriefs. Bestimmungskarten, die auf verschiedenen Niveaustufen verfasst sind, ermöglichen es, dass jede Schülerin und jeder Schüler sprachlich beteiligt wird. Einerseits müssen Informationen aus Tabellen entnommen, andererseits für die höheren Niveaustufen Lesetechniken und -strategien der entsprechenden Leseabsicht angewendet werden. Zum Schluss werden die Schülerinnen und Schüler sprachbildend in Form des Erläuterns, Begründens und Beurteilens der Steckbriefplakate gefordert. Es wurden interaktive Lernmedien zu jeder der drei Lernumgebungen entwickelt. Sprachbildend wirken dabei besonders folgende interaktiven Lernmedien: Lernumgebung 1 – Stoffe sortieren: Kennst du die Stoffe? (Zuordnungsaufgabe) Lernumgebung 2 – Stoffeigenschaften: Wie erstelle ich ein Protokoll? (Zuordnungsaufgabe) Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 16 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise 4.4 Schwerpunkt des Kompetenzerwerbs Der Schwerpunkt der Unterrichtsreihe „Stoffeigenschaften – eine Forschungsreise liegt laut Rahmenlehrplan Berlin/Brandenburg auf der Erkenntnisgewinnung auf den Niveaustufen und D. Die Einheit bietet sich für die Klassenstufen 5 und 6 an. Folgende Kompetenzen der Erkenntnisgewinnung werden gefördert: 4.5 Beobachten, Vergleichen, Ordnen C: Beobachtungen beschreiben C/D: mit vorgegebenen Kriterien Sachverhalte/Objekte ordnen, vergleichen und beschreiben Naturwissenschaftliche Untersuchungen durchführen C: vorgegebene Experimente unter Anleitung durchführen D: Experimente zur Überprüfung von Hypothesen nach Vorgaben planen und durchführen C: Untersuchungsergebnisse beschreiben D: das Untersuchungsergebnis unter Rückbezug auf die Hypothese beschreiben Elemente der Mathematik anwenden D: Größen aus Quellenmaterial (z. B. Texte und Tabellen) entnehmen und mit Einheiten angeben Medieneinsatz Alle für die Arbeit im Plenum vorgesehenen visuellen Medien (Bild der Beagle, Bild der Professorin Cousteau, Bild der Weltkarte) können je nach Ausstattung per Smartboard, Beamer, Dokumentenkamera, Overhead-Projektor oder als Papierausdruck an einer Tafel dargeboten werden. Das auditive Medium (Nebelhorn und Meeresrauschen) kann per MP3-Datei oder auf CD abgespielt werden. (Quellen der Sounds: Ocean Cruise Liner Ship: 17.02.2016, 19:29 Stand: 30.09.2016 (TiredHippo, Lizenz: CC0), Original-Dateiname: 317386tiredhippoocean-cruise-liner-ship.mp3 oceanwaves-5.wav: Stand: 17.02.2016, 19:32 (Rmutt, Lizenz: CC BY-SA-NC 3.0), Original-Dateiname: 148283rmuttoceanwaves-5.wav) Die Weltkarten zeigen den Weg der Professorin auf den Weltmeeren und veranschaulichen die Orte, an denen die Probleme auftreten, die von den Schülerinnen und Schülern in Lernumgebung 2 gelöst werden müssen. 4.5.1 Einsatz der Arbeitsbögen der interaktiven Medien Lernumgebung 1: Der Einsatz der Arbeitsbögen richtet sich nach der Zielsetzung der Aktion. In Lernumgebung 1 wird der Laufzettel für die Gruppenarbeit pro Gruppe einmal zur Verfügung gestellt. Die Gruppe beim Museumsrundgang klassifiziert damit die verschiedenen Sortierungen. Dahingegen dient der Arbeitsbogen „Sortierung der Stoffe der Ergebnissicherung. Mit ihm wird sichergestellt, dass die Lernenden wissen, dass man Stoffe nach der Stoffklasse, der Eigenschaft und der Funktion unterscheiden kann. Der naturwissenschaftliche Begriff „Stoff und der Fachbegriff „Stoffeigenschaften sind am Ende dieser Lernumgebung 1 eingeführt. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende diesen Arbeitsbogen. Das interaktive Lernmedium „Lernumgebung 1 – Stoffe sortieren: Kennst du die Stoffe? (Zuordnungsaufgabe) kann unterstützend bei der Einführung der Reihe sein, da es Heterogenität in den Vorkenntnissen abbaut (Kenntnisse der Stoffna- Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 17 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise men). Es sollte von den Schülerinnen und Schülern selbstständig zur Übung verwendet werden können. Lernumgebung 2: Die Schülerinnen und Schüler finden eigene Experimente, um Stoffe auf bestimmte Eigenschaften zu untersuchen. In einem Vortrag müssen die Schülerinnen und Schüler ihren Mitlernenden ihre Arbeitsergebnisse präsentieren und entscheiden, welchen Stoff sie Prof. Cousteau für die Lösung ihres Problems vorschlagen. Die inhaltliche Vorbereitung des Vortrages ist durch einen Arbeitsbogen pro Gruppe vorstrukturiert. Die interaktiven Lernmedien „Lernumgebung 2 – Stoffeigenschaften: Wie kann man Trinkwasser gewinnen? (Quiz) und „Lernumgebung 2 – Stoffeigenschaften: Wie erstelle ich ein Protokoll? (Zuordnungsaufgabe) unterstützen die Versuchsdurchführungen in der zweiten Lernumgebung: „Lernumgebung 2 – Stoffeigenschaften: Wie kann man Trinkwasser gewinnen? (Quiz) ist ein Quiz zu Problemen bei der Trinkwassergewinnung. Es aktiviert problemsensibilisierend Vorwissen. „Lernumgebung 2 – Stoffeigenschaften: Wie erstelle ich ein Protokoll? (Zuordnungsaufgabe) hilft dann bei der Versprachlichung einer Versuchsdurchführung. Beide interaktiven Lernmedien sollten von den Schülerinnen und Schülern selbstständig zur Übung verwendet werden können. Lernumgebung 3: Die interaktiven Lernmedien „Lernumgebung 3 – Stoffe untersuchen: Stoffeigenschaften (Zuordnungsaufgabe), „Lernumgebung 3 – Stoffe untersuchen: Wo kommen die ausgewählten Stoffe in größeren Mengen vor? (Zuordnungsaufgabe) und „Lernumgebung 3 – Stoffe untersuchen: Ordne die Stoffe der richtigen Stoffklasse zu! (Zuordnungsaufgabe) sind Zuordnungsspiele. Sie dienen der Überprüfung der eigenen Kenntnisse, indem sie die Stoffeigenschaften (Brennbarkeit, Schwimmfähigkeit, ) sowie die Herkunft und Klassenzugehörigkeit der Stoffe testen. Alle drei interaktiven Lernmedien sollten von den Schülerinnen und Schülern selbstständig zur Übung verwendet werden können. 4.5.1.1 Gestufte Hilfen Die gestuften Hilfen orientieren sich an den Vorgaben von Dr. Lutz Stäudel*. Sie fördern das selbstständige Lernen, indem sie den Schülerinnen und Schülern Schritt für Schritt Unterstützungen bei der Lösung ihres Problem bieten, aber gleichzeitig auch individuelle Lern- und Lösungswege zulassen, da sie von den Schülerinnen und Schülern nur teilweise oder gar nicht genutzt werden müssen. Die Impulse der gestuften Hilfen sind immer gleich aufgebaut. Für jede Arbeitsgruppe gibt es vier eigene gestufte Hilfen. Die erste Hilfekarte regt die Schülerinnen und Schüler an, das Problem in der Gruppe für sich zu reformulieren und Klarheit über die Aufgabenstellung zu erlangen, d. h. welche Stoffeigenschaft bei ihrem Problem untersucht werden muss. Alle Impulse dienen dazu, dass die Schülerinnen und Schüler Hinweise zu einer strukturierten, naturwissenschaftlichen Lösung erhalten. Die letzte gestufte Hilfe (der Versuchsaufbau bzw. die Versuchsdurchführung) kann für leistungsstarke Gruppen, die die Aufgabe ohne Hilfen bearbeitet haben, auch zur Kontrolle ihrer eigenen Lösung benutzt werden. Dr. Lutz Stäudel ist Autor aus Leipzig. Er war von 1976 bis 2011 an der Universität Kassel in der fachdidaktischen Ausbildung von Chemielehrerinnen und -lehrern tätig. Nach seinem Studium der Chemie, Psychologie und Erziehungswissenschaften in Gießen und Kassel sammelte er Erfahrungen im Modellversuch Umwelterziehung in Baunatal und im Chemieunterricht der Mittel- und Oberstufe. In den vergangenen Jahren war er in zahlreichen wissenschaftlichen Projekten tätig, ebenso im Bereich der Unterrichts- und Schulentwicklung (SINUS). Seine aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind die „Entwicklung von Lern-Aufgaben für den naturwissenschaftlichen Unterricht, der „Lernbereich Naturwissenschaften und methodenorientierte schulbezogene Fortbildungen. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift „Unterricht Chemie und des Friedrich Jahresheftes. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 18 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise Bild: „Hilfekarten 1 Bild „Hilfekarten 2 Bild: „Hilfekarten 3 Bild: „Hilfekarten 4 Das Problem „Koch stellt eine Ausnahme dar. Hier gibt es fünf gestufte Hilfen, da die Aufgabe zweiteilig ist (Untersuchung der Stoffeigenschaft und anschließende Stofftrennung). Als fünfte Hilfe wird nicht die Stofftrennung beschrieben, sondern es werden die benötigten Materialien aufgeführt. Dieses Problem ist für leistungsstarke Gruppen gedacht, so dass anhand der Materialien die Stofftrennung durchgeführt werden sollte. Bei Bedarf kann die Lehrkraft die Versuchsanleitung (gestufte Hilfe Koch 5b) noch herausgeben (Durchführung der Stofftrennung). Der Zugriff zu den gestuften Hilfen darf den Schülerinnen und Schülern nicht unmittelbar möglich sein. Daher ist es sinnvoll, nicht alle Hilfen gleichzeitig zur Verfügung zu stellen. Eine Ablage in der Nähe des Lehrertischs, z. B. in Briefumschlägen, bietet sich an. Zur besseren Übersicht empfiehlt es sich, farblich unterschiedliche Umschläge zu benutzen. Auf dem Umschlag steht immer der Impuls und im Umschlag befindet sich die passende Antwort. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Bild: „Briefumschläge Seite 19 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise So werden die Schülerinnen und Schüler angehalten, sich erst einmal selber eine Antwort auf den Impuls zu überlegen, bevor sie die Antwort zu Rate ziehen. Dies ist vor allem für Lerngruppen sinnvoll, die noch nicht mit gestuften Hilfen gearbeitet haben. 4.5.1.2 Stationenkarten Lernumgebung 3: Jede Station, an der die Lernenden ihren Stoff untersuchen, ist mit den nötigen Experimentiervorrichtungen und einer Experimentieranleitung versehen. 4.5.1.3 Steckbriefe Für die Gestaltung der Steckbriefe erhalten die Gruppen eine Vorlage, anhand derer inhaltliche Strukturierungen vorgegeben werden. Die Schülerinnen und Schüler sind in der Gestaltung ihrer Steckbriefe frei. 4.5.1.4 Bestimmungskarten Es wird erwartet, dass die Lernenden in den Steckbriefen auch Informationen präsentieren, die nicht im Unterricht experimentell untersucht werden können. Diese Informationen erhalten die Schülerinnen und Schüler über Bestimmungskarten, die von der Lehrkraft in Tabellenform für Siedetemperatur und Schmelztemperatur bereitgehalten werden. Weitere Informationen wie Vorkommen, Verwendung und Besonderheiten werden in Textform bereitgestellt. Für die Tabellen und die Texte gibt es jeweils zwei Niveaustufen, die von der Lehrkraft je nach Einschätzung der Lernvoraussetzungen eingesetzt werden sollen. Bestimmungskarte 1: Die Tabelle enthält nur die untersuchten Stoffe. Bestimmungskarte 2: Die Tabelle enthält noch weitere Stoffe. Bestimmungskarte 3: Der Text ist gegliedert. Bestimmungskarte 4: Der Text ist nicht gegliedert. 5 Bewertungsmöglichkeiten Zur Bewertung bieten sich das Experimentieren und die Präsentationen in Lernumgebung 2 (Vortrag) und Lernumgebung 3 (Plakat) an. Dazu müssen den Schülerinnen und Schüler die Regeln für gutes Experimentieren, gute Vorträge und ein gutes Plakat bekannt und z. B. als Plakat im Raum zugänglich sein. Lernumgebung 1 ist aufgrund seiner offenen Aufgabenstellung und des spielerischen Einstiegs in die Einheit nur wenig zur Bewertung geeignet. Die Rallye am Ende der Lernumgebung 3 ist nicht als Bewertungsgrundlage geeignet. Sie dient nur dazu, die Ergebnisse der Gruppenarbeit, d. h. die erstellten Plakate, zu würdigen und Informationen zu sammeln. Bis auf ein zielgerichtetes Lesen und das Ausfüllen von Lücken etc. wird von den Schülerinnen und Schülern keine eigenständige Leistung verlangt. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 20 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise 5.1 Checkliste: Wie erstelle ich ein Plakat? Nr. Hinweise Erledigt Das Wichtigste zuerst – die Überschrift 1 Die Überschrift deines Plakates muss groß und deutlich geschrieben werden, damit man rasch erkennt, um welches Thema es geht. Druckschrift ist besser lesbar als Schreibschrift! Fasse dich kurz! 2 Schreibe nur wenig Text. Kurze Sätze lassen sich leicht lesen und prägen sich besser ein. Häufig reichen Stichworte aus! Den Text gliedern 3 Unterteile das Thema in Abschnitte. Zusammengehörige Inhalte können unter einer Zwischenüberschrift zusammengefasst werden. Ein Bild sagt oft mehr 4 Ein Bild zu deinem Thema bildet den Blickfang für dein Plakat! Gestalte dein Plakat mit dem Bild so, dass es Aufmerksamkeit erweckt. Du findest bestimmt passende Bilder, die dein Thema möglichst interessant abbilden. Gehe aber sparsam mit den Bildern um! Ein Plakat ist kein Fotoalbum! Ordnung schaffen 5 Bilder und Texte sollen nicht wahllos durcheinander gewürfelt werden. Benutze Farben und Symbole (z. B. Pfeile oder Punkte), um den Platz auf deinem Plakat aufzuteilen und zu ordnen. Tipp: Es sieht auch gut aus, wenn man die einzelnen Themen auf bunten DIN A4 Blättern darstellt und entsprechend anordnet – ähnlich wie auf der Titelseite einer Zeitung. Beschränke dich auf wenige Farben! Zeichnungen helfen erklären 6 Manche Dinge lassen sich weder mit Worten noch mit Fotos beschreiben. Für solche Fälle kannst du auch selbst etwas zeichnen. Weniger ist oft mehr 7 Ein Plakat darf nicht zu voll und überladen sein. Habe auch Mut zur Lücke: Freiflächen helfen beim Gliedern! Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 21 von 22 Allgemeine didaktische Hinweise 6 Sicherheitshinweise Lernumgebung 2: Die Gruppe „Blitzschlag experimentiert mit einer 4,5-Volt-Batterie. Es ist darauf zu achten, dass kein Kurzschluss entsteht, d. h. kein Verbraucher, wie z. B. eine Glühlampe dazwischengeschaltet ist, da sich die Batterie und das Kabel in diesem Fall stark erhitzen könnten. Die Gruppe „Hitze arbeitet mit einem Wasserkocher und sehr heißem Wasser. Die Lehrkraft sollte den Wasserkocher immer selbst bedienen. Eine ruhige „Ecke für diese Gruppe, die ein Anstoßen verhindert, wäre gut. Die Gruppe „Koch kann mit einer Kerze experimentieren. Hier ist die Aufsicht der Lehrkraft besonders wichtig. Für das Problem „Koch sollten geschroteter Pfeffer oder Pfefferkörner benutzt werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass ins Auge geratenes Pfefferpulver zu Augenreizungen führen kann. Lernumgebung 3: Bei der Stationenarbeit werden die gleichen Experimente wie in Lernumgebung 2 durchgeführt. Es gelten daher die gleichen Sicherheitshinweise. Die Stationen sind jetzt: elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Literaturnachweis 1 Tanja Tajmel, Sara Hägi-Mead: Sprachbewusste Unterrichtsplanung. Prinzipien, Methoden und Beispiele für die Umsetzung. Waxmann-Verlag Münster.New Yorck 2017, S.80-82 Inci Dirim, Ingrig Gogolin u.a. (Hrsg.): Durchgängige Sprachbildung. Qualitätsmerkmale für den Unterricht. Waxmann-Verlag Münster 2011, S.8-10 2 Inci Dirim, Ingrig Gogolin u.a. (Hrsg.): Durchgängige Sprachbildung. Qualitätsmerkmale für den Unterricht. Waxmann-Verlag Münster 2011, S.8-10 Bildnachweis Bilder Urheber Professorin, Beagle, Weltkarte, Hilfekarten 1, Hilfekarten 2, Anke Travers für iMINT-Akademie. Berlin für SenBJF/Siemens Hilfekarten 3, Hilfekarten 4, Briefumschläge Stiftung, CC BY-SA 4.0 international Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 22 von 22 Handreichung Lernumgebung 1 – Stoffe sortieren Hinweise für die Lehrkraft Zeitbedarf: ca. 2 Unterrichtsstunden 1 Einleitung Die Ozeanologin Cousteau möchte mit ihrem Forschungsschiff „Beagle auf Forschungsreise gehen. Für das erfolgreiche Gelingen der Forschungsreise bedarf es einer guten Vorbereitung. Dazu gehört die Ausstattung und Sortierung des Materiallagers. Die Professorin steht jedoch unter Zeitdruck, da der geplante Abreisetermin nicht verschoben werden kann. Zudem möchte sie sich von ihren Freunden und ihrer Familie verabschieden, da sie für lange Zeit unterwegs sein wird. Sie braucht Unterstützung und kommt auf die Idee, eine Schulklasse um Hilfe zu bitten. 2 Bezug zu fachbezogenen Kompetenzen und Standards des Rahmenlehrplans Berlin/Brandenburg Die Schülerinnen und Schüler können mit Fachwissen umgehen Niveaustufe Stoffeigenschaften mithilfe der Sinne und anhand von Versuchen ermitteln Erkenntnisse gewinnen Niveaustufe C/D mit vorgegebenen Kriterien beschreibend Sachverhalte/Objekte ordnen und vergleichen kommunizieren Niveaustufe Niveaustufe Niveaustufe naturwissenschaftliche Sachverhalte alltagssprachlich beschreiben naturwissenschaftliche Sachverhalte unter Verwendung der Alltagssprache unter Einbeziehung von Fachbegriffen beschreiben mithilfe von Stichworten, Anschauungsmaterialien und Medien Ergebnisse präsentieren Niveaustufe begründet ihre Meinung äußern Niveaustufe C/D mehrdeutige Worte voneinander unterscheiden Niveaustufe C/D zwischen alltags- und fachsprachlicher Beschreibung von Sachverhalten unterscheiden bewerten Niveaustufe C/D Schlussfolgerungen auf der Grundlage naturwissenschaftlichen Alltagswissens ziehen Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 1 von 9 Handreichung 2.1 Bezug zum Basiscurriculum Sprachbildung Die Schülerinnen und Schüler können Sachverhalte und Informationen zusammenfassend wiedergeben Niveaustufe Sachverhalte und Abläufe beschreiben Niveaustufe Beobachtungen wiedergeben Texte schreiben Niveaustufe 2.2 sprachliche Mittel zur Verdeutlichung inhaltlicher Zusammenhänge anwenden Bezug zum Basiscurriculum Medienbildung Die Schülerinnen und Schüler können Informationsquellen und ihre spezifischen Merkmale nutzen Niveaustufe mediale Informationsquellen auswählen und nutzen Suchstrategien anwenden Niveaustufe Suchstrategien aus unterschiedlichen Quellen anwendensprachliche Mittel zur Verdeutlichung inhaltlicher Zusammenhänge anwenden Niveaustufe Suchmaschinen sachgerecht als Recherchewerkzeug nutzen 3 Didaktisch-methodische Hinweise (praktische Hinweise zur Durchführung) Zeitbedarf: ca. 2 Unterrichtsstunden 3.1 Einführung 3.2 Zur Einführung in das Thema wird die Ozeanologin Prof. Cousteau und ihr Forschungsschiff „Beagle präsentiert, im Hintergrund wäre es möglich, Meeresrauschen als Geräusch von einer CD/MP3 einzuspielen. Den Schülerinnen und Schülern sollte hier Zeit eingeräumt werden, von ihren eigenen Erfahrungen auf dem Meer zu berichten. Das öffnet sie noch stärker für das Thema. Die E-Mail sollte von der Lehrkraft vorgelesen werden, denn es handelt sich um einen Klassenauftrag, den die Klasse gemeinsam bearbeiten muss. Die niederschwellige, offene Aufgabe ermöglicht es, die Gruppen für die Erarbeitungsphase beliebig zusammen zu stellen. Arbeitsaufträge Die Aufträge werden von der Lehrkraft formuliert und an der Tafel festgehalten: a) Ordnet die Stoffe in Gruppen. Gebt den Gruppen dann Namen und schreibt diese auf die Aufsteller. b) Schreibt Professorin Cousteau zum Schluss eine E-Mail. Schreibt eure Ordnung Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 2 von 9 Handreichung auf und begründet diese. Benutze die Wörterliste. c) Bereitet euch auf eure Präsentation vor, so dass jeder präsentieren kann. 3.3 Materialboxen 3.4 Die Materialboxen, einschließlich der Wörterliste, werden ausgeteilt. Die Schülerinnen und Schüler werden verschiedene Möglichkeiten finden, ihre Stoffe zu sortieren. Alle gefundenen und begründeten Ordnungen sind möglich (Lösungsvorschläge siehe 1.6). Als Ergebnissicherung schreibt jede Gruppe gemeinsam, wobei jedoch jede Schülerin und jeder Schüler zusätzlich selbst mitschreibt, eine Antwort an Professorin Cousteau. Die Wörterliste unterstützt die Schülerinnen und Schüler, die passenden Formulierungen zu finden. Erarbeitungsphase 1 3.5 Die Schülerinnen und Schüler besprechen sich, wie sie ihre Ordnung der Stoffe präsentieren wollen. Jeder Schüler sollte präsentieren können (Vorbereitung für die Expertenrunde). Sollte noch Zeit sein, ist es möglich, die E-Mails an Frau Cousteau vorzulesen und zu vergleichen. In der zweiten Stunde bereiten die jeweiligen Gruppen der Erarbeitungsphase ihre Tische mit ihrer Ordnung vor, vorausgesetzt, es ist keine Doppelstunde. Parallel dazu bereitet die Lehrkraft die Tafelanschrift der Tabelle des Laufzettels vor. Alternativ kann sie diese auch auf einer Folie mit dem Overhead-Projektor oder dem Smartboard präsentieren. Im Plenum werden die Schülerinnen und Schüler bezüglich der Arten, Eigenschaften und Funktionen von Stoffen instruiert. Gemeinsam im Unterrichtsgespräch werden anhand eines Beispielgegenstandes – Holzkochlöffel (Holz – hart, glatt – zum Rühren) – Antworten für die jeweiligen Tabellenspalten gefunden. Erarbeitungsphase 2 In der zweiten Erarbeitungsphase werden die Gruppen neu zusammengestellt. Je ein Experte der vorangegangenen Gruppen findet sich in einer neuen Gruppe zusammen, d. h. lauten die Gruppen aus der Erarbeitungsphase AAAA – BBBB – CCCC – DDDD, dann sieht die neue Zusammenstellung folgendermaßen aus: ABCD, ABCD, ABCD und ABCD (aus jeder Erarbeitungsgruppe ist somit ein Experte in der neu zusammengestellten Gruppe). Die Schülerinnen und Schüler erhalten als Gruppe einen Laufzettel. Der Experte berichtet, wie er mit seiner Gruppe zu einer Ordnung gekommen ist und versucht mithilfe der neuen Mitglieder diese Ordnung im Laufzettel einzutragen (mögliche Antworten siehe Lösungsblatt). Um zu verhindern, dass alle schreiben, schreibt immer nur der Experte. Falls Nichtschreiber in der Gruppe sind, übernimmt ein Gruppenmitglied den Schreibauftrag. Am Ende des Museumsrundgangs hat jede Gruppe einen Laufzettel nur bezüglich ihrer anfänglich gefundenen Ordnung ausgefüllt. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 3 von 9 Handreichung 3.6 Ergebnissicherung/Plenum Im Plenum findet sich die Klasse wieder zusammen und füllt gemeinsam mithilfe der ausgefüllten Laufzettel die Tabelle an der Tafel aus. Bei der Tabelle geht es nicht darum, den verschiedenen Stoffen bzw. Stoffklassen die passenden Eigenschaften oder Funktionen zuzuordnen, sondern um eine fachlich richtige Zuordnung der Begriffe der Schülerinnen und Schüler. Es ist anzunehmen, dass nicht alle Stoffe benannt werden. Fehlende Stoffe werden in der Tabelle seitens der Lehrkraft ergänzt (Kunststoffe, Naturstoffe, Metalle usw.). Möglich wäre hier auch, dass die Lehrkraft mit bereits vorbereiteten Schildchen die Tabelle ergänzt oder auch von den Schülerinnen und Schülern zuordnen lässt. Im Anschluss daran wird der Arbeitsbogen „Sortierung der Stoffe ausgeteilt und das Tafelbild wird von jedem Schüler abgeschrieben. Schnell arbeitende Schülerinnen und Schüler können neu einzuordnende Begriffe erhalten (z. B. verschiedenen Metallsorten o. Ä.). Es kann ggf. ein Hinweis gegeben werden, wie Wissenschaftler sortieren würden (z. B. Naturstoffe, Kunststoffe, Metalle usw.). Auch Schülerinnen und Schüler, die z. B. aufgrund einer Lese-Rechtschreib-Schwäche Schwierigkeiten haben die Tabelle abzuschreiben, sollten angehalten werden, mit dem Abschreiben zu beginnen. Fehlende Abschriften können durch Kopieren ergänzt werden (siehe mögliche Lösungstabelle). Tipp: Um Kinder zu unterstützen, die beim Schreiben Schwierigkeiten haben, sollte die Lehrkraft während des Museumsrundganges die bereits gefundenen Sortierungen festhalten und einen Lösungszettel vorbereiten. 3.7 Vertiefung/Wortschatzarbeit Sprachliche Hilfe: Liste der Gegenstände und Stoffe (Lernumgebung 1 – Stoffe sortieren (Arbeitsblatt Sprachbildung 1)) Die Liste der Gegenstände und Stoffe kann ebenfalls zur vertiefenden Wortschatzarbeit genutzt werden. Im Folgenden werden drei verschiedene Varianten beschrieben. Variante 1: Zuordnung Zuordnung ist ein Legespiel, bei dem Kärtchen mit zueinander passenden Bildern und/ oder Fachbegriffen richtig zugeordnet werden müssen. Durch Zerschneiden der Tabelle (Liste der Gegenstände und Stoffe) in die einzelnen Zellen erhält man die Kärtchen für die Zuordnung der Bilder und Fachbegriffe. Zu Beginn des Spiels werden die Kärtchen gemischt und offen verteilt, um sie dann wieder in Dreierreihen (Bild, Gegenstand und Stoff) richtig zuzuordnen. Dies kann in Einzelarbeit, Partnerarbeit oder kleinen Gruppen durchgeführt werden. Variante 2: Memory Das Memory ist ein Spiel, bei dem Kärtchen mit je zwei zueinander passenden Bildern und/oder Fachbegriffen durch Aufdecken gefunden und richtig zugeordnet werden müssen. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin/Siemens Stiftung 2018. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international Seite 4 von 9 Handreichung Durch Zerschneiden der Tabelle in die einzelnen Zellen erhält man die Kärtchen für das Memory. Da es drei zueinander passende Kärtchen (Bild, Gegenstand und Stoff) gibt und man sich für zwei davon entscheiden muss, sind drei Spielvarianten möglich. Zu Beginn des Spiels werden die Kärtchen mit den Gegenständen und Stoffen (bzw. Bildern und Gegenständen oder Bildern und Stoffen) gemischt und verdeckt auf den Tisch gelegt. Die Spielregeln müssen im Vorfeld geklärt werden. Memory kann in Partnerarbeit oder kleinen Gruppen durchgeführt werden. Variante 3: Zwei aus Drei „Zwei aus Drei ist ein anspruchsvolles Spiel bei dem die Spieler Ordnungskriterien entwickeln, die es erlauben, zwei Gegenstände klar von einem Dritten abzugrenzen. Durch Zerschneiden der Tabelle in die einzelnen Zellen erhält man die Kärtchen für das Spiel. Bei dem Spiel „Zwei aus Drei verwendet man nur die Bilder oder nur die Gegenstände. Zu Beginn des Spiels werden die Kärtchen gemischt und verdeckt auf einen Stapel gelegt. Es werden nun drei Karten vom Stapel genommen und offen in die Mitte gelegt. Die Mitspieler müssen nun zwei der drei Karten durch selbst entwickelte Ordnungskriterien abgrenzen. Gelingt dies einem Spieler, muss er seine Ordnung nennen und begründen und darf sich die zwei Karten nehmen. Danach werden zwei neue Karten aufgedeckt, damit wieder drei Karten in der Mitte liegen. Es gewinnt die Spielerin bzw. der Spieler mit den meisten Karten am Ende des Spiels. Im Folgenden wird durch einige Beispiele verdeutlicht, wie die Ordnungskriterien lauten könnten. Beispiel 1 der Nagel; der Spatel; die Büroklammer – Nagel und Büroklammer sind beide aus Metall. Beispiel 2 die Kugel; die Bindekordel; der Draht – Bindekordel und Draht können beide zum Befestigen verwendet werden. Beispiel 3 die Kerzenhülle; die Flasche; der Untersetzer – Kerzenhülle und Flasche können beide befüllt werden. Sprachliche Hilfe: Satzbaukasten (Lernumgebung 1 – Stoffe sortieren (Arbeitsblatt Sprachbildung 2)) Satzbaukästen sind in Blöcken zusammengefasste Satzelemente. Der Satzbaukasten dient als Sprach- bzw. Schreibhilfe, damit die Schülerinnen und Schüler lernen, wie man die Zuordnung von Gegenstand und Stoff richtig ausdrückt. Sprachliche Hilfe: Interaktives Lernmedium: Lernumgebung 1 – Stoffe sortieren: Kennst du die Stoffe? (Zuordnungsaufgabe) Die Übung kann jederzeit nach der Lernumgebung 1 eingesetzt werden, sie dient der Wortschatzarbeit. Das interaktive Lernmediu