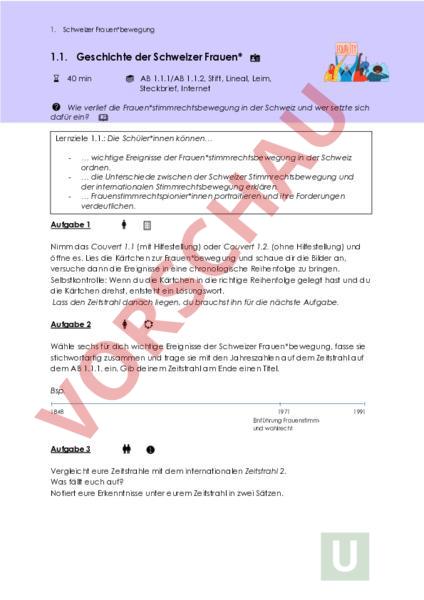Arbeitsblatt: Werkstatt zur Gleichstellung und Frauen*bewegung in der Schweiz
Material-Details
Die umfangreiche Werkstatt bietet unterschiedliche Aufgaben zur Gleichstellungs- und Frauengeschichte der Schweiz. Im Hauptdossier befinden sich alle Stationen-, Arbeitsblätter und das Lernjournal. Im Lehrpersonenkommentar befinden sich eine ausführliche Sachanalyse und didaktische Hinweise.
Geschichte
Schweizer Geschichte
7. Schuljahr
78 Seiten
Statistik
212679
203
1
27.04.2025
Autor/in
Luna Weggler
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
1. Schweizer Frauen*bewegung 1.1. Geschichte der Schweizer Frauen* 40 min AB 1.1.1/AB 1.1.2, Stift, Lineal, Leim, Steckbrief, Internet Wie verlief die Frauen*stimmrechtsbewegung in der Schweiz und wer setzte sich dafür ein? Lernziele 1.1.: Die Schüler*innen können wichtige Ereignisse der Frauen*stimmrechtsbewegung in der Schweiz ordnen. die Unterschiede zwischen der Schweizer Stimmrechtsbewegung und der internationalen Stimmrechtsbewegung erklären. Frauenstimmrechtspionier*innen portraitieren und ihre Forderungen verdeutlichen. Aufgabe 1 Nimm das Couvert 1.1 (mit Hilfestellung) oder Couvert 1.2. (ohne Hilfestellung) und öffne es. Lies die Kärtchen zur Frauen*bewegung und schaue dir die Bilder an, versuche dann die Ereignisse in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Selbstkontrolle: Wenn du die Kärtchen in die richtige Reihenfolge gelegt hast und du die Kärtchen drehst, entsteht ein Lösungswort. Lass den Zeitstrahl danach liegen, du brauchst ihn für die nächste Aufgabe. Aufgabe 2 Wähle sechs für dich wichtige Ereignisse der Schweizer Frauen*bewegung, fasse sie stichwortartig zusammen und trage sie mit den Jahreszahlen auf dem Zeitstrahl auf dem AB 1.1.1. ein. Gib deinem Zeitstrahl am Ende einen Titel. Bsp. 1848 1971 Einführung Frauenstimmund wahlrecht Aufgabe 3 Vergleicht eure Zeitstrahle mit dem internationalen Zeitstrahl 2. Was fällt euch auf? Notiert eure Erkenntnisse unter eurem Zeitstrahl in zwei Sätzen. 1991 Aufgabe 3 Emilie Lieberherr, Iris von Roten und Meta v. Salis waren drei Vorkämpfer*innen für das Frauenstimmrecht, welche zu unterschiedlichen Lebzeiten und Regionen für die Gleichstellung der Geschlechter gekämpft haben. Emilie Lieberherr (1924-2011) Iris von Roten (1917-1990) Meta v. Salis (1855-1929) Wähle eine von ihnen aus und sichte das Material dazu. Lies den Informationstext zu deiner Person, schaue dir die Bilder an und schaue dir die weiteren (online) Quellen an. Erstelle ein Portrait in Form eines Steckbriefes von deiner Frauenrechtler*in. Benutze dafür die Steckbriefvorlage. Expert*innenaufgabe 1 «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich.» Dieser Artikel steht seit 1848 in unserer Bundesverfassung. Und doch sagte die Männer erst über hundert Jahre später im Jahr 1971 Ja zur Einführung des Frauenstimm- und wahlrechtes. Schau dir nun das Bild 1 an. 1. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Plakat liest? Nimm Stellung zu dieser Aussage. 2. Recherchiere im Internet nach möglichen Gründen, weshalb die Frauen so lange auf gleiche Rechte warten mussten. Fasse deine Erkenntnisse stichwortartig auf das AB 1.1. zusammen. 1. Schweizer Frauen*bewegung 1.2. Abstimmungskampf Frauenstimm- und wahlrecht 35 min Karte 1,2,3, Flyer 1 und 2, AB 1.2., Rollenkarten, Internet Was waren die Pro- und Kontra-Argumente des Frauenstimmrechts, wie sahen die Abstimmungsresultate 1959 und 1971 aus und wie unterscheiden sie sich zu aktuellen Abstimmungsresultaten über Gleichstellungsthematiken? Lernziele 1.2.: Die Schüler*innen können die Pro- und Kontraargumente der Befürworter*innen resp. Gegner*innen darlegen. die Resultate der Frauenstimmrechtabstimmungen 1959 und 1971 vergleichen und Unterschiede feststellen. die Abstimmungsresultate von 1959 und 1971 aktuellen Abstimmungsresultaten über Gleichstellungsthemen gegenüberstellen. Aufgabe 1 „Der Kampf für und gegen das Frauenstimmrecht wurde intensiv geführt. In einer ersten nationalen Abstimmung 1959 lehnte eine Mehrheit der Männer das Anliegen deutlich ab. Zu Beginn der 1970er Jahre wandelte sich allerdings die Stimmung zugunsten des Stimmrechts für Frauen (Wer hat eine Stimme?, phlu). Lest die Flyer 1 und 2, welche im Kanton Luzern für oder gegen das Frauenstimmrecht eingesetzt wurden, aufmerksam durch. Arbeitet jeweils zwei Argumente für oder gegen das Frauenstimm- und wahlrecht heraus und notiert sie in die Kolonnen auf dem AB 1.2. Aufgabe 2 (mind. 4 Personen, max. 6 Personen) Im Folgenden findet ihr verschiedene Rollenkarten. Die Rollen sind angelehnt an Personen, die an der Stimmrechtsdebatte beteiligt waren. Schneidet die Rollenkarten aus und zieht jeweils eine Rollenkarte. a. Lest die Informationen zu eurer Person. Überlegt euch weitere Angaben zur Person und schreibt sie auf eure Rollenkarte: Wie alt ist sie ungefähr? Welcher Tätigkeit geht sie nach? Ist sie berufstätig? Welches Rollenbild vertritt sie? Wie versteht sie beispielsweise die Rolle von Frau und Mann? b. Überlegt euch in Einzelarbeit, welche Argumente und Überlegungen eure Person in die Debatte einbringen könnte. c. Stellt euch vor, ihr wärt vor rund 50 Jahren zusammengekommen und hättet folgende Fragen diskutiert: Seid ihr für oder gegen das Frauenstimmrecht? Weshalb? So sehe ich die Rolle der Frau und des Mannes in unserer Gesellschaft. (Wer hat eine Stimme, phlu) Aufgabe 3 1. Vergleicht und diskutiert die Abstimmungsresultate aus dem Jahre 1959 (1. Abstimmung) und 1971 (2. Abstimmung) (Karte 1 und 2). 2. Schaut euch anschliessend die Karte 3 zu den Abstimmungsresultaten 2020 über den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub an. In dieser Abstimmung ging es um die Gleichstellung der Männer und ihr Recht auf Vaterschaftszeit. Was ist besonders auffällig an den drei Karten? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede seht ihr? Vermute, weshalb sie zustande kommen. Notiert eure Gedanken auf das AB 1.2. 1. Schweizer Frauen*bewegung 1.3. Anna 1971 35 min Internet Wie hätte die Frauenstimmrechts Debatte auf Social Media möglicherweise ausgesehen? Lernziele 1.3.: Die Schüler*innen können zwischen Argument und Meinung unterscheiden. eine regulierte Debatte führen und das eigene Wissen einfliessen lassen. historische Ungerechtigkeiten zwischen Mann und Frau in der Schweiz benennen. Geschlechterstereotype identifizieren und überwinden. eine historische Situation analysieren und Verbindungen zu aktuellen Ereignissen herstellen. Aufgabe 1 Geh auf die Internetseite: www. anna1971.ch, scrolle nach unten und starte das Spiel. Stell dir vor, du bist eine junge Frau im 1971 und hast keine politischen Rechte. Wie hättest du dich auf Social Media präsentiert, wenn es damals Social Media gegeben hätte? Folge der Spielanleitung und spiele das Spiel für ca. 25 min. Aufgabe 2 Pausiere das Spiel. Du kannst es zuhause fertig spielen. Tauscht euch zu zweit aus: Wie habt ihr das Spiel erlebt? Habt ihr etwas gelernt? Welche Archivbeiträge oder Situationen haben euch am stärksten beeindruckt? Welche Rechte fehlten den Frauen damals? Was war im Vergleich zu heute anders? Hätten soziale Netzwerke oder andere moderne Kommunikationsmittel die Abstimmung beeinflusst? Auf welche Weise? 1. Schweizer Frauen*bewegung 1.4. Gleichstellung und Politik 25 min AB 1.4., Stifte, Internet Welche Arten von politischer Mitwirkung gibt es und wie sieht das Geschlechterverhältnis in der Politik aus? Lernziele 1.4.: Die Schüler*innen können unterschiedliche Mittel für die politische Mitwirkung nennen und unterscheiden. das aktuelle Geschlechterverhältnis in der Politik bestimmen und interpretieren. Aufgabe 1 Bestimmt hast du in gewissen Alltagsdiskussionen auch schon deine Meinung geäussert oder dir überlegt, deine Stimme zu erheben. Trage deine Einschätzung in der Skala ein von 1 (Meine Stimme findet kein Gehör) bis 5 (Meine Stimme zählt) auf dem AB 1.3. ein. Aufgabe 2 Diskutiert zu zweit: Welche Möglichkeiten gibt es, damit eure Stimmen vermehrt gehört werden? (z.B. Mitarbeit an Aktionen, Engagement in Vereinen.etc.) Aufgabe 3 Seit über 150 Jahren setzen sich Menschen für die Gleichstellung der Geschlechter ein. Schaue dir die Bilder 3-7 auf dem AB 1.3. an. Mit welchen Mitteln wollen sie sich Gehör verschaffen? Ordne die Formen des Politisch-aktiv-Werdens den Abbildungen zu. Diskutiert zu zweit und haltet eure Erkenntnisse stichwortartig fest: Was haltet ihr von den unterschiedlichen Formen? Aufgabe 4 Mit der Volljährigkeit können sich Schweizer*innen auch für ein politisches Amt zur Verfügung stellen. Bei einer Wahl gehören sie danach einem politischen Gremium an. Das Schweizer System teilt die Entscheidungsebenen in drei Gewalten auf: die Legislative (Gesetzgebend – z.B. Parlament), die Exekutive (Gesetzausführend – z.B. Bundesrat) und die Judikative (rechtssprechende Gewalt – z.B. Kantonsgericht). Wie sieht das Geschlechterverhältnis in der Legislative (National- und Ständerat, Grosser Rat, Gemeindeparlament) und der Exekutive (Bundesrat, Regierungsrat oder Gemeinderat) auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene aus? Recherchiere im Internet (Suche nach: Frauenanteil im oder Geschlechterverhältnis) und trage die Anzahl Frauen und Männer in politischen Gremien im AB 1.4. ein. Was hat das Geschlechterverhältnis für Auswirkungen auf unsere Gesetze und Leben? Welche Möglichkeiten gibt es, um dieses Verhältnis zu ändern? Äussere deine Vermutungen auf 2. Arbeitswelt 2.1. Lohnunterschiede 20 min AB 2.1., Rechner Was sind geschlechterspezifische Lohnunterschiede? Lernziele 2.1.: Die Schüler*innen können erläutern, was ein unerklärter und erklärter Lohnunterschied ist. begründen, wie es zu Lohnunterschieden zwischen den Geschlechtern kommen kann. Aufgabe 1 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit wurde schon vor über 100 Jahren von Frauenrechtler*innen gefordert. Trotz Gleichstellungsartikel gibt es immer noch Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern. Schaut euch die Grafik 1 aus dem Jahr 2018 zu den Lohnunterschieden an und lest das Kästchen zum Gender Pay Gap. Diskutiert zu zweit: Was fällt euch auf? Worüber seid ihr erstaunt? Erklärt euch gegenseitig, was ein erklärter und unerklärter Unterschied ist. Macht ein Beispiel dazu. Notiert eure Erkenntnisse in zwei Sätzen auf das AB 2.1. Aufgabe 2 1. Lies den Text 1 sorgfältig durch und markiere wichtige Stellen. 2. Recherchiere weitere Unterschiede zwischen sozialen bzw. technischen Berufen und wie viel man in diesen Berufen durchschnittlich verdient auf Schaue dabei auf der Tabelle 1, dass du Berufe nimmst, welche auf demselben Ausbildungsniveau sind. 3. Häufig hört man, dass die Lohnlücke vor allem daher kommt, dass Frauen die falschen Berufe wählen. Diskutiere die Frage, ob Frauen selbst schuld sind, wenn sie durchschnittlich weniger verdienen als Männer (Hans-BöcklerStiftung). Begründet eure Meinungen auf dem AB 2.1. Expert*innenaufgabe 1 Stellt euch vor, ein Mann und eine Frau treten per 01.01.2021 eine neue Stelle in einer grossen Firma an. Die Frau und der Mann leisten genau dieselbe Arbeit. Der Mann verdient dabei 6500.-, die Frau für die gleiche Arbeit nur 5720.- (hier wird mit einem effektiven Lohnunterschied von 12% gerechnet). Bis zu welchem Datum (Gender Pay Day) arbeitet die Frau theoretisch ohne Lohn? 2. Arbeitswelt 2.2. Unbezahlte Arbeit – Care-Arbeit 25 min Arbeitsblatt 2.2., Internet Was ist unbezahlte Arbeit/Care Arbeit und welchen Stand hat sie in unserem Wirtschaftssystem? Lernziele 2.2.: Die Schüler*innen können den Unterschied zwischen unbezahlter und bezahlter Arbeit erläutern. die Bedeutung und Wichtigkeit für die Allgemeinheit von unbezahlter Arbeit fassen. den Konflikt zwischen der Erwerbs- und unbezahlten Arbeit in unserem Wirtschaftssystem aufzeigen und erklären. Aufgabe 1 Denk an deine Kindheit zurück/Jugend und kreuze auf dem AB 2.2. an. Aufgabe 2 Vergleiche deine Antworten mit den Antworten deiner*s Partner*in. Welche Gemeinsamkeiten/Unterschiede gibt es? Was fällt euch auf? Fasst eure Erkenntnisse in zwei Sätzen zusammen und schreibt sie aufs AB 2.2. Aufgabe 3 Diskutiert zu zweit: Was versteht ihr unter Arbeit? Care-Arbeit/unbezahlte Arbeit? Wirtschaft? Aufgabe 4 Schaut euch nun das Video „Wirtschaft ist Care an: Diskussion: Hat sich euer Verständnis für die obigen Begriffe (Arbeit, Care/unbezahlte Arbeit, Wirtschaft) verändert? Was bedeutet für euch Wirtschaft ist Care? Welche Probleme gibt es bezüglich unbezahlter Arbeit im heutigen Wirtschaftssystem? Schreibt dazu jeweils 1-2 Sätze aufs AB 2.2. Aufgabe 5 Kreuze nun die letzte Frage auf AB 2.2. an. Expert*innenaufgabe 1 Stelle die Beziehung zwischen Care Arbeit ( unbezahlte Arbeit) und der Wirtschaft (bezahlte Arbeit) in Form eines Concept-Maps. 3. Vielfalt der Geschlechter 3.1. Stereotypisierte Geschlechtermerkmale 35 min Couvert 3.1., Stoppuhr, Stifte, AB 3.1., 3 A4-Blätter, Box 3.1. Welche stereotypischen Geschlechtermerkmale schweben in unseren Köpfen und welche in der Gesellschaft? Lernziele 3.1.: Die Schüler*innen können stereotypische Geschlechterklischees erkennen, hinterfragen und reflektieren. eigene Stereotypen erkennen und hinterfragen. aufgrund von stereotypisierten Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft die eigene Haltung bezüglich Geschlechterstereotypen identifizieren. Aufgabe 1 Im Couvert 3.1. hat es Begriffe für ein Pantomime-Spiel. Teilt euch in zwei Gruppen auf und versucht die Begriffe pantomimisch darzustellen. Ihr habt jeweils 1 Minute Zeit pro Gruppe, nur die eigene Gruppe darf raten. Es gibt insgesamt 2 Durchgänge pro Gruppe. Keine Geräusche sind erlaubt. Diskussion nach dem Spiel: Wie war es für euch, diese Begriffe darzustellen? Was ist euch beim pantomimischen Darstellen aufgefallen? Verwendet ihr solche Vergleiche (Werfen wie ein Mädchen) auch in eurem Alltag? Ja/Nein, weshalb? Aufgabe 2 1. Kreuze auf dem AB 3.1. an, was für dich stimmt (wähle zuerst nur zwischen den ersten drei Feldern weiblich/männlich/neutral aus.) 2. Kreuze jetzt auch an, was auf dich zutrifft (Ich). Aufgabe 3 Vergleiche deine Antworten mit denen deiner*s Partner*in. Was fällt euch auf? Gestaltet je ein Blatt mit den Titeln «Eher männlich», «Eher weiblich» und «Neutral» und schreibt die Begriffe auf, welche ihr diesen Kategorien zugeordnet habt. Aufgabe 4 Vergleicht die Blätter aus der Aufgabe 3 mit der Kategorie Ich auf dem AB 3.1. Gibt es Zuordnungen, welche sowohl zu euch, aber auch einem anderen Geschlecht zutreffen oder welche auf euch zutreffen, wohl nicht auf euer Geschlecht? (z.B. Lisa ordnet die Eigenschaft stark zu «eher männlich» ein, hat es aber auch bei «Ich» angekreuzt) Was löst das bei euch aus? Welche Geschlechterstereotypen gibt es sonst in der Gesellschaft noch? Hat es Folgen und Auswirkungen für euch, wenn die Gesellschaft Eigenschaften/Tätigkeiten/Aussehen einem Geschlecht zuordnen? Diskutiert und notiert eure Erkenntnisse in 2-3 Sätze aufs AB 3.1. Aufgabe 5 (max. 10 min) Nägel lackieren, schminken, mit Absatzschuhen laufen werden grundsätzlich eher als «weiblich» gesehen. Rasenmähen, gamen oder Fussball spielen werden grundsätzlich eher zum männlichen Geschlecht zugeordnet. In der Box 3.1. hat es unterschiedliche Dinge, welche ihr ausprobieren und benutzen dürft. Bitte behandelt sie vorsichtig und legt sie danach wieder vollständig zurück in die Box. 3. Vielfalt der Geschlechter 3.2. Biologisches vs. soziales Geschlecht 15 min Genderbread-Person Blatt, Couvert 3.2., Leuchtstift Was ist das biologische und was das soziale Geschlecht und wie unterscheiden sie sich? Lernziele 3.2.: Die Schüler*innen können erklären, was das soziale und biologische Geschlecht ist. können die Unterschiede zwischen dem biologischen und sozialen Geschlecht bestimmen. Aufgabe 1 Schaue dir die Genderbread-Person (abgeleitet aus dem Englischen: Gingerbread Lebkuchen) genau an und lies die Bezeichnungen. Wenn du Sachen nicht verstehst, kannst du auch im Glossar nachschauen. Aufgabe 2 Lest jetzt die Erklärung zum biologischen und sozialen Geschlecht genau durch und markiert die wichtigen Stellen mit Leuchtstift. Zum Verständnis: Im Deutschen gibt es für das biologische und soziale Geschlecht nur einen Begriff: das Geschlecht. Im Englischen gibt es einen Unterschied: biologisches Geschlecht sex soziales Geschlecht gender Biologisches Geschlecht „Zwar basiert das biologische Geschlecht (englisch „sex) auf sicht- und messbaren Faktoren wie Chromosomen, Hormonen, äusseren und inneren Geschlechtsorganen, z.B. Vulva, Eierstöcke, Östrogen und XX-Chromosomen als weiblich; und Hoden, Penis, Testosteron und XY-Chromosomen als männlich, so bedeutet dies jedoch nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, deren biologisches Geschlecht mehrdeutig ist. Diese Menschen werden als inter*, intersexuell, oder intergeschlechtlich bezeichnet. Oft werden ihre äußeren Geschlechtsorgane jedoch schon als Säuglinge operativ an „männlich oder „weiblich angepasst, um sie in diese gesellschaftlich konstruierten Kategorien einordnen zu können. (Auszug auf Sex vs. Gender: Biologisches soziales Geschlecht, echte-vielfalt.de) Soziales Geschlecht „Der Begriff „Gender- bezeichnet das soziale Geschlecht, wo es im Gegensatz zum biologischen Geschlecht durch Erziehung, gesellschaftliches Rollenverständnis und Rollenzuschreibungen geprägt ist. Gender kann als eine wesentliche Kategorie betrachtet werden, die gesellschaftliche Strukturen prägt. Es ein Gliederungsprinzip, das Männer und Frauen in Geschlechterverhältnissen und damit verbundenen Hierarchien positioniert, das heisst, es geht immer auch um Ungleichheit und Machtverhältnisse. Im alltäglichen Miteinander werden das soziale Geschlecht sowie die persönliche Geschlechtsidentität von den Menschen selbst aktiv hergestellt und reproduziert in der Forschung wird es als „doing gender bezeichnet. „Männer und „Frauen sind zudem keine Gruppen, sondern unterscheiden sieh Beispielsweise nach Bildungsstatus, Einkommen, Versorgungs- und Lebensform. (Auszug aus Geschlechtergerechtigkeit und Klimapolitik, bpd.de) Aufgabe 3 Versucht nun mithilfe der Genderbread-Person und den Erklärungen, die Begriffe im Couvert 3.2. dem sozialen Geschlecht (gender) oder biologischen Geschlecht (sex) zuzuordnen. 3. Vielfalt der Geschlechter 3.3. Geschlechterbilder im Hip Hop 30 min AB 3.3., Internet, Kopfhörer Wie zeigen sich Geschlechterbilder und Sexismus im Hip Hop? Lernziele 3.3.: Die Schüler*innen können beschreiben, was Sexismus ist. anhand von unterschiedlichen Musikvideos Geschlechterrollen erkennen, benennen und problematisieren können. diskriminierungsfreien Hip Hop und sexistischen Hip Hop auswerten und vergleichen. Aufgabe 1 Lies die zwei Definitionen von Sexismus. Definitionen: Was ist Sexismus? Education21.ch, Glossar Diskriminierung (online): Diskriminierende Haltung aufgrund des Geschlechts und damit verbundene Stereotype. Sexismus richtet sich in einer männerdominierten Gesellschaft vorwiegend – aber nicht ausschliesslich – gegen Frauen. Diese werden durch Worte, Gesten, Verhaltensweisen oder Handlungen herabgewürdigt, diskriminiert oder ausgeschlossen. Duden (online): 1. Vorstellung, nach der eines der beiden Geschlechter dem anderen von Natur aus überlegen sei, und die [daher für gerechtfertigt gehaltene] Diskriminierung, Unterdrückung, Zurücksetzung, Benachteiligung von Menschen, besonders der Frauen, aufgrund ihres Geschlecht. Aufgabe 2 Schaut euch das Video von Farid Bang an und beantworte die Fragen in der Spalte 1 auf dem AB 3.3. Farid Bang – Killa (Pädagogisches Begleitmaterial zur Ausstellung PerspektivWechsel) Aufgabe 3 Schaut das/die Video(s) von Tapete, Cryying Wölf, Sookee und/oder R3-SQWAD. Beantwortet anschliessend die Fragen auf das AB 3.3. in der Spalte 2. Tapete, Crying Wölf, Sookee – Brustmuskeldance R3-SQWAD – Hörbar Sichtbar (Pädagogisches Begleitmaterial zur Ausstellung PerspektivWechsel) Aufgabe 4 Vergleicht und diskutiert eure Antworten in der Gruppe. Diskutiert anschliessend die Frage: Muss Hip Hop/Rap Musik automatisch diskriminierend resp. sexistisch sein? Welche anderen Personengruppen sind von diskriminierenden Äußerungen betroffen? Aufgabe 5 Notiere deine Erkenntnis auf das AB 3.3. 3. Vielfalt der Geschlechter 3.4. Intersektionalität 40 min AB 3.4., Stifte, Rollenkärtchen, Lehrperson Wie fühlt sich Intersektionalität an? Lernziele 3.4.: Die Schüler*innen können empathisch unterschiedliche Perspektiven einnehmen. die unterschiedlichen Chancenverteilung, Möglichkeiten und Mehrfachdiskriminierung verstehen. ihre eigene Position in der Gesellschaft reflektieren. Folgendes Material: Methode 5: Wie im richtigen Leben sind Bildungsmaterialien der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Aufgabe 1 (mind. 4, max. 7 Personen) Zieht jeweils eine Karte aus den 5 Merkmalskategorien, die unterschiedliche gesellschaftliche Differenzlinien markieren: 1. 2. 3. 4. 5. Sexuelle Orientierung, Geschlecht und Beruf Alter und Religion/Weltanschauung Bildung und Kinder Land der Geburt und Staatsangehörigkeit Weitere Eigenschaften und Hobbies Wenn ihr einzelne Begriffe nicht kennt, fragt eure LP oder schlagt im Glossar nach. Aufgabe 2 (10min) Denkt euch nun in «eure» Rolle hinein. Zur Unterstützung erhaltet ihr einen Personenbogen (AB «Wie im richtigen Leben»). Füllt dieses in Einzelarbeit für eure «neue» Persönlichkeit aus. Behaltet die Rollendetails für euch. Aufgabe 3 Stellt euch in der Mitte des Raums nebeneinander in einer Reihe auf. Die Lehrperson wird nun eine Reihe an Aussagen vorlesen. Überlegt jeweils für euch, ob ihr der jeweiligen Aussage aus der Sicht eurer Rolle zustimmen könnt oder nicht. Alle, die mit «Ja» antworten können, gehen dann einen Schritt nach vorne. Trifft die Aussage nicht auf euch zu, tretet ihr einen Schritt zurück. Seid ihr euch unsicher, dann bleibt an eurem Platz stehen. Während der Durchführung dürfen keine Nachfragen gestellt werden. Wenn eine Aussage nicht verstanden wird, bleibt ihr stehen. Aufgabe 4 Nach der Übung bleiben alle auf ihrem Platz stehen. Die Lehrperson interviewt 3 Personen (eine vordere, eine aus dem Mittelfeld und eine hintere) nun kurz. Antwortet entsprechend eurer Rolle. Aufgabe 5 (ca. 15min) Gruppendiskussion mit der Lehrperson: Wie ist es euch mit der Übung ergangen? Was war euch unklar? Wie gut konntet ihr euch in «eure» Rolle und die damit verbundenen Lebensbedingungen einfühlen? Warum können Menschen bestimmte Dinge realisieren bzw. warum nicht? Welche Möglichkeiten zur Veränderung ihrer Situation haben die verschiedenen Gruppen? Worauf haben sie keinen Einfluss? Was sollte sich ändern? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Was können wir unternehmen, um gesellschaftliche Ungleichverhältnisse und damit verbundenen Handlungsbeschränkungen abzubauen? Aufgabe 6 Notiere zum Abschluss deine Gedanken zu den drei Fragen auf das AB 3.4. Wie hätte die Aufstellung ausgesehen, wenn ihr als reale Personen auf die Aussagen geantwortet hättet? Wo hättet ihr persönlich gestanden? Welchen Beitrag kann ich für eine gerechtere Gesellschaft leisten? 4. Genderspezifische Gewalt 4.1. #metoo 25 min AB 4.2., Leuchtstifte Was ist die #metoo-Bewegung, weshalb wurde sie gestartet, welches Ziel verfolgt sie und wie wird sie wahrgenommen? Lernziele 4.1.: Die Schüler*innen können den Ursprung und das Ziel der #metoo-Bewegung erklären. unterschiedliche Ansichten über die #metoo-Bewegung darstellen. Stellung nehmen zur #metoo-Debatte. auf Hilfsangebote für Opfer von sexualisierter/häuslicher Gewalt zurückgreifen. Trigger-Warnung: In diesem Posten geht es unter anderem um sexualisierte Gewalt. Aufgabe 1 Was weisst du über die #metoo-Bewegung? Notiere dein Vorwissen auf das AB 4.1. Aufgabe 2 Lest die Erklärung zu #metoo durch und unterstreicht das Wichtige. „Unter dem Hashtag #metoo protestieren weltweit Frauen gegen sexuelle Belästigung. Die Bewegung ist eine Reaktion auf die Vorwürfe von Frauen über sexuelle Übergriffe des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein. Die Schauspielerin Alyssa Milano rief Frauen dazu auf, ihre Erfahrungen auf Twitter zu schildern: „Wenn ihr einmal sexuell belästigt oder angegriffen wurdet, schreibt #metoo unter diesen Tweet. Ziel der Aktion ist es, auf das Ausmass sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe aufmerksam zu machen und eine Debatte über Alltagssexismus, sexuelle Gewalt und sexuelle Diskriminierung anzustoßen. Innerhalb weniger Tage entstanden unter dem Hashtag #metoo mehrere Millionen Tweets. Im Verlauf der Aktion wurden zahlreiche prominente Männer der sexuellen Belästigung oder sexuellen Gewalt beschuldigt (). Die Tweets der Frauen zeigen, dass sexuelle Übergriffe keineswegs auf die Filmbranche beschränkt sind, sondern überall vorkommen: im Arbeitsleben, in der Familie und auch in den Schulen. Dieser Alltagssexismus kann sich insbesondere dann manifestieren, wenn die Opfer schweigen, weil sie nicht damit rechnen können, ernst genommen zu werden, und die Täter keine Sanktionen befürchten müssen. Eine diskriminierungsfreie Kultur entsteht hingegen am ehesten dort, wo eine Gemeinschaft sich über Verhaltensregeln und grundlegende ethische Normen verständigt und sexuelle Diskriminierung ernst nimmt (Zeit für die Schule Arbeitsblätter: metoo: Das Schweigen brechen). Aufgabe 3 Die #metoo- Bewegung rief unterschiedliche Reaktionen auf. Viele empfanden es als Erlösung, dass Alltagssexismus endlich in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, andere Frauen als auch Männer störte die Täter-Opfer Sicht oder nahmen es als allgemeine Anschuldigungen der Männer wahr. Person liest Artikel (Langsamleser*in) und Person liest Artikel (Schnellleser*in). Tauscht euch anschliessend zu den Artikeln aus und diskutiert: Welche Positionen nehmen die Texte ein und welche Argumente werden genannt? Was sind die Forderungen der Autoren? Könnt ihr euch mit einer Meinung identifizieren? Aufgabe 4 Sexuelle Diskriminierung und Gewalt ist nach wie vor Thema in unserer Gesellschaft, sei es in Form von unangebrachten Kommentaren, ungewollten Berührungen oder häuslicher oder sexualisierter Gewalt. Denke an Alltagsbeispiele und an die Informationen zur #metoo-Bewegung und nimm Stellung zu deiner Haltung bezüglich der Debatte auf dem AB 4.2. Wichtig: Du bist nicht alleine! Falls du selbst Opfer von häuslicher/sexualisierter Gewalt geworden bist, hole dir unbedingt Hilfe. Auch wenn du Zeug*in von Gewalt geworden bist, kannst du dich bei diesen Stellen melden. In der Schweiz gibt es diverse Angebote dafür: Beratungsstelle Opferhilfe Bern 031 370 30 70 beratungsstelle@ www.opferhilfe-bern.ch opferhilfe-bern.ch 3007 Bern Lantana Opferhilfstelle Bern 031 313 14 00 AppElle 031 533 03 03 Hotline für häusliche Gewalt Kinder- und 147 Jugendberatung Dargebotene Hand 143 ellen/lantanabern/ Polizei Notruf 117 144 Aufgabe 5 Welche Forderungen sind dir sonst noch wichtig? Erstelle dazu einen Hashtag mit deiner Forderung auf AB 4.1. 5. Gleichstellung in der Wissenschaft 5.1. Gender Data Gap 35 min AB 5.1., Papier, Stifte, Internet Was ist der Gender Data Gap und welche Auswirkungen hat er? Lernziele 5.1.: Die Schüler*innen können den Gender Data Gap und wie dieser zustande kommt erklären. die Auswirkungen des Gender Data Gaps aufzeigen und darlegen. Aufgabe 1 In der Tabelle auf AB 5.1. findet ihr mehrere Stichworte zu verschiedenen Interessengebieten. Sobald ihr beide bereit seid, kann es losgehen. Notiert so schnell wie möglich auf jeder Linie eine bekannte Persönlichkeit. Nach 2 Minuten ist die Zeit abgelaufen (Wer hat eine Stimme, phlu). Aufgabe 2 Vergleicht die notierten Namen. Falls ihr jemanden nicht kennt, erklärt euch gegenseitig, um wen es sich handelt. Wie viele Männer und wie viele Frauen habt ihr notiert? Zählt nach und schreibt es unten aufs AB 5.1. Fällt euch etwas auf? (Wer hat eine Stimme, phlu) Aufgabe 3 Weshalb habt ihr mehr weibliche oder männliche Persönlichkeiten genannt? Notiert eure Überlegungen dazu auf AB 5.1. (Wer hat eine Stimme, phlu). Aufgabe 4 Die meisten von euch haben wohl insgesamt mehr Männer als Frauen notiert. Diese „Unsichtbarkeit der Frauen ist ein bekanntes Phänomen in der Welt und hat einen Namen: Gender Data Gap. 1. Schaut euch das Video von Nuovo SRF über den Gender Data Gap aufmerksam an und notiert Stichworte. 2. Fasst anschliessend das Video über den Gender Data Gap auf dem AB 5.1. in 12-14 Sätzen zusammen. Schaut euch dazu das Video allenfalls nochmals an. (Was ist Gender Data Gap, Ergebnisse daraus, Beispiele ungefährliche und gefährliche, Gründe für Gender Data Gap, Lösungsmöglichkeiten) Exper*innenaufgabe 1 Schau dir die Graphik 1 der Universität Zürich und die Graphik 2 des Unesco Institut für Statistik der sogenannten Leaky Pipeline an. Beantworte die Fragen in 2-3 Sätzen auf das AB 5.1. Was ist auf den zwei Graphiken abgebildet und was fällt dir ins Auge? Vermute, weshalb die Leaky Pipeline (undichte Rohrleitung) so heissen könnte? Welchen Zusammenhang hat die Leaky Pipeline mit dem Gender Data Gap? 6. Berufswahl 6.1. «Frauenberuf» vs. «Männerberuf» 35 min Grünes Kartenset mit 8 Karten, AB 6.1., Statistiken, Internet Was sind geschlechtsstereotypische Berufsbilder und welchen Einfluss haben sie auf die Berufswahl? Lernziele 6.1.: Die Schüler*innen können stereotypisierte Berufsbilder erkennen und hinterfragen. den Einfluss der Geschlechtsstereotypen auf die Berufswahl einschätzen. ihre möglicherweise nach Geschlecht geprägten Berufsvorstellungen erweitern. erkennen, dass ihnen entsprechend ihren Ressourcen und Interessen alle Berufe zur Verfügung stehen. Aufgabe 1 Spiel: «Was arbeite ich?»: Spielerin hält die Karte hoch, so dass sie nur die Rückseite mit den Angaben zum Beruf sieht. Spieler steht Spielerin gegenüber und sieht die Vorderseite der Karte (Figur und Name). Spieler muss nun den Beruf von Spielerin mit Ja/Nein-Fragen erraten: «Arbeitest du draussen?», «Arbeitest du mit Maschinen?». Spielerin antwortet mit «Ja», «Nein» oder «Das kann ich so nicht sagen» auf die Fragen, bis Spieler den richtigen Beruf herausgefunden hat (Stereotype Berufsbilder, like2be) Spielt bis jede Person je zwei Berufe herausgefunden hat. Aufgabe 2 Diskussion: Woran habt ihr herausgefunden, welchen Beruf die Figur ausübt? Manchmal werden Berufe als „typisch männlich oder „typisch weiblich wahrgenommen. Wann ist das der Fall und weshalb könnte das so sein? Was ist euch in dem Spiel in dieser Hinsicht aufgefallen (Habt ihr diese Geschlechtsstereotypen beispielsweise unbewusst angewendet)? Was für eine Auswirkung kann diese Einteilung in „Frauenberufe und „Männerberufe für die Berufswahl Jugendlicher haben? Hatte diese Einteilung eine Auswirkung auf deine Berufswahl? Aufgabe 3 Öffne den Link und versuche die Berufe den Personen zuzuordnen. Wie hast du überlegt, um die Menschen einzuteilen? Sind dir dabei Vorurteile oder Stereotypen im Kopf begegnet? Notiere deine Erkenntnisse auf das AB 6.2. Aufgabe 4 Schätzfrage: Wie viele Lehr-Berufe gibt es? Schaut euch die drei Statistiken an. Was wird darauf abgebildet? Diskussion: Wenn es „Männer- und „Frauenberufe gibt, was ist mit den Berufen in der Mitte? Können Jungen Frauenberufe schlechter ausüben resp. können Mädchen Männerberufe schlechter ausüben? Machen sich Mädchen und Jungen unterschiedliche Gedanken bei der Berufswahl? Aufgabe 5 Beim Thema Beruf geht es auch darum, wie man die Arbeit und das Privatleben vereinbaren kann (z.B. wenn man Kinder hat). 1. Füllt die Tabelle auf dem AB 6.2. alleine aus. Achtung: Es gibt natürlich auch andere Lebensentwürfe als eine Familie zu gründen und es gibt gleichgeschlechtliche Paare. Kreuzt das an, was ihr könnt – die restlichen Fragen überspringt ihr. 2. Wenn alle damit fertig sind, vergleicht eure Antworten. 3. Was schliesst ihr aus euren Antworten? Gibt es Gemeinsamkeiten/Unterschiede? Sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern grösser als die Unterschiede innerhalb der Geschlechter? Expert*innenaufgabe 1 Ein*e Freund*in von dir möchte einen „untypischen Beruf ausüben. Sie fragt dich um Rat und nach deiner Meinung. Schreibe ihr*ihm einen kurzen Brief, in welchem du folgende Sachen ansprechen sollst: Deine Stellung zur Ausübung von untypischen Berufen Besteht die Möglichkeit, dass du auch einen untypischen Beruf ausüben wirst Herausforderungen in einem geschlechtsuntypischen Beruf Vorteile in einem geschlechtsuntypischen Beruf 6. Berufswahl 6.2. Klischeefreie Berufswahl am Beispiel von MINT-Berufen 25 min AB 6.2., Stifte, Text 1, Graphik 1 Was sind MINT-Berufe und weshalb ist der uneingeschränkte, klischeefreie Zugang zu allen Berufen wichtig? Lernziele 6.2.: Die Schüler*innen können MINT-Berufe erklären und das Geschlechterverhältnis darin deuten. verdeutlichen, weshalb der uneingeschränkte Zugang zu MINT-Berufen für alle Geschlechter wichtig ist. Aufgabe 1 Lies den Text 1 über Lara. Lara möchte in Zukunft in einem sogenannten MINT-Beruf arbeiten. Suche im Internet, wofür MINT steht, schreibe deine eigene Definition auf das AB 6.1. und notiere mind. einen typischen MINT-Beruf. Aufgabe 2 Führt das Gespräch zwischen Lara und Paul weiter. Was würdet ihr an ihrer oder seiner Stelle sagen? Aufgabe 3 Schreibe die Berufe deiner Grosseltern, Eltern und drei deiner Berufswünsche in die Tabelle auf dem AB 6.1. 1. Streiche nun alle MINT-Berufe blau an. 2. Alle Berufe deiner (Gross-)eltern, welche für dich in Frage kommen, grün. Vergleiche deine Resultate mit der Graphik 1 (MINT-Berufsfelder roter Rahmen). Was fällt dir auf? Widerspiegelt deine persönliche Tabelle die Graphik 1? Notiere deine Erkenntnisse in zwei Sätzen. Aufgabe 4 Vergleicht nun eure Tabellen miteinander. Haben eure Tabellen Gemeinsamkeiten? Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den Berufswünschen? Weshalb denkt ihr, ist der Frauenanteil in MINT-Berufen so gering? Fasst eure Diskussion in zwei Sätzen zusammen. Aufgabe 5 1. Weshalb ist es wichtig, dass alle Menschen ihren Beruf frei von gesellschaftlichen Klischees und Zwängen wählen dürfen? Sucht Gründe dafür und notiert mind. zwei auf das AB 6.2. 2. Wie können wir das erreichen? Notiert zwei Ideen, wie ein uneingeschränkter Zugang für alle Geschlechter zu allen Berufen möglich ist. 7. Abschlussstation 7.1. Abschlussstation 30 min A4-Papier, Stifte Ist die Gleichstellung der Geschlechter erreicht? Lernziele 7.1.: Die Schüler*innen können Stellung zum Thema Frauen*bewegung und Geschlechtergleichstellung nehmen. Unterschiedliche Perspektiven hinterfragen, untersuchen und beurteilen. Wähle eine der folgenden Aufgaben aus: Aufgabe 1 (Umfang: 300-500 Wörter) 1. Wähle eine*n Politiker*in aus deinem Kanton aus (z.B. Nationalrät*in, Regierungsrät*in, Grossrät*in, etc.). 2. Schreibe dieser*m Politiker*in einen Brief, in welchem du über die Geschlechtergleichstellung und Frauen*bewegung im Jahre 2022 in der Schweiz schreibst. Nenne Fortschritte und Errungenschaften, schreibe aber auch über anhaltende Missstände und Potenzial für Verbesserungen. Stelle Fragen bezüglich der Gleichstellung und teile mit, was du von der Politik erwartest und was du dir wünschst bezüglich der Gleichstellung. Beziehe dich auf deine Erkenntnisse von den Stationen und binde deine persönliche Meinung ein. 3. Wenn du fertig bist: Kreuze an, ob der Brief wirklich an diese*n Politiker*in versendet werden darf. Vielleicht bekommst du ja Antwort auf deine Fragen. Aufgabe 2 (Umfang: 300-500 Wörter) „Die Frau, das ewige Opfer lautet ein Kommentar von der Katharina Fontana in der NZZ am 11.1.2022. Im Artikel über die AHV-Reform21 (Alters- und Hinterbliebenenversicherung) schreibt die Autorin, dass die Frau als Diskriminierungsopfer dargestellt und vom Staat „umsorgt, gehegt und gepflegt werde, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre. Die Diskriminierung der Frau sei zum „Trendthema, ja sogar zum „Geschäftsmodell geworden, welche Frauen in die Opferrolle drängt. 1. Lies den Artikel aufmerksam durch. Schreibe nun eine Stellungnahme zum Artikel und reagiere auf die genannten Punkte. Beziehe dich auf deine Erkenntnisse von den Stationen und binde deine persönliche Meinung ein. 1. Schweizer Frauen*bewegung AB 1.1.1. Zeitrahl der Schweizer Frauen*bewegung 40 min AB 1.1.1/AB 1.1.2, Stift, Lineal, Leim, Steckbrief, Internet Wie verlief die Frauen*bewegung in der Schweiz und wer setzte sich dafür ein? Aufgabe 3: Vergleicht eure Zeitstrahle mit dem internationalen Zeitstrahl 2. Was fällt euch auf? Notiert eure Erkenntnisse unter dem Zeitstrahl 1 in zwei Sätzen. Steckbrief über Foto Vorname: Name: Lebzeiten: Heimatkanton: Familie: Studium: Beruf/Politisches Amt:. Das fordere ich: . . . Das ist besonders an mir: . Das macht mich glücklich: Das mag ich nicht: 1 berühmtes Zitat: . Unterschrift: 1. Schweizer Frauen*bewegung AB 1.1.2. Geschichte der Schweizer Frauen* 40 min AB 1.1.1/AB 1.1.2, Stift, Lineal, Leim, Steckbrief, Internet Wie verlief die Frauen*bewegung in der Schweiz und wer setzte sich dafür ein? Expert*innenaufgabe 1 «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich.» Dieser Artikel steht seit 1848 in unserer Bundesverfassung. Und doch sagte die Männer erst über hundert Jahre später im Jahr 1971 Ja zur Einführung des Frauenstimm- und wahlrechtes. Schau dir nun das Bild an. 1. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Plakat liest? Nimm Stellung zu dieser Aussage. 2. Recherchiere im Internet nach möglichen Gründen, weshalb die Frauen so lange auf gleiche Rechte warten mussten. Fasse deine Erkenntnisse stichwortartig auf das AB 1.1. zusammen. 1. 2. 1. Schweizer Frauen*bewegung AB 1.2. Abstimmungskampf Frauenstimm- und wahlrecht 35 min Karte 1,2,3, Flyer 1 und 2, AB 1.2., Rollenkarten, Internet Was waren die Argumente der Gegner*innen und Befürworter*innen des Frauenstimmrechts und wie sahen die Abstimmungsresultate aus? Aufgabe 1 Lest die Flyer 1 und 2, welche im Kanton Luzern für oder gegen das Frauenstimmrecht eingesetzt wurden, aufmerksam durch. Arbeitet jeweils zwei Argumente für oder gegen das Frauenstimm- und wahlrecht heraus und notiert sie in die Kolonnen auf dem AB 1.2. – Aufgabe 3 1. Vergleicht und diskutiert die Abstimmungsresultate aus dem Jahre 1959 (1. Abstimmung) und 1971 (2. Abstimmung) (Karte 1 und 2). 2. Schaut euch anschliessend die Karte 3 zu den Abstimmungsresultaten 2020 über den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub an. In dieser Abstimmung ging es um die Gleichstellung der Männer und ihr Recht auf Vaterschaftszeit. Was ist besonders auffällig an den drei Karten? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede seht ihr und wie kommen diese zustande? Notiert eure Gedanken auf das AB 1.2. 1. Schweizer Frauen*bewegung AB 1.4. Gleichstellung und Politik 25 min AB 1.3., Stifte, Internet Welche Arten politischer Mitwirkung gibt es und wie sieht das Geschlechterverhältnis in der Politik aus? 1. Der Weg zum Frauenstimmrecht in Luzern und der Schweiz Arbeitsblatt 2 Aufgabe 1 Soll ich meine Bestimmt hast du dir in gewissen Alltagsdiskussionen auch schon überBestimmt hast du in gewissen Alltagsdiskussionen auch schon deine Meinung legt, ob du zu einem Thema deine Meinung äussern, also deine Stimme Stimme erheben? geäussert oder dir überlegt, deine Stimme zu erheben. erheben, sollst oder nicht. Wo ist das Interesse, deine Meinung zu hören Trage deine Einschätzung in der Skala ein vonEinschätzung 1 (Meine Stimme findet bis am grössten? Trage deine in der Skala einkein von 1Gehör) (da werde 5 (Meine Stimme zählt)ich ein. kaum gehört) bis 5 (deine Meinung interessiert). Meine Stimme findet kein Gehör Meine Stimme zählt! Schule 1 5 Freunde 1 5 Familie 1 5 Freizeit, z.B. Sportverein 1 5 Bekannte auf Social Media 1 5 Aufgabe 3 Seit Ende des 19. Jahrhunderts hatten sich Frauen und auch Männer für die Gleichberechtigung eingesetzt. Sie erhoben ihre Stimme und forderten gleiche Rechte und politische Mitbestimmung. Es gibt verschiedene Wege, politisch aktiv zu werden und seine Meinung kund zu tun. Seit über 150 Jahren setzen sich Menschen für die Gleichstellung der Geschlechter ein. Aufgabe 1: Betrachte die Abbildungen 3 bis 7. Schaut euch die Bilder 3-7 auf dem AB 1.3. an. Mit welchen Mitteln wollen sie sich Gehör verschaffen? Schreibe den Buchstaben der politischen Mitteln zur passenden Abbildungen. Diskutiert zu zweit und haltet eure Erkenntnisse stichwortartig fest: Was haltet ihr von den unterschiedlichen Formen? Abb. 3: Frauen und Männer verschiedener Kantone reichen die Petition zum Frauenstimmrecht mit rund einer Viertelmillion Unterschriften ein, Bern 1929 (Fotograf unbekannt, Gosteli-Stiftung, AGoF n.k. Frauenstimmrechtspetition 1929). a) Ein politisches Amt übernehmen b) Über etwas abstimmen c) Demonstrieren gehen d) Eine Petition unterschreiben (Petition: schrift. Anliegen/Forderung/Bitte, welches an eine zuständige Behörde übermittelt wird und von der Bevölkerung unterschrieben werden kann) e) In Plakaten oder Flyern seine Meinung kundtun f) Beitritt einer Partei g) Social Media Bewegung (Wer hat eine Stimme, phlu) Abb. 1 Die Petition zum Frauenstimmrecht wird 1929 von Frauen und Männer aus unterschiedlichen Kantonen mit rund 1/4 Million Unterschriften eingereicht, Bildarchiv Winterthur Abb. 2 Josi Meier wird erste Ständeratspräsidentin 1991/92, srf.ch Abb. 3 Jungparteien, vierseitig.ch Abb. 4 #metoo-Bewegung, aucegypt.eu Abb. 5 Nationaler Frauen*streik 2019, tagblatt.ch 1. Der Weg zum Frauenstimmrecht in Luzern und der Schweiz Arbeitsblatt 2 Abb. 6 Abstimmungsplakat Basel 1945 Museum für Gestaltung Abb. 7 Abstimmungszettel der nationalen Abstimmung zum Frauenstimmund wahlrecht 1971, Bundeskanzlei Abb. 6: Abstimmungszettel der nationalen Abstimmung zum Frauenstimm- und Wahlrecht, 07.02.1971 (Bundeskanzlei, Politische Rechte, Aufgabe 2: Mit welchen Mitteln wollen sich die Frauen und Männer hier Gehör verschaffen? Ordne die folgenden Formen, politisch aktiv zu werden, den Bildern zu. Abb. 7: Die Luzerner Ständerätin Josi Meier (1926–2006) präsidiert 1991/92 als erste Frau den Ständerat, Bern 1992 (Keystone, Karl-Heinz Hug). Aufgabe 3: Hast du dich selbst schon in der einen oder anderen Art engagiert? Tauscht euch zu zweit aus. Aufgabe 4 Mit der Volljährigkeit können sich Schweizer*innen auch für ein politisches Amt zur Verfügung stellen. Bei einer Wahl gehören sie danach einem politischen Gremium an. Das Schweizer System teilt die Entscheidungsebenen in drei Gewalten auf: die Legislative (Gesetzgebend – z.B. Parlament), die Exekutive (Gesetzausführend – z.B. Bundesrat) und die Judikative (rechtssprechende Gewalt – z.B. Kantonsgericht). Wie sieht das Geschlechterverhältnis in der Legislative (National- und Ständerat, Grosser Rat, Gemeindeparlament) und der Exekutive (Bundesrat, Regierungsrat oder Gemeinderat) auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene aus? Recherchiere im Internet (Suche nach: Frauenanteil im oder Geschlechterverhältnis) und trage die Anzahl Frauen und Männer in politischen Gremien im AB 1.3. ein. Anzahl Frauen Anzahl Männer Nationalrat Ständerat Bundesrat Frauenanteil Prozent 42% 26% 3 4 Grosser Rat Regierungsrat Gemeindeparlament Gemeinderat Was hat das Geschlechterverhältnis für Auswirkungen auf unsere Gesetze und Leben? Welche Möglichkeiten gibt es, um dieses Verhältnis zu ändern? Äussere deine Vermutungen auf das AB 1.4. 2. Arbeitswelt AB 2.1. Lohnunterschiede 20 min Was sind Lohnunterschiede, welche gibt es und welche Auswirkungen haben sie? Aufgabe 1 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit wurde schon vor über 100 Jahren von Frauenrechtler*innen gefordert. Trotz Gleichstellungsartikel gibt es immer noch Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern. Schaut euch die Grafik 1 aus dem Jahr 2018 zu den Lohnunterschieden an und lest das Kästchen zum Gender Pay Gap. Diskutiert zu zweit: Was fällt euch auf? Worüber seid ihr erstaunt? Erklärt euch gegenseitig, was ein erklärter und unerklärter Unterschied ist. Macht ein Beispiel dazu. Notiert eure Erkenntnisse in zwei Sätzen auf das AB 2.1. Aufgabe 2 1. Lies den Text 1 sorgfältig durch und markiere wichtige Stellen. 2. Recherchiere weitere Unterschiede zwischen sozialen bzw. technischen Berufen und wie viel man in diesen Berufen durchschnittlich verdient auf Schaue dabei auf der Tabelle 1, dass du Berufe nimmst, welche auf demselben Ausbildungsniveau sind. 3. Häufig hört man, dass die Lohnlücke vor allem daher kommt, dass Frauen die falschen Berufe wählen. Diskutiere die Frage, ob Frauen selbst schuld sind, wenn sie durchschnittlich weniger verdienen als Männer (Hans-BöcklerStiftung). Begründet eure Meinungen auf dem AB 2.1. Expert*innenaufgabe 1 Stellt euch vor, ein Mann und eine Frau treten per 01.01.2021 eine neue Stelle in einer grossen Firma an. Die Frau und der Mann leisten genau dieselbe Arbeit. Der Mann verdient dabei 6500.-, die Frau für die gleiche Arbeit nur 5720.- (12% weniger Lohn – nur der unerklärte Unterschied wird berücksichtigt). Bis zu welchem Datum (Gender Pay Day) arbeitet die Frau theoretisch ohne Lohn? 2. Arbeitswelt AB 2.2. Unbezahlte Arbeit – Care-Arbeit 25 min Arbeitsblatt 2.2., Internet Was ist unbezahlte Arbeit/Care Arbeit und welchen Stand hat sie in unserem Wirtschaftssystem? Aufgabe 1 Denk an deine Kindheit zurück/Jugend und beantworte folgende Fragen(ankreuzen): Vater Mutter Jmd. anderes Wer kocht meistens, bei euch zu Hause? Wer wäscht deine Kleidung? Wer legt deine Kleidung zusammen und versorgt sie? Wer putzt den Grossteil euers Hauses/eurer Wohnung? Wer brachte dich zur Spielgruppe/zum Kindergarten/zur Schule? Wer brachte dich mehrheitlich ins Bett? Wer war mehrheitlich zu Hause als du klein warst? Wer von deinen Eltern arbeitete, als du klein warst? Aufgabe 2 Vergleiche deine Antworten mit den Antworten deiner*s Partner*in. Welche Gemeinsamkeiten/Unterschiede gibt es? Was fällt euch auf? Fasst eure Erkenntnisse in zwei Sätzen zusammen und schreibt sie aufs AB 2.2. Aufgabe 4 Schaut euch nun das Video „Wirtschaft ist Care an: Schreibt dazu jeweils 1-2 Sätze aufs AB 2.2. Inwiefern hat sich euer Verständnis für die obigen Begriffe (Arbeit, Care Arbeit, Wirtschaft) verändert? Was bedeutet für euch Wirtschaft ist Care? Welche Probleme gibt es bezüglich unbezahlter Arbeit im heutigen Wirtschaftssystem? Aufgabe 5 Kreuze zum Schluss an: Würdest du die letzte Frage des Fragebogens oben nun anders ankreuzen? Ja Expert*innenaufgabe 1 Erstelle ein Concept-Map zu den Begriffen Wirtschaft/Care-Arbeit/Arbeit und unserem Wirtschaftssystem. Nein 3. Vielfalt der Geschlechter AB 3.1. Stereotypisierte Geschlechtermerkmale 35 min Couvert 3.1., Stoppuhr, Stifte, AB 3.1., 3 A4-Blätter, Box 3. Welche stereotypischen Geschlechtermerkmale schweben in unseren Köpfen und welche in der Gesellschaft? Aufgabe 2 1. Kreuze auf dem AB 3.1. an, was für dich stimmt (wähle zuerst nur zwischen den ersten drei Feldern weiblich/männlich/neutral aus.) 2. Kreuze jetzt auch an, was auf dich zutrifft (Ich). Eigenschaft/Tätigkeit/Aussehen aggressiv cool heikel emotional zickig sportlich hübsch stark laut modebewusst Lange Haare Kurze Haare schminken Nägel lackieren Röcke tragen Hosen tragen Kinder hüten gamen basteln Fahrrad reparieren gärtnern Bohrmaschine bedienen kochen putzen Müll rausbringen Wäsche waschen Zeitung lesen rasenmähen stricken Shoppen gehen Rechnungen zahlen Fussball schauen Eher „männlich Eher „weiblich neutral Ich Aufgabe 4 Vergleicht die Blätter aus der Aufgabe 3 mit der Kategorie Ich auf dem AB 3.1. Gibt es Zuordnungen, welche sowohl zu euch, aber auch einem anderen Geschlecht zutreffen oder welche auf euch zutreffen, wohl nicht auf euer Geschlecht? (z.B. Lisa ordnet die Eigenschaft stark zu «eher männlich» ein, hat es aber auch bei «Ich» angekreuzt) Was löst das bei euch aus? Welche Geschlechterstereotypen gibt es sonst in der Gesellschaft noch? Hat es Folgen und Auswirkungen für euch, wenn die Gesellschaft Eigenschaften/Tätigkeiten/Aussehen einem Geschlecht zuordnen? Diskutiert und notiert eure Erkenntnisse in 2-3 Sätze aufs AB 3.1. 3. Vielfalt der Geschlechter AB 3.3. Geschlechterbilder im Hip Hop 30 min AB 3.3, Internet, evtl. Kopfhörer Wie zeigen sich Geschlechterbilder und Sexismus im Hip Hop? Aufgabe 2 und 3 Schaut euch das Video von Farid Bang an und beantworte die Fragen in der Spalte 1 auf dem AB 3.3. Farid Bang – Killa Schaut das/die Video(s) von Tapete, Cryying Wölf, Sookee und/oder R3-SQWAD. Beantwortet anschliessend die Fragen auf das AB 3.3. in der Spalte 2. Tapete, Crying Wölf, Sookee – Brustmuskeldance R3-SQWAD – Hörbar Sichtbar Spalte 1 (Killa) Gibt es im Video Frauen? Spalte 2 (Brustmuskeldance/Hörbar Sichtbar) Gibt es im Video Frauen? Was machen die Frauen im Video? Was machen die Männer? Was machen die Frauen im Video? Was machen die Männer? Was haben Frauen an? Was tragen Männer? Was haben Frauen an? Was tragen Männer? Wie werden Männer/Frauen dargestellt? Wie werden Männer/Frauen dargestellt? Welche Zuschreibungen werden dabei gemacht? Könnt ihr Eigenschaften/ Äußerlichkeiten erkennen, die angeblich typisch männlich oder weiblich sind? Welche Zuschreibungen werden dabei gemacht? Könnt ihr Eigenschaften/ Äußerlichkeiten erkennen, die angeblich typisch männlich oder weiblich sind? Aufgabe 5 Notiere deine Erkenntnis auf das AB 3.3. 3. Vielfalt der Geschlechter 3.4. Intersektionalität 40 min AB 3.4., Stifte, Rollenkärtchen Wie fühlt sich Intersektionalität an? Aufgabe 6 Notiere zum Abschluss deine Gedanken zu den drei Fragen auf das AB 3.4. Wie hätte die Aufstellung ausgesehen, wenn ihr als reale Personen auf die Aussagen geantwortet hättet? Wo hättet ihr persönlich gestanden? Welchen Beitrag kann ich für eine gerechtere Gesellschaft leisten? METHODE 5 Arbeitsblatt «Wie im richtigen Leben» Bildungsmaterialien der Rosa-Luxemburg-Stiftung Personenbogen Wer bin ich? Name: Wohnort: Geschlecht: Kinder: Partnerschaft: Netto-Einkünfte: Wie lebe ich? Wie sieht mein Alltag aus Alter: Religion: sexuelle Orientierung: alleinerziehend /gemeinsam erziehend: Beruf: 4. Genderspezifische Gewalt AB 4.1. #metoo 25 min AB 4.2., Leuchtstifte Was ist die #metoo-Bewegung, weshalb wurde sie gestartet und welches Ziel hat sie und wie wird sie wahrgenommen? Aufgabe 1 Was weisst du über die #metoo-Bewegung? Notiere dein Vorwissen auf das AB 4.1. Aufgabe 4 Sexuelle Diskriminierung und Gewalt ist nach wie vor Thema in unserer Gesellschaft, sei es in Form von unangebrachten Kommentaren, ungewollten Berührungen oder häuslicher oder sexualisierter Gewalt. Denke an Alltagsbeispiele und an die Informationen zur #metoo-Bewegung und nimm Stellung zu deiner Haltung bezüglich der Debatte auf dem AB 4.2. Wichtig: Du bist nicht alleine! Falls du selbst Opfer von häuslicher/sexualisierter Gewalt geworden bist, hole dir unbedingt Hilfe. Auch wenn du Zeug*in von Gewalt geworden bist, kannst du dich bei diesen Stellen melden. In der Schweiz gibt es diverse Angebote dafür: Beratungsstelle Opferhilfe Bern 031 370 30 70 beratungsstelle@ www.opferhilfe-bern.ch opferhilfe-bern.ch 3007 Bern Lantana Opferhilfstelle Bern 031 313 14 00 ellen/lantanabern/ AppElle Hotline für häusliche Gewalt Kinder- und Jugendberatung Dargebotene Hand Polizei Notruf 031 533 03 03 147 143 117 144 Aufgabe 5 Welche Forderungen sind dir sonst noch wichtig? Erstelle einen Hashtag dazu auf AB 4.1. #_ 5. Gleichstellung in der Wissenschaft AB 5.1. Data Gender Gap 35 min AB 5.1., Papier, Stifte, Internet Arbeitsblatt 1 Was ist der Gender Data Gap und welche Auswirkungen hat er? 4. In Erinnerung bleiben oder vergessen? Aufgabe 1 Promi-Memory Aufgabe 1: Bildet Zweiergruppen. In der Tabelle unten findet ihr mehrere zu Stichworte verschiedenen Interessensgebieten. Sobald ihr In der Tabelle auf AB 5.1. findetStichworte ihr mehrere zu verschiedenen beide bereit seid, kann es losgehen. Notiert so schnell wie möglich Interessengebieten. Sobald ihr beide bereit seid, kann es losgehen. so schnell auf jeder Linie eine bekannte Persönlichkeit. NachNotiert 2 Minuten ist die Zeit wie möglich auf jeder Linie eine bekannte Persönlichkeit. Nach 2 Minuten ist die Zeit abgelaufen. abgelaufen (Wer hat eine Stimme, phlu). Tennis Musik Fussball Politik Literatur Wissenschaft Geschichte Kunst Aufgabe 2: Vergleicht die notierten Aufgabe 2 ihr jemanden nicht kennt, erklärt Namen. Falls euch gegenseitig, um wen es sich handelt. Aufgabe 4: Weshalb habt ihr mehr weibliche oder männliche Persönlichkeiten genannt? Notiert eure Überlegungen dazu. Vergleicht die notierten Namen. Falls ihr jemanden nicht kennt, erklärt euch gegenseitig, um wen es sich handelt. Aufgabe 3: Wie viele Männer und wie viele Frauen habt ihr notiert? Zählt nach. Fällt euch etwas auf? Wie viele Männer und wie viele Frauen habt ihr notiert? Zählt nach und schreibt es unten aufs AB 5.1. Fällt euch etwas auf? (Wer hat eine Stimme, phlu) Anzahl Frauen: Anzahl Männer: Aufgabe 3 Weshalb habt ihr mehr weibliche oder männliche Persönlichkeiten genannt? Notiert eure Überlegungen dazu auf AB 5.1. (Wer hat eine Stimme, phlu). Aufgabe 4 Die meisten von euch haben wohl insgesamt mehr Männer als Frauen notiert. Diese „Unsichtbarkeit der Frauen ist ein bekanntes Phänomen in der Welt und hat einen Namen: Gender Data Gap. 1. Schaut euch das Video von Nuovo SRF über den Gender Data Gap aufmerksam an. 2. Fasst anschliessend das Video über den Gender Data Gap auf dem AB 5.1. in 12-14 Sätzen zusammen. (Was ist Gender Data Gap, Ergebnisse daraus, Beispiele ungefährliche und gefährliche, Gründe für Gender Data Gap, Lösungsmöglichkeiten) Exper*innenaufgabe 1 Schau dir die Graphik 1 der Universität Zürich und die Graphik 2 des Unesco Istitut für Statistik der sogenannten Leaky Pipeline an. Beantworte die Fragen in 2-3 Sätzen auf das AB 5.1. Was ist auf den zwei Graphiken abgebildet und was fällt dir ins Auge?