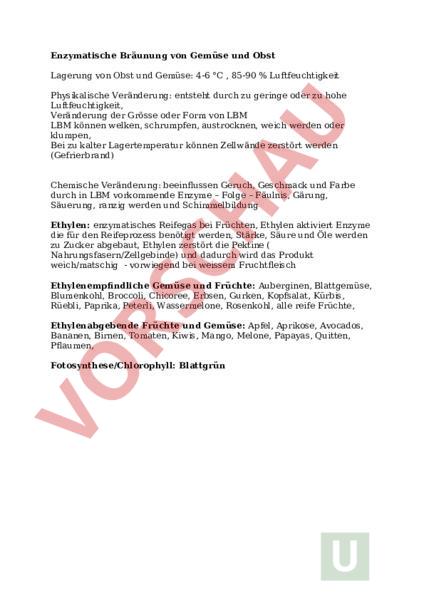Arbeitsblatt: Obst und Gemüse
Material-Details
Anbauarten und Enzymatische Bräunung
Wirtschaft, Arbeit, Haushalt
Ernährungslehre
8. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
213358
100
0
10.09.2025
Autor/in
Rachid Ouali
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Enzymatische Bräunung von Gemüse und Obst Lagerung von Obst und Gemüse: 4-6 C 85-90 Luftfeuchtigkeit Physikalische Veränderung: entsteht durch zu geringe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit, Veränderung der Grösse oder Form von LBM LBM können welken, schrumpfen, austrocknen, weich werden oder klumpen, Bei zu kalter Lagertemperatur können Zellwände zerstört werden (Gefrierbrand) Chemische Veränderung: beeinflussen Geruch, Geschmack und Farbe durch in LBM vorkommende Enzyme – Folge – Fäulnis, Gärung, Säuerung, ranzig werden und Schimmelbildung Ethylen: enzymatisches Reifegas bei Früchten, Ethylen aktiviert Enzyme die für den Reifeprozess benötigt werden, Stärke, Säure und Öle werden zu Zucker abgebaut, Ethylen zerstört die Pektine Nahrungsfasern/Zellgebinde) und dadurch wird das Produkt weich/matschig vorwiegend bei weissem Fruchtfleisch Ethylenempfindliche Gemüse und Früchte: Auberginen, Blattgemüse, Blumenkohl, Broccoli, Chicoree, Erbsen, Gurken, Kopfsalat, Kürbis, Rüebli, Paprika, Peterli, Wassermelone, Rosenkohl, alle reife Früchte, Ethylenabgebende Früchte und Gemüse: Apfel, Aprikose, Avocados, Bananen, Birnen, Tomaten, Kiwis, Mango, Melone, Papayas, Quitten, Pflaumen, Fotosynthese/Chlorophyll: Blattgrün Die Chlorophyll-A Moleküle reflektieren Licht in einem blau-grünem Farbspektrum, wogegen Chlorophyll-B Licht eher in gelb-grünen Farben reflektiert. Mikrobielle Veränderung: treten durch Mikroorganismen auf, die sich überall (in/auf LBM) befinden, brauchen immer Licht, Sauerstoff, Wärme, Zeit und Wasser Nicht immer riecht oder sieht man, ob ein LBM verdorben ist ---Salmonellen Konventioneller Anbau: Hierbei handelt es sich um die ursprüngliche Form des Gemüseanbaus, das ökonomische Ziel wurde dem ökologischem vorgezogen, mit wenig Arbeitsaufwand in kurzer Zeit unabhängig und möglichst ohne Verluste einen grossen Ertrag/Ernte zu erwirtschaften, Wie werden die Ziele erreicht: in Monokulturen Einsatz von chemischen Hilfsmitteln wie Dünger und Pflanzenschutz vermehrter Anbau von Feingemüse in Gewächshäusern verfrühen und verspäten der Kulturen mit Folie oder Flies Diese Methode wird nur noch vereinzelt praktiziert. Hors-sol Produktion: Die Hors-sol Technik wird vor allem in Gewächshäusern angewandt, bei den Hauptkulturen (Tomaten, Gurken, Peperoni, Erdbeeren, Schnittsalat) ist eine Langzeitkultur ausserhalb des Bodens erlaubt. Die Pflanzen wurzeln nicht in Erde, sondern in einem Substrat wie z.B. Kokoswolle oder in Wasser (Hydrokulturen). Nährlösung wird automatisch, meist Computer gesteuert bei jeder Pflanze injiziert, Befruchtung der Blüten geschieht mittels Vibrierstab oder durch in Glashäusern gehaltene Hummeln, Vorteile: Kulturzeit reduziert sich um die Hälfte, Pflanzenschutzmittel werden fast keine oder nur sehr wenige eingesetzt, keine Ernteverzögerung durch Witterung Bio Produktion: Nachhaltige Bewirtschaftung in einem geschlossenen Kreislauf, begrenzter Zukauf von Tierfutter und biologischem Dünger ist erlaubt, kein Einsatz von chemischen Hilfsmitteln, In der Schweiz wird hauptsächlich nach den Richtlinien der Vereinigung biologischer Landbauorganisation zertifiziert. Für die Kontrolle und Zertifizierung ist die Firma Bio Inspekta zuständig. Ist ähnlich wie die Intregrierte Produktion, wobei hier auch chemische und synthetische Pflanzenschutz und Dünger, genetisch veränderte Organismen vollumfänglich verzichtet werden muss. IP Integrierte Produktion IP-SUISSE setzt sich für eine ökologisch und ökonomisch ausgewogene Schweizer Landwirtschaft ein. Oberstes Ziel ist die Produktion von gesunden und qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln, die zu fairen Preisen in den Handel gelangen. IP-SUISSE-Bauernbetriebe sollen von ihrer Arbeit leben können und für ihre vielfältigen Anstrengungen zum Schutz der Umwelt und zur Förderung der Biodiversität Artenvielfalt) belohnt werden. Die enzymatische Bräunung: Die Braunfärbung aufgeschnittener Äpfel ist auf die Aktivität eines Enzyms (der Polyphenole) zurückzuführen. Man nennt den Prozess deswegen auch enzymatische Bräunung. Durch das Aufschneiden oder eine sonstige Beschädigung des Apfels wird das Enzym freigesetzt und kommt mit im Apfel enthaltenen sekundären Pflanzenstoffen, den Polyphenolen, in Berührung. Es folgt eine Kette chemischer Reaktionen, bei denen braungefärbte Verbindungen (Melanine) entstehen. Diese Verfärbung ist nicht schädlich, sieht jedoch unappetitlich aus und kann den Geschmack und den Nährwert geringfügig verändern.Die enzymatische Bräunung lässt sich auf verschiedene Weise verhindern. Leicht im Haushalt anzuwenden ist das Beträufeln der Schnittfläche mit Zitronensaft. Zum einen senkt die Zitronensäure den pH-Wert, wodurch die Aktivität des Enzyms vermindert wird. Zusätzlich entzieht es dem Enzym Kupfer, das für die Reaktion benötigt wird. Zum anderen wirkt das in Zitronen enthaltene Vitamin als Antioxidans, d. h. es fängt den für die Reaktionen erforderlichen Sauerstoff ab und hemmt damit die Bräunung. Durch das Blanchieren oder anderweitiges Erhitzen der Äpfel wird das Enzym weitgehend inaktiviert und das Obst bleibt hell.Warum die Bräunungsreaktion in verschiedenen Apfelsorten unterschiedlich schnell abläuft, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es spielt sowohl der Gehalt an dem Enzym als auch an Polyphenolen eine Rolle. Ebenso ist die in den Äpfeln enthaltene Menge an Vitamin oder anderen Antioxidantien sowie an natürlichen Säuren, die den pH-Wert beeinflussen, von Bedeutung. Enzyme Polyphenol -Geschmack -Geruch -Farbe Sauerst off Melanin Stoppen durch: senken des pH Wertes, Sauerstoffentzug, Blanchieren.