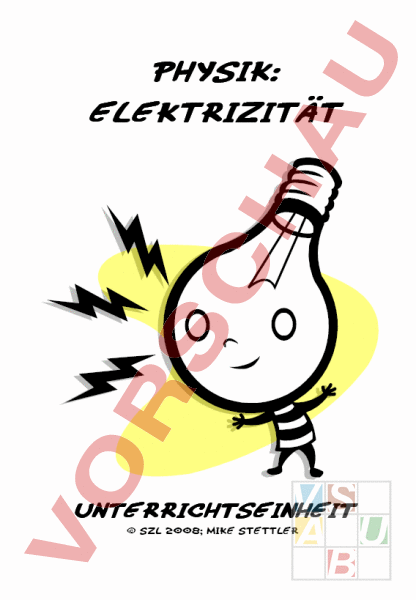Arbeitsblatt: Manuskript Elektrizität 1
Material-Details
Manuskript zur Elektrizitätslehre 1: Elektrische Ladung, Spannung, Stromstärke, Widerstand. Basiert auf Urknall 7. Skript im Word-Format kann bei mir angefordert werden.
Physik
Elektrizität / Magnetismus
7. Schuljahr
43 Seiten
Statistik
21398
3179
317
18.06.2008
Autor/in
iMike (Spitzname)
Bubenbergstrasse 15
3700 Spiez
3700 Spiez
079 356 09 18
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
i e rii n erric einei ie e er Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre Inhaltsverzeichnis 1. LERNZIELE 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. ARBEITSPLAN 5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. DEFINITION 27 ANDRÉ-MARIE AMPÈRE . 29 MESSEN VON SPANNUNG UND STROMSTÄRKE 30 ZUSAMMENHANG VON SPANNUNG UND STROMSTÄRKE . 32 DER ELEKTRISCHE SCHALTPLAN . 33 BERÜHMTE WISSENSCHAFTLER . 34 SERIE- UND PARALLELSCHALTUNG . 37 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. THEORIE13 DIE SPANNUNGSQUELLE 14 DAS VOLTMETER.15 VERSUCHE UND PROTOKOLLE .17 GALVANISCHES ELEMENT . 25 STROMSTÄRKE (AMPERE) . 27 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. THEORIE7 VERSUCHE UND PROTOKOLLE .9 AUSWERTUNG 11 SPANNUNG (VOLT). 13 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. ELEKTRISCHE LADUNG5 SPANNUNG (VOLT) .5 STROMSTÄRKE (AMPERE).5 SERIE- UND PARALLELSCHALTUNG 6 ELEKTRISCHER WIDERSTAND 6 ELEKTRISCHE LADUNG 7 3.1. 3.2. 3.3. 4. ELEKTRISCHE LADUNG3 SPANNUNG (VOLT) .3 STROMSTÄRKE (AMPÈRE).3 SERIE- UND PARALLELSCHALTUNG 4 ELEKTRISCHER WIDERSTAND 4 BEGRIFFE .4 DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN . 37 VERSUCH 35. 38 WIE BRINGEN WIR DIE LAMPEN ZUM LEUCHTEN? 39 ZUSAMMENFASSUNG 40 DER ELEKTRISCHE WIDERSTAND . 41 7.1. 7.2. 7.3. DEFINITION UND EINHEIT .41 DAS STROMKREIS-TRIO 41 BERECHNUNGSAUFGABEN 43 Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 2 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 1. Lernziele 1.1. Elektrische Ladung Du erkennst, dass geheimnisvolle Erscheinungen, die man beim Kämmen, bei Kleiderwechseln oder auch an der Autotür erleben kann, alle die gleiche Ursache haben Elektrizität Du erlebst die geheimnisvollen Kräfte, die von einem geriebenen Kunststoffstab ausgehen können. Du erzeugst auf Kunststoffstäben Elektronenüberschuss oder Elektronenmangel und merkst, was dadurch bewirkt werden kann. Du stellst fest, ob gleichartig geladene Körper die gleiche Wirkung aufeinander ausüben, wie Körper mit verschiedener Ladung. Du baust ein Gerät, mit welchem du elektrische Ladung nachweisen kannst. Du erkennst, dass elektrische Spannung durch Ladungstrennung entsteht. 1.2. Spannung (Volt) Du lernst mit einem Spannungsmesser umzugehen. Du stellst eine einfache, elektrische Batterie her. Du stellst fest, wie sich verschiedene Batteriekombinationen auswirken. Du kennst die Wirkungen, die ein stromdurchflossener Leiter haben kann. Du erfährst die Wärmewirkung des elektrischen Stromes, wovon sie abhängig ist und was sie für Folgen haben kann. Du stellst fest, was mit einem von Strom durchflossenen Kabel bewirkt werden kann, wenn es um einen Eisenkern gewickelt ist. Du entdeckst die chemische Wirkung von elektrischem Strom. Du kannst den Vorgang des Galvanisierens erklären. Du lernst Alessandro Volta als bedeutenden Wissenschaftler kennen. 1.3. Stromstärke (Ampère) Du lernst das „Ampere kennen, die Einheit der elektrischen Stromstärke. Du erkennst, dass die Stromstärke durch einen Elektronenmenge, die in einer bestimmten Zeit fliesst, festgelegt wird Du erkennst, dass die Höhe der Stromstärke entscheidend für die Wirkung des Stromes ist und kannst dies erklären Du kennst Ampere als Einheit des Stromes und als Naturwissenschaftler Du kannst mit einem Amperemeter die Stromstärke messen Du weisst warum das Amperemeter niemals parallel in den Stromkreis geschaltet werden darf. Du erkennst den Zusammenhang zwischen Stromstärke und Spannung Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 3 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 1.4. Serie- und Parallelschaltung Du merkst, dass nicht nur Geschwister teilen müssen, sondern auch elektrische Bauteile und Geräte (Energieumwandler). Du kennst den Unterschied zwischen Serie- und Parallelschaltung und kannst diesen erklären Du weisst, dass in Reihe geschaltete Lampen voneinander abhängig sind. Du weisst, dass bei einer Parallelschaltung die einzelnen Geräte unabhängig voneinander sind. Du kannst Schaltpläne einfacher Stromkreise mit Serie- und Parallelschaltungen zeichnen Du kannst Schaltpläne lesen und damit ein Experiment durchführen. Du erkennst, welche Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit Lichterketten oder anderen elektrischen Schaltungen zu beachten sind. Du weisst, wie eine Schmelzsicherung aufgebaut ist. Du kannst die Funktionsweise einer Sicherung erklären und erkennst ihre Wichtigkeit. Du erkennst die Folgen einer unsachgemässen Reparatur einer Sicherung. Du weisst, wie es zu einer Überlastung des Stromkreises kommen kann. 1.5. Elektrischer Widerstand Du findest heraus, wovon der elektrische Widerstand abhängt. Du kommst dem Verhältnis auf die Schliche, welches Spannung, Stromstärke und Widerstand miteinander haben Du weisst, dass der elektrische Widerstand eines Drahtes vom Material, vom Querschnitt, von der Länge und von der Temperatur abhängig ist. Du kennst den Widerstand als elektrische Grösse und weisst, dass er in Ohm angegeben wird. Du kennst die Wirkung eines Widerstandes auf die Stromstärke Du weisst, dass die Helligkeit von Lampen vom Widerstand abhängen. Du kannst anhand einfacher Beispiele den Widerstand berechnen Du lernst Georg Simon Ohm als bedeutenden Forscher in der Geschichte der Physik kennen Du kennst die Beziehung zwischen Widerstand, Stromstärke und Spannung Du kannst diesen Zusammenhang im Experiment nachvollziehen und überprüfen Du weisst, dass dieser Zusammenhang als „Ohmsches Gesetz bezeichnet wird. Du kannst mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes Grössen im Stromkreis berechnen. 1.6. Begriffe Elektronenmangel, Elektronenüberschuss positive und negative Ladung Spannung, Stromstärke, Widerstand Volt- und Amperemeter, Netzgerät Volt, Ampere, Ohm, Ohmsches Gesetz Serie- und Parallelschaltung Monozelle, Batterie Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 4 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 2. Arbeitsplan 2.1. Elektrische Ladung Lehrmittel Auftrag E. Auswertung 7: DS 75-76 Doppelseiten 75-76 lesen, ohne Aufgaben Aufgabe 1 KISAM V25 Versuch V25 durchführen Protokollblatt 7: DS 77 Doppelseite 77 lesen, ohne Aufgaben Aufgabe 2 KISAM V26-V28 Versuch V26, V27, 28 durchführen Protokollblatt Schnelle Gruppen: Urknall DS 78 lesen und Aufgaben bearbeiten Aufgabe 3 2.2. Spannung (Volt) Lehrmittel Auftrag E. Auswertung 7: DS 79 Doppelseite 79 lesen, ohne Aufgaben Aufgabe 4 Versuche Experimente 1 und 2 S. 15/16 7: DS 80 Doppelseite 80: Werkstatt „Spannung lesen Versuche 29 30 KISAM V29–V30 Versuch V29 und V30 durchführen S. 17/18/19/20 Das galvanische Element die Monozelle S. 25 Input 7: DS 81 Doppelseite 81 lesen, als Vorbereitung für V31 Versuch 31 KISAM V31 Versuch V31 durchführen S. 22 7: DS 82 Doppelseite 82 lesen, ohne Aufgaben Versuch 32 KISAM V32 Versuch V32 durchführen S. 23 Sicherheitselemente beim Experimentieren S. 23 Versuch V33 durchführen S. 23 S. 24 Aufgaben zur Doppelseite 82 als Zusatz S. 26 Input KISAM V33 7: DS 82 2.3. Stromstärke (Ampere) Lehrmittel Auftrag E. Auswertung 7: DS 83 Doppelseite 83 lesen Vergleich, Zusammenfsg Skript S. 27/28 7: DS 84 Doppelseite 84 lesen, ohne Aufgaben Messreihe Doppelseite 84: Aufgaben 1 bis 4 S. 32 KISAM V34 Versuch V34 durchführen S. 31 Input Messen von Spannung und Stromstärke S. 29/30/ Input Wir zeichnen einen elektrischen Schaltplan S. 33 Berühmte Wissenschaftler S. 34 – 36 Internet Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 5 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 2.4. Serie- und Parallelschaltung Lehrmittel Auftrag E. Auswertung Input Definition Serie- Parallelschaltung S. 37/38 KISAM V35 Versuch V35 durchführen S. 38/39 7: DS 85 DS 85 lesen, ohne Bearbeitung der Aufgaben 7: DS 86 DS 86 lesen, ohne Bearbeitung der Aufgaben S. 40: Zusammen fassung Schnelle Gruppen DS 86: Aufgabe 2 bearbeiten Schnelle Gruppen: DS 85: Aufgabe 2 bearbeiten Schnelle Gruppen: DS 86: Aufgabe 3 bearbeiten 2.5. Elektrischer Widerstand Lehrmittel Auftrag E. Auswertung 7: DS 87 DS 87 lesen, ohne Bearbeitung der Aufgaben KISAM V36 Versuch V36 durchführen KISAM V37 Versuch V37 durchführen 7: DS 88 DS 88 lesen, ohne Bearbeitung der Aufgaben DS 87: Aufgaben 3 – 6 bearbeiten Schnelle Gruppen: DS 88: Aufgaben 1 und 4 bearbeiten DS 89: lesen und Aufgaben 1 und 2 bearbeiten DS 90, DS 92 und DS 93 lesen Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 6 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 3. Elektrische Ladung 3.1. Theorie 1. Aufgabe Zeichne hier eine Glimmlampe (DS 76) und beschrifte sie korrekt. Beschreibe kurz ihre Funktionsweise Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 7 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 2. Aufgabe (Doppelseite 77) a.) Ordne die folgenden Begriffe einander zu und erkläre sie kurz: Ladungsgleichgewicht – negative Ladung – Elektronenüberschuss – Elektronenmangel elektrisch neutral – positive Ladung. positive Ladung b.) Formuliere einen Merksatz, aus dem hervorgeht, wann sich Stoffe anziehen bzw. abstossen. 3. Aufgabe (DS 78: fakultativ für Niveau Sek) Lies die Doppelseite 78 aufmerksam durch und bearbeite anschliessend die 5 Aufgaben. Beantworte sie auf ein Zusatzblatt. Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 8 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 3.2. Versuche und Protokolle 3.2.1. Versuch Nr. 25 Versuch 25 Zeit: 5 Minuten zu dritt Ziel siehe auf der Versuchskarte Material siehe auf der Versuchskarte Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 25 Auswertung Übertrage deine Ergebnisse und Beobachtung in das Protokoll Nr. 25 ein. Merksatz: 3.2.2. Versuch 26 Versuch 26 Zeit: 10 Minuten zu dritt Ziel siehe auf der Versuchskarte Material siehe auf der Versuchskarte Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 26 Auswertung Übertrage deine Ergebnisse und Beobachtung in das Protokoll Nr. 26 ein und fülle den Lückentext. Merksatz: Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 9 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 3.2.3. Versuch 27 Versuch 27 Zeit: 15 Minuten zu dritt Ziel siehe auf der Versuchskarte Material siehe auf der Versuchskarte Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 27 Auswertung Übertrage deine Ergebnisse und Beobachtung in das Protokoll Nr. 27 ein. Merksatz 3.2.4. Versuch 28 Versuch 28 Zeit: 15 Minuten zu dritt Ziel siehe auf der Versuchskarte Material siehe auf der Versuchskarte Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 28 Auswertung Übertrage deine Ergebnisse und Beobachtung in das Protokoll Nr. 28 ein. Merksatz Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 10 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 3.3. Auswertung Fülle die Lücken Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 11 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre Beantworte die folgenden Fragen: Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 12 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 4. Spannung (Volt) 4.1. Theorie 4. Aufgabe Lies die Doppelseite 79 aufmerksam durch und beantworte anschliessend die folgenden Fragen: a.) Was muss erfüllt sein, damit ein elektrischer Strom fliesst? b.) Wie wird die Arbeitsfähigkeit der Elektronen genannt? c.) Wie heisst das Massinstrument, mit welchem diese Arbeitsfähigkeit gemessen werden kann? d.) Welche Einheit besitzt die Arbeitsfähigkeit des elektrischen Stromes? e.) Wie kürzt man die elektrische Spannung ab? f.) Erklären den Begriff „elektrische Spannung in deinen Worten. g.) Mit welcher Farbe wird der Minus- und der Pluspol einer Spannungsquelle normalerweise gekennzeichnet? h.) Ab welcher Spannungszahl wird es für uns gefährlich? i.) Notiere hier einige gebräuchliche Spannungen aus dem Alltag: Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Flachbatterie: Autobatterie: Haushaltsteckdose: SBB-Fahrleitung: Hochspannungsleitung: Seite 13 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 4.2. Die Spannungsquelle Die Spannungsquelle liefert uns den notwendigen Strom, um unsere Versuche durchführen zu können. Mögliche Spannungsquellen: Die Versuche in der Schule sind so angelegt, dass wir nicht mit der Spannung aus der Steckdose arbeiten. Das wäre teilweise auch viel zu gefährlich. Damit wir nicht mit Batterien arbeiten müssen, haben wir Netzgeräte. Wir unterscheiden: Wechselstrom Strom wie aus der Steckdose Gleichstrom Strom wie von einer Batterie ein Kabel wird in der grünen Buchse ganz Das kurze Kabel wird in die schwarze links (Null) eingesteckt, das andere in Buchse (Gleichrichter) und der geder Buchse mit der gewünschten Spanwünschten Spannung eingesteckt. nung (hier 10 V) Zwischen der blauen Minus-Buchse und der roten Plus-Buchse kann nun die benötigte Spannung abgegriffen werden (hier 10 V) Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 14 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 4.3. Das Voltmeter 4.3.1. Das Messgerät Mit einem Voltmeter können Spannungen gemessen werden. Unser Voltmeter sieht so aus: Einige Merkpunkte bei der Bedienung des Messgerätes: 1.) 2.) 4.3.2. Experiment 1 Miss die Spannung der verschiedenen Batterien. Achte darauf, dass du immer eine Gleichstrom-Spannung misst. Objekt Spannung Erkenntnis kleine Rundbatterie sehr kleine Rundbatterie Knopfbatterie Flachbatterie Zitrone Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 15 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 4.3.3. Experiment 2 Exp. 2 Zeit: 15 Minuten zu dritt Ziel du wirst sicher im Umgang mit dem Messgerät und dem Netzgerät Material Messgerät, Netzgerät, Kabel Auftrag Überprüfe die Ausgangsspannungen des Netzgerätes. Stelle dazu jede angegebene Spannung am Netzgerät ein und miss die entsprechende Spannung am Ende der Kabel. Auswertung Übertrage deine Messungen in die Tabelle: Wechselstrom eingestellt gemessen Gleichstrom eingestellt 2V 2V 4V 4V 6V 6V 8V 8V 10V 10V 12V 12V gemessen Merksatz Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 16 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 4.4. Versuche und Protokolle 4.4.1. Versuch 29: Elektrischer Strom aus Salzwasser Versuch 29 Zeit: 15 Minuten zu dritt Ziel siehe auf der Versuchskarte Material siehe auf der Versuchskarte Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 29 Auswertung Übertrage deine Ergebnisse und Beobachtung in das Protokoll Nr. 29 ein. Merksatz Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 17 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre Auswertung zum Versuch 29: Elektrochemische Spannungreihe Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 18 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 4.4.2. Versuch 30: Mehr Saft oder gesteigerte Spannung Versuch 30 Zeit: 15 Minuten zu dritt Ziel siehe auf der Versuchskarte Material siehe auf der Versuchskarte Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 30 Auswertung Übertrage deine Ergebnisse und Beobachtung in das Protokoll Nr. 30 ein. Merksatz Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 19 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre Auswertung zum Versuch 30: Die Serieschaltung (Reihenschaltung) Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 20 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 4.4.3. Versuch 31: Wenn Strom dem Draht einheizt Versuch 31 Zeit: 20 Minuten zu dritt Ziel siehe auf der Versuchskarte Material siehe auf der Versuchskarte Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 31 Auswertung Übertrage deine Ergebnisse und Beobachtung in das Protokoll Nr. 31 ein. Merksatz 4.4.4. Versuch 32: Anziehender Kraftprotz Versuch 32 Zeit: 25 Minuten zu dritt Ziel siehe auf der Versuchskarte Material siehe auf der Versuchskarte Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 32 Auswertung Übertrage deine Ergebnisse und Beobachtung in das Protokoll Nr. 32 ein. Merksatz Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 21 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre Auswertung zum Versuch 31: Wie erzeugt Strom Licht und Wärme? Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 22 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre Auswertung zum Versuch 32: Wie kann Strom? Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 23 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 4.4.5. Versuch 33 Bei diesem Versuch kommst du zum ersten Mal mit chemischen Stoffen in Berührung. Daher gilt es hier einen kleinen Einschub zu machen, damit du das Experiment gefahrlos durchführen kannst. Versuch 33 Zeit: 20 Minuten zu dritt Ziel siehe auf der Versuchskarte Material siehe auf der Versuchskarte Sicherheit Schutzbrille tragen Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 33 Auswertung Übertrage deine Ergebnisse und Beobachtung in das Protokoll Nr. 33 ein. Merksatz Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 24 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 4.5. Galvanisches Element 4.5.1. Die Monozelle Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 25 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 4.5.2. Aufgaben zur Doppelseite 82 1. Vergleiche einen Elektromagneten mit einem Dauermagneten. Notiere Unterschiede und Gemeinsamkeiten. 2. Das Zinkbad, in das eine Karosserie getaucht wird, ist natürlich viel grösser als das Glasgefäss mit der Kupferchloridlösung. Trotzdem funktionieren sie ganz ähnlich. Welcher Teil in diesem Versuchsaufbau entspricht denn nun der Autokarosserie? 3. Eins zu zwei. Elektrischer Strom kann sogar Wasser in seine Bestandteile zerlegen. Was dabei rauskommt, sind zwei unsichtbare Gase. Mit einer speziellen Auffangvorrichtung kann ihr Volumen „sichtbar gemacht werden. Warum vom einen Gas genau doppelt so viel gebildet wird wie vom anderen, verbirgt sich hinter der chemischen Formel H2O (Wasser). Weisst du schon, welche zwei Gase gemeint sind? 4. Eine Glühlampe ist stets von einem Glaskolben umgeben. Warum ist denn dieser Glaskolben so unendlich wichtig? Tipp: Dem Wärmeschutz dient er offensichtlich nicht. Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 26 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 5. Stromstärke (Ampere) 5.1. Definition Wir vergleichen die Begriffe der Elektrizität mit einem Wasserlauf Wasser elektrischer Strom Gefälle Spannung wenig Gefälle kleine Spannung grosses Gefälle grosse Spannung Wassermoleküle Elektronen Wassermenge Stromstärke wenig Wasser kleine Stromstärke viel Wasser grosse Stromstärke m3 pro Sekunde Ampere Liter Coulomb Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 27 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre Erläuterung: Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 28 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 5.2. André-Marie Ampère Geboren am in: 1775 in Lyon Gestorben am in: 1836 in Marseille Nationalität: Franzose Beruf Hobby: Als Naturwissenschaftler hat er sich ein Leben lang leidenschaftlich mit den Geheimnissen der Elektrizität und vielen andern Fragen beschäftigt. Ihm zu Ehren wurde die Stromstärke mit Ampere bezeichnet. Auch das Stromstärkemessgerät heisst Amperemeter. Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 29 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 5.3. Messen von Spannung und Stromstärke Spannung Stromstärke Das Voltmeter schliesst man im Ne- Das Amperemeter schliesst man immer direkt in den Stromkreis ein benanschluss an, niemals direkt in den Stromkreis parallel in Serie Voltmeter hat einen grossen inneren Widerstand Amperemeter hat einen sehr kleinen inneren Widerstand Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 30 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 5.3.1. Versuch 34: Stau am Lampendraht Versuch 34 Zeit: 20 Minuten zu dritt Ziel siehe auf der Versuchskarte Material siehe auf der Versuchskarte Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 34 Auswertung a.) Übertrage deine Beobachtung in das Protokoll Nr. 34 ein. b.) Übertrage deine Resultate der Tabelle in die Tabelle unten c.) Stelle die Tabelle grafisch dar. Was stellst du fest? Spannung Lampe Tauchsieder I1 I2 2V 0.04 0.17 4V 0.08 0.57 6V 0.12 0.99 8V 0.15 1.41 10 0.17 1.83 12 0.19 2.26 Merksatz Je höher die Spannung, desto grösser ist die Stromstärke. Spannung und Stromstärke sind im Idealfall proportional zueinander. Der Proportionalitätsfaktor heisst Widerstand. Der Widerstand nimmt mit zunehmender Temperatur zu. Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 31 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 5.4. Zusammenhang von Spannung und Stromstärke Versuchsaufbau (siehe auch Urknall 7: Doppelseite 84) Material: Netzgerät mit AC/DC-Kabel 2 Krokodilklemmen 45 cm Konstantandraht, 0.2 mm2 Schnellspannstecker Verbindungsstecker Amperemeter 3 Kabel 1. Spannt an der Stativlochplatte einen 45 cm langen Konstantandraht mit 0.2 mm2 Durchmesser ein. Schliesst ihn sodann mit einem Volt- und einem Amperemeter an ein Netzgerät an. 2. Messt für die Spannungswerte 2, 4, 6, 8, 10 die Stromstärken und legt eine Tabelle an. (Das Amperemeter ist auf die rote Markierung 10A einzustellen) 3. Schreibt die Messwerte in die Tabelle unten und übertragt anschliessend die Werte in das Koordinatensystem. 4. Formuliert einen „Je – desto – Satz der die Ergebnisse eurer Messreihe zusammenfasst. Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 32 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 5.5. Der elektrische Schaltplan Stromkreise zeichnet man meistens mit Hilfe von Schaltplänen. Damit jeder die Schaltpläne auch richtig lesen kann, benötigen wir eine bestimmte Zeichen-Sprache. Die für uns wichtigsten sind hier aufgelistet. Benenne sie: Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 33 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 5.6. Berühmte Wissenschaftler Ziel: Du kennst min. 3 wichtige Persönlichkeiten rund um die Elektrik Auftrag: Suche im Internet (www.wikipedia.ch, und andern Seiten) Informationen über die aufgelisteten Personen. Schreibe dir zu jeder Person die Eckdaten (geboren, gestorben, gelebt in, Erfindung Arbeit) heraus. Tipp: Vergleiche verschiedene Internetseiten miteinander. Sind alle Informationen gleich gut? Welche Seite gibt die übersichtlicheren Informationen? Personen: Alexander Volta André-Marie Ampère (siehe vorne) Georg Simon Ohm Thomas Edison Michael Faraday Charles Augustin de Coulomb Erik Edlund Wilhelm Hankel William Sturgeon James Watt Albert Einstein Name: Alessandro Volta Geboren am in: 18.2.1845 in Como Gestorben am in: 5.3.1827 in Como, Italien Nationalität: Italienischer Wissenschaftler Beruf Hobby: Er gilt als der Erfinder der Monozelle Batterie. Ihm zu Ehren wurde die Einheit der Spannung mit „Volt bezeichnet. Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 34 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Name: Georg Simon Ohm Geboren am in: 16.3.1789 in Erlangen Gestorben am in: 6.7.1854 in München Nationalität: Deutscher Physiker Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre Beruf Hobby: Hat schon mit 16 Jahren experimentiert und viele Schriften veröffentlicht. Ihm zu Ehren wurde das proportionale Verhältnis von Spannung und Stromstärke als ohmsches Gesetz bezeichnet und ging als Träger der Einheit „Ohm für Widerstand in die Geschichte ein. Name: Thomas Edison Geboren am in: 11.2.1847 in Ohio Gestorben am in: 18.10.1931 in West Orange, New Jersey Nationalität: US Amerikaner Beruf Hobby: Er gilt als der Erfinder der Glühbirne, auch wenn dies nicht ganz richtig ist. Er hat der Glühbirne ein einfaches Gewinde verliehen, so dass es für den Hausgebrauch nützlich wurde. Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 35 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre Name: Michael Faraday Geboren am in: 22.9.1791 in der Nähe von London Gestorben am in: 25.8.1867 in Hampton Court Nationalität: Englischer Physiker und Chemiker Beruf Hobby: Gilt als Erfinder des Dynamos Generators. Hat selber viele Untersuchungen und Experimente mit Elektrizität und Magnetismus gemacht. Name: Geboren am in: 22.9.1791 in der Nähe von London Gestorben am in: 25.8.1867 in Hampton Court Nationalität: Englischer Physiker und Chemiker Beruf Hobby: Gilt als Erfinder des Dynamos Generators. Hat selber viele Untersuchungen und Experimente mit Elektrizität und Magnetismus gemacht. Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 36 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 6. Serie- und Parallelschaltung 6.1. Definition und Eigenschaften Wenn wir ein Lämpchen haben, so können wir dieses einfach in den elektrischen Stromkreis einbauen. Bei zwei oder mehreren Glühlampen haben wir aber unterschiedliche Möglichkeiten. Wir wollen mit Hilfe eines Demoversuches die Eigenschaften auflisten Material: Netzgerät mit AC/DC-Kabel 2 Glühbirnen genügend Kabel Amperemeter Voltmeter 6.1.1. Serieschaltung Zuerst schalten wir die beiden Glühlampen hintereinander. Der Schaltplan: Spannung Lampe 1 Lampe 2 Total 6 6 12 Stromstärke Fazit Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Die Stromstärke ist im gesamten Stromkreis gleich gross. Die Spannung teilt sich auf die 2 Lämpchen auf. Fällt ein Lämpchen aus, dass ist der gesamte Stromkreis unterbrochen. Seite 37 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 6.1.2. Parallelschaltung Jetzt schalten wir die beiden Glühlampen noch parallel in den Stromkreis. Der Schaltplan: Lampe 1 Lampe 2 Total 12 12 12 Spannung Stromstärke Die Lampen sind unabhängig voneinander. Die Spannung ist bei allen Lämpchen gleich gross. Die Stromstärke teilt sich auf. Fazit 6.2. Versuch 35 Versuch 35 Zeit: 30 Minuten zu dritt Ziel Mat. siehe auf der Versuchskarte Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 35 Auswertung Übertrage deine Ergebnisse und Beobachtung in das Protokoll Nr. 35 ein. Merksatz Serieschaltung: Die Spannung teilt sich auf die einzelnen Lämpchen auf, die Stromstärke bleibt bei allen Lämpchen gleich. Parallelschaltung: Die Spannung bleibt bei allen Lämpchen gleich gross, die Stromstärke teilt sich auf die einzelnen Lämpchen auf. Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 38 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 6.3. Wie bringen wir die Lampen zum Leuchten? Übertrage deine Erkenntnisse aus dem Experiment nun auf diesen Lückentext: Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 39 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 6.4. Zusammenfassung Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 40 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 7. Der elektrische Widerstand 7.1. Definition und Einheit Spannung und Stromstärke haben wir bereits als wichtigste Begriffe der Elektrizität kennengelernt. Wir haben auch den proportionalen Zusammenhang im Experiment nachgewiesen. Dieses Verhältnis von Spannung und Stromstärke wird als Widerstand definiert: Widerstand Spannung Stromstärke R I Einfacher ist der folgende Zusammenhang zu behalten: Die Einheit des Widerstandes [R] 1 1 Ohm 7.2. Das Stromkreis-Trio Zwischen den drei Grössen im Stromkreis besteht ein mathematischer Zusammenhang. Durch Umformungen lassen sich sämtliche Stromkreis-Grössen errechnen. Das Spannungsdreieck hilft dir dabei. Decke die gesuchte Grösse ab, und die beiden übrigen Grössen zeigen dir den mathematische Zusammenhang, bzw. Operation. Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 41 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 7.2.1. Versuch 36: Schnelle Piste, grosse Röhre oder lange Leitung Versuch 36 Zeit: 35 Minuten zu dritt Ziel Mat. siehe auf der Versuchskarte Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 36 Auswertung Übertrage deine Ergebnisse und Beobachtung in das Protokoll Nr. 36 ein. Merksatz Der Widerstand ist abhängig von: • • • • Es gilt: • • 7.2.2. Versuch 37: Das Stromkreis-Trio Versuch 37 Zeit: 15 Minuten zu dritt Ziel Mat. siehe auf der Versuchskarte Auftrag Lies und befolge die Arbeitsaufträge auf der Versuchskarte 37 Auswertung Übertrage deine Ergebnisse und Beobachtung in das Protokoll Nr. 37 ein. Merksatz · R U I : Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 42 Schulzentrum Längenstein 7. Klasse Natur – Mensch – Mitwelt: Physik Elektrizitätslehre 7.3. Berechnungsaufgaben 1) Für eine 60 Watt Lampe misst man bei einer Spannung von 230 eine Stromstärke von 0.25 A. Berechne den Widerstand 2) Eine Halogenlampe wird mit einer Spannung von 12 betrieben. Die Stromstärke von 4 ist höher als bei einer normalen Lampe. Berechne der Widerstand. 3) Auf einem Lämpchen für eine Taschenlampe findet man folgende Angabe: 3.5 / 0.2 A. Berechne den Widerstand. 4) Was lässt sich über den Widerstand eines Isolators aussagen, ohne dass du dabei Rechnungen oder Messungen anstellst. 5) Durch eine Glühlampe fliesst bei einer Spannung von 230 eine Stromstärke von 0.26 A. Berechne den Widerstand. 6) Eine Halogenlampe hat einen Widerstand von 4 . Zum Betrieb wird eine Spannung von 24 benötigt. Wie gross ist die Stromstärke? 7) Auf einer Spule mit Kupferdraht steht folgende Aufschrift: max. 2 und 2.5 . Berechne die Spannung, die man im Höchstfall anlegen darf. 8) Ein Wasserkocher wird an eine Steckdose (230 V) angeschlossen. Er hat einen Widerstand von 26 . Berechne die Stromstärke. 9) An eine Steckdose im gleichen Raum wird gleichzeitig zu Aufgabe 8 ein Staubsauger angeschlossen. Der Staubsauger hat einen Widerstand von 50 . Berechne ebenfalls die Stromstörke. 10) Die Stromversorgung dieses Raumes (Aufgabe 8 und 9) ist mit einer 10-ASicherung abgesichert. Wird die Sicherung durchschmelzen, wenn beide Geräte gleichzeitig in Betrieb sind? Manuskript Elektrizität; ste; 2008 Seite 43