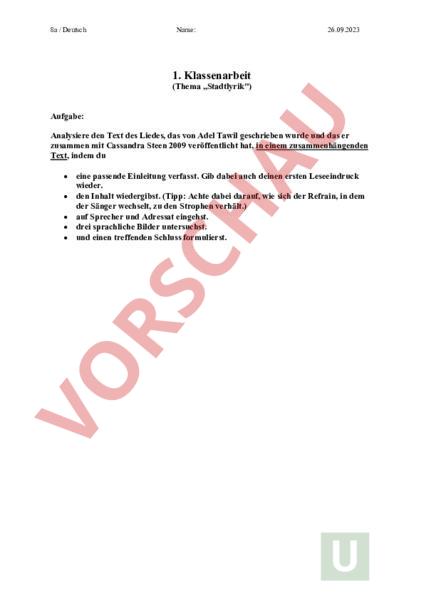Arbeitsblatt: Klassenarbeit
Material-Details
Klassenarbeit zu einer Reihe im Fach Deutsch/Klasse 8 mit Gedichten und Liedern zum Thema „Stadt“
Deutsch
Texte schreiben
8. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
214010
97
0
19.11.2025
Autor/in
Magistra H. (Spitzname)
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
8a Deutsch Name: 26.09.2023 1. Klassenarbeit (Thema „Stadtlyrik) Aufgabe: Analysiere den Text des Liedes, das von Adel Tawil geschrieben wurde und das er zusammen mit Cassandra Steen 2009 veröffentlicht hat, in einem zusammenhängenden Text, indem du • • • • • eine passende Einleitung verfasst. Gib dabei auch deinen ersten Leseeindruck wieder. den Inhalt wiedergibst. (Tipp: Achte dabei darauf, wie sich der Refrain, in dem der Sänger wechselt, zu den Strophen verhält.) auf Sprecher und Adressat eingehst. drei sprachliche Bilder untersuchst. und einen treffenden Schluss formulierst. Stadt 1 2 Es ist so viel noch viel zu viel, überall Reklame. Zuviel Brot und zuviel Spiel1. Das Glück hat keinen Namen. 3 4 Alle Straßen sind befahrn. In den Herzen kalte Bilder. Keiner kann Gedanken lesen. Das Klima wird milder. 5 6 7 Ich bau ne Stadt für Dich. Aus Glas und Gold und Stein. Jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich bau eine Stadt für Dich und für mich. 8 9 Keiner weiß mehr, wie er aussieht oder wie er heißt. Alle sind hier auf der Flucht, die Tränen sind aus Eis. 10 11 Es muss doch auch anders gehen, so geht das nicht weiter. Wo find ich Halt, wo find ich Schutz. Der Himmel ist aus Blei hier. 12 13 Ich geb keine Antwort mehr auf die falschen Fragen. Die Zeit ist rasend schnell verspielt und das Glück muss man jagen. 14 15 16 Ich bau ne Stadt für Dich. Aus Glas und Gold und Stein. Jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich bau eine Stadt für Dich und für mich. 17 18 19 20 Wo wir die Mauern aus Gier und Verächtlichkeit abbauen. Wo das Licht nicht erlischt, das Wasser heilt, Und jedes Morgenrot, und der Traum sich lohnt. Und wo jeder Blick durch Zeit und Raum in unsere Herzen fließt. 21 22 23 Ich bau ne Stadt für Dich. Aus Glas und Gold und Stein. Jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich bau eine Stadt für Dich und für mich. Writer(s): ADEL TAWIL, HEIKE KOSPACH, MAREK POMPETZKI, SEBASTIAN KIRCHNER, PAUL NEUMANN, FLORIAN FISCHER Quelle: www.musixmatch.com (01.09.2020) Anmerkungen: 1) Brot und Spiel Den Ausdruck panem et circenses hat der römische Dichter Juvenal geprägt. Wörtlich übersetzt bedeutet es „Brot und Wagenrennen, bei uns sagt man aber gewöhnlich „Brot und Spiele. Juvenal meinte, dass das römische Volk sich von allen politischen Dingen durch eben Brot (Getreide) und Spiele (Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe) ablenken ließ. Beides gab es kostenlos in Rom. Das heißt, Getreide wurde kostenlos verteilt und die Spiele kosteten keinen Eintritt. Erwartungshorizont zur ersten Klassenarbeit (Thema: Stadtlyrik) Inhaltliche Leistung Anforderungen 1 2 3 4 Lösungsqualität Der Prüfling max. verfasst eine Einleitung, in der er Autor, Titel, Entstehungsjahr, Thema des Liedes, Textsorte und seinen ersten Leseeindruck wiedergibt. beschreibt, wie das Thema des Gedichts inhaltlich entfaltet wird, z.B.: Strophe 1: Das lyrische Ich beschreibt zunächst seine Befindlichkeit in der Stadt. Es ist reizüberflutet und überfordert von der immensen Flut von (unwichtigen) Informationen (Reklame) und Unterhaltungsmöglichkeiten (Spiele). Zwischen diesen fühlt das lyrische Ich sich verloren und kann das Glück nicht mehr finden. Strophe 2: Hier werden neben dem überhandnehmenden Verkehr und der zunehmenden Klimakatastrophe die Menschen erwähnt, die dem lyrischen Ich begegnen und ihm dabei gefühllos erscheinen. Nach der zweiten sowie nach der fünften und nach der sechsten Strophe folgt der Refrain, in dem das zweite lyrische Ich dem ersten verspricht, ihm und sich selber einen Zufluchtsort zu bauen. Hier erfährt das erste lyrische Ich durch die zweimalige persönliche Anrede die Ansprache, die ihm ansonsten zu fehlen scheint. Strophe 3: In der dritten Strophe thematisiert das erste lyrische Ich weiter die Situation der Menschen, die sich selbst fremd geworden und daher sehr unglücklich sind. Strophe 4: Das lyrische Ich gibt seiner Verzweiflung über den unhaltbaren Zustand Ausdruck. Es fragt nach Halt und Schutz, da es sich in seiner derzeitigen Lage beklommen fühlt. Strophe 5: Nachdem in den vorausgehenden Strophen vor allem die Verzweiflung und Hilflosigkeit thematisiert wurden, ist in der fünften Strophe erstmals so etwas wie Widerstand zu erkennen. Das lyrische Ich will sich nur auf die wesentlichen Dinge beschränken, weil die Zeit so schnell vergehe und man sein Lebensglück leicht vertue. Strophe 6: Nach dem folgenden Refrain wird das Leben in der „neuen Stadt, die gebaut werden soll, näher als sehr positiv beschrieben. Es ist achtsam, liebevoll und angstfrei, verschafft Heilung, lässt Raum für Träume und schafft Nähe zwischen den Menschen. untersucht die Darstellung des lyrischen Ichs und seines Gegenübers, z.B.: Das lyrische Ich tritt zum ersten Mal in Vers 11 auf, wo es sich als hilfesuchend zeigt. Seine kritische Grundhaltung im Hinblick auf die falschen Lebensvorstellungen der Stadtbewohner wird im darauffolgenden Vers deutlich. Hilfe verspricht ihm sein Gegenüber, das im Refrain auftritt und ihm eine der Realität entgegengesetzte Traumstadt in Aussicht stellt. Die gemeinsame Vorstellung von dieser positiven Stadt, die sich an der Verwendung des Personalpronomens „wir zeigt, wird in der sechsten Strophe geäußert. analysiert drei sprachliche Bilder, z.B.: • „die Tränen sind aus Eis (V. 9): Diese Metapher scheint darauf hinzuweisen, dass die Menschen unglücklich sind, denn sie weinen. Aber selbst die Tränen sind nicht warm, weil das Gefühlsleben der Menschen quasi „eingefroren ist. • „Mauern aus Gier und Verächtlichkeit (V. 17): Diese Metapher zeigt, dass solch negative Gefühle wie Gier und Verächtlichkeit die Menschen so voneinander trennen, dass sie nicht mehr zueinander gelangen können. • „Und wo jeder Blick durch Raum und Zeit in die Herzen fließt. (V. 20): Möglicherweise ist mit dieser Metapher gemeint, dass die Menschen einander, anders als bis dahin beschrieben, nun endlich ansehen und dass der (liebevolle?) Blick des Anderen das Herz des Angeblickten berührt. 6 15 (2) (2) (3) (2) (2) (2) (2) 6 9 5 6 formuliert einen gelungenen Schluss, z.B.: Zusammenfassend lässt sich das Lied wohl als eine Kritik an den Lebensumständen des modernen Menschen verstehen, in denen Unterhaltung und Konsum eine wesentlichere Rolle spielen als Solidarität und Mitgefühl. Dies erklärt die vielen Bilder von Kälte, Hektik und Anonymität in den Strophen. Gleichzeitig wird aber auch der Traum eines besseren Zustandes beschworen, der hier ebenfalls bildhaft als Stadt aus Glas und Gold bezeichnet wird. • abschließende Überprüfung der Deutungshypothese • persönliches Urteil auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. 10 (6) Summe inhaltliche Leistung 46 Darstellungsleistung Der Prüfling 1 strukturiert seinen Text schlüssig, stringent und gedanklich klar. 3 2 bezieht beschreibende, deutende und wertende Aussagen begründet aufeinander. 3 3 drückt sich allgemeinsprachlich präzise, stilistisch sicher und begrifflich differenziert aus. 4 4 formuliert syntaktisch sicher, variabel und komplex. 4 5 schreibt sprachlich richtig. 5 6 belegt die Aussagen durch angemessenes und korrektes Zitieren. 3 Summe Darstellungsleistung 22 Summe insgesamt (inhaltliche und Darstellungsleistung) 68 Die Klassenarbeit wird insgesamt bewertet mit: Grundsätze für die Bewertung: Note Erreichte Punktzahl sehr gut plus 66-68 befriedigend minus 42-44 sehr gut 63-65 ausreichend plus 38-41 sehr gut minus 60-62 ausreichend 34-37 gut plus 57-59 ausreichend minus 30-33 gut 54-56 mangelhaft plus 24-29 gut minus 51-53 mangelhaft 18-23 befriedigend plus 48-50 mangelhaft minus 12-17 befriedigend 45-47 ungenügend 0-11