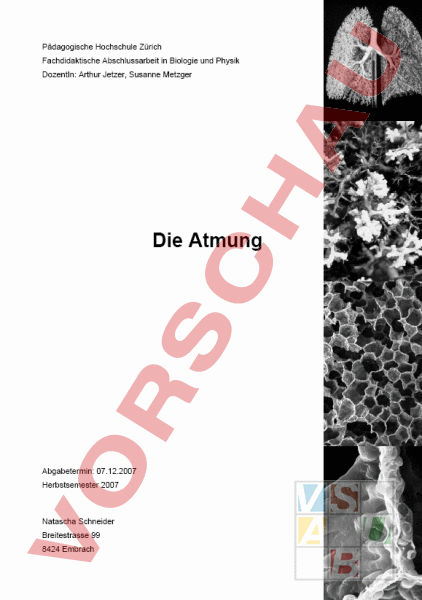Arbeitsblatt: Die Atmung
Material-Details
Kombi-Didaktikarbeit Physik-Biologie mit einer Grobplanung für ca. 8 Lektionen und einer Feinpräperation für eine Doppellektion (Werkstatt). Das Thema wird fächerübergreifend behandelt (Physik - Biologie).
Biologie
Anatomie / Physiologie
7. Schuljahr
26 Seiten
Statistik
22996
1577
59
05.08.2008
Autor/in
Natascha Schneider
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Pädagogische Hochschule Zürich Fachdidaktische Abschlussarbeit in Biologie und Physik DozentIn: Arthur Jetzer, Susanne Metzger Die Atmung Abgabetermin: 07.12.2007 Herbstsemester 2007 Natascha Schneider Breitestrasse 99 8424 Embrach Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung2 2 Didaktische Analyse .2 2.1 Ziele2 2.2 Begründung der Ziele und Inhaltsschwerpunkte nach bildungstheoretischen Gesichtspunkten .3 2.3 2.2.1 Handlungsorientierte Behandlung des Themas 3 2.2.2 Individueller Aufbau von neuen Wissensstrukturen 3 2.2.3 Erwerben von fächerübergreifenden Schlüsselkompetenzen .4 2.2.4 Drei Stufen kognitiver Denkprozesse nach Metzger .4 Kontext zum unmittelbaren Erlebnis- und Erfahrungsbereich der Schülerinnen und Schüler sowie zu natürlichen und technischen Prozessen5 2.4 Kontext zum Lehrplan und zu den Lehrmitteln .5 2.4.1 Lehrplan 5 2.4.2 Lehrmittel 7 2.5 Unterschiedliche Gestaltung des Themas in A-, B- und C-Klassen .7 2.6 Kontext zu anderen Inhaltsaspekten des Zürcher Lehrplanes .8 3 Grobplanung.8 4 Feinplanung11 5 Quellenverzeichnis .13 5.1 Bücher 13 5.2 Skript 13 5.3 Internet .13 Anhang 1 1 Einleitung Obwohl die Atmung lebensnotwendig ist, nehmen wir sie kaum war. Wir atmen automatisch und können uns dadurch auf unser Leben konzentrieren. Da sie für unser Überleben nicht wegzudenken ist, nimmt sie eine zentrale Position in der Menschenkunde ein. Ich fand es sehr spannend zu entdecken, dass die Atmung neben dem biologischen Aspekt auch die Physik betrifft, welche für die Funktionsweise der Lungen unbedingt miteinbezogen werden sollte. Aufgrund dieser Tatsache habe ich mich dazu entschieden, eine Lektionsreihe in einer Sek-A-Klasse zum Thema „Die Atmung als Kombination von Biologie und Physik durchzuführen. In den acht Natur und Technik Lektionen sollen die Schülerinnen und Schüler ihr Vorwissen, welches sie bereits aus ihren alltäglichen Erfahrungen und anderen Wissensquellen mitbringen, mit theoretischen Erkenntnissen erweitern und dadurch ein breites Blickfeld erhalten. Sie sollen durch dieses ausführliche Grundwissen und die körperlichen Erfahrungen, welche sie bei Schülerversuchen machen können, eine stabile Basis erhalten, um aktuellen Themen und dem Leben allgemein begegnen zu können. Meine Arbeit setzt sich aus der didaktischen Analyse und der Grob- bzw. Feinplanung zusammen. In meiner didaktischen Analyse möchte ich die Bedeutung des Themas „Die Atmung darlegen und auf die fünf Dimensionen von Wolfgang Klafki eingehen. Sowohl die exemplarische Bedeutung als auch die Zukunfts- und Gegenwartsbedeutung sollen im Kontext zum unmittelbaren Erlebnis- und Erfahrungsbereich der Schülerinnen und Schüler, zu natürlichen und technischen Prozessen sowie zum Lehrplan erläutert werden. Die Struktur der Inhalte sowie die Zugänglichkeit (z. B. mit Hilfe von Versuchen, Ereignissen) werden in der Grob- bzw. Feinplanung darlegt. 2 Didaktische Analyse 2.1 Ziele Die folgenden konkreten Zielsetzungen sollen während meiner Lektionsreihe erreicht und mit einer abschliessenden Prüfung (summativ) kontrolliert werden: 1 Die Schülerinnen und Schüler sollen erklären können, welchen Weg die Luft durch unseren Körper zurücklegt. Dabei sollen sie die folgenden wichtigen Begriffe kennen: Nasenhöhle, Kehlkopf, Luftröhre, Flimmerhärchen, Lungenflügel, Bronchien, Lungenbläschen. 2 Die Schülerinnen und Schüler können den Begriff Luftdruck erklären und wissen, welche Wirkungen des Luftdruckes wir selber spüren können. 3 Die Schülerinnen und Schüler kennen die Begriffe Unter- und Überdruck und können diese mit einem Alltagsbeispiel erklären. 2 4 Die Schülerinnen und Schüler können die Funktionsweise von Pumpen mit Hilfe einer Zeichnung erklären. 5 Die Schülerinnen und Schüler wissen, wie das Ein- und Ausatmen beim Menschen mit Hilfe von Unterund Überdruck funktioniert. Dabei sollen sie die wichtigen Begriffe Zwerchfell und Rippen benützen. 2.2 Begründung der Ziele und Inhaltsschwerpunkte nach bildungstheoretischen Gesichtspunkten Die Atmung stellt eine der wichtigsten Funktionen unseres Körpers dar. Ohne die Atmung können wir nicht leben. Die Atmung verläuft automatisch, sodass wir uns auf andere Dinge konzentrieren können. Ich finde das Thema sehr spannend, weil wir uns nur selten aktiv mit unserer Atmung beschäftigen und aufgrund des oben genannten Automatismus gar nicht recht wissen, wie unser Körper das Atmen überhaupt vollzieht. Der biologische und physikalische Aspekt der Atmung sollte auf jeden Fall thematisiert werden, da ich es als sehr wichtig erachte, dass wir uns aktiv mit unserem Körper und dessen Funktionen auseinander setzen, damit wir unserer Gesundheit Sorge tragen können. 2.2.1 Handlungsorientierte Behandlung des Themas Die Schülerversuche sind handlungsorientiert, einfach durchführbar und verständlich. Das Thema kann durch den Bezug zum eigenen Körper sehr gut handlungsorientiert erkundigt werden, da die Schülerinnen und Schüler gewisse Funktionen selber an ihrem Körper beobachten können. Durch den hohen alltäglichen Bezug kann auch das Interesse und die Motivation gestärkt werden, sich mehr Wissen über den eigenen Körper anzueignen. Das sinnliche Erleben und die Verbindung der Thematik mit eigenen Empfindungen helfen den Schülerinnen und Schülern, die Begriffe mit emotionalen Verbindungen im Wissen zu verankern und sich dadurch die Begriffe besser zu merken. 2.2.2 Individueller Aufbau von neuen Wissensstrukturen Die Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit haben, selbstständig und individuell an zum Teil selber gewählten Posten zu arbeiten. Mit Hilfe der Werkstattarbeit möchte ich die Lerntheorie des Konstruktivismus in meine Lektionsreihe einbeziehen. Ich möchte einen gut organisierten Rahmen schaffen, in welchem ich den Schülerinnen und Schülern verschiedene Lernangebote und Wissensquellen bereitstelle und selber in den Hintergrund trete um den Lernprozess der Lernenden beobachten und begleiten zu können. Ich gehe davon aus, dass ich meine Lektionsreihe am Ende der zweiten Klasse1 durchführe und die Schülerinnen und Schüler damit das Werkstatt-Arbeiten bereits kennen. Ich habe die Werkstatt jedoch noch klar strukturiert (Pflichtposten), weil die Schülerinnen und Schüler noch nicht ganz 1 siehe „Dreijahresplan Realien Sekundarstufe (Skript BI 210, Arthur Jetzer, Herbstsemester 2007) 3 selbstständig, das heisst ohne Unterstützung und Organisation durch die Lehrperson, arbeiten können. Sie sind aber frei in der Wahl der anderen Posten. 2.2.3 Erwerben von fächerübergreifenden Schlüsselkompetenzen Die Sekundarstufe ist in Hinblick auf das spätere Leben im Beruf von grosser Bedeutung, denn sie soll den Schülerinnen und Schülern nicht nur das nötige Grundwissen vermitteln, sondern auch Fähigkeiten fördern, welche für das Arbeiten in einem Unternehmen oder in einer anderen Institution eine grosse Rolle spielen. Die Schülerinnen und Schüler sollen Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, zuverlässig sein, sorgfältig und kooperativ arbeiten können sowie eine gewisse Fähigkeit zur Reflexion zeigen. Während Partner- und Gruppenarbeiten sollen die Schülerinnen und Schüler lernen ihre sozialen Kompetenzen zu verbessern: Sie lernen die Gefühle und Meinungen von Mitschülerinnen und Mitschüler zu akzeptieren, die Arbeit gleichberechtigt unter allen Gruppenmitgliedern aufzuteilen und einander mit Rücksicht und Respekt zu begegnen. Durch die soziale Interaktion mit anderen soll die Kooperationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. Die Reflexion findet vor allem in Bezug auf ihre eigene Körperwahrnehmung und auf den Umgang mit dem eigenen Körper statt. Die Schülerinnen und Schülern sollen sich darin üben, ihren Körper bewusst wahrzunehmen und diese Empfindungen zu beschreiben. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung eines gesunden Körpers erkennen und ein Bewusstsein dafür schaffen, wie sie ihrem Körper Sorge tragen können. 2.2.4 Drei Stufen kognitiver Denkprozesse nach Metzger „Für die Umsetzung von Themen nach den Grundsätzen des Spiralcurriculums eignet sich ein Kompetenzraster, welches in drei Zielebenen aufgeteilt ist: Kognitiv, affektiv und instrumentell. Während meiner Lektionsreihe möchte ich verschiedene Bereiche dieses Kompetenzrasters ansprechen. Im affektiven Bereich sollen die Schülerinnen und Schüler in diesen acht Lektionen emotional angesprochen (z. B. Lektion 1, Werkstatt-Versuche) werden und eigenständig werten und Stellung nehmen (z. B. Lektion 8). Das Handeln und Sich engagieren sollte in einer darauffolgenden Projektwoche zur Suchtprävention stattfinden. Auf der instrumentellen Ebene kennen die Schülerinnen und Schüler bereits die Werkstatt-Arbeit und wissen, wie sie fachwissenschaftliche Texte bearbeiten müssen. Sie sollen während der Werkstatt-Arbeit die gegebene Methode übernehmen oder selber eine Methode wählen und anwenden. In der achten Lektion kommt dann das Kombinieren und Einsetzen von unterschiedlichen Methoden teilweise zur Anwendung. Im kognitiven Bereich müssen sie ihr Vorwissen aktivieren und sich dadurch an bereits erworbenes Wissen erinnern können. Die Schülerinnen und Schüler verstehen die verschiedenen Informationen und können sie in Auf- 4 gaben anwenden. Das Bearbeiten von Problemen wird nicht direkt während dieser Lektionsreihe behandelt, kann jedoch anschliessend in weiteren Lektionen Eingang finden.2 2.3 Kontext zum unmittelbaren Erlebnis- und Erfahrungsbereich der Schülerinnen und Schüler sowie zu natürlichen und technischen Prozessen Der unmittelbare Erlebnis- und Erfahrungsbereich ist durch den Bezug zur eigenen Atmung und somit zum eigenen Körper klar gegeben. Jede Schülerin und jeder Schüler hat bereits alltägliche Erfahrungen (wie z. B. das bewusste Anhalten des Atems, die Veränderung des Atems bei sportlicher Betätigung, Husten oder Atembeschwerden wie Asthma) gemacht. Insbesondere sportliche Jugendliche haben unter Umständen bereits Erfahrung mit der Atmung während verschiedenen sportlichen Tätigkeiten gemacht (z. B. Atemtechniken). Die Schülerinnen und Schüler sind aufgrund ihres Alters und den damit verbundenen Entwicklungen (Pubertät) sicher schon einmal mit dem Thema „Rauchen in Kontakt gekommen. Sei dies in Werbungen, im Ausgang oder sogar in der eigenen Familie; das Thema „Rauchen ist allgegenwärtig. Die Lernenden eignen sich durch diese alltäglichen Begebenheiten bereits zahlreiche Informationen an, welche die Funktionsweise und der Aufbau der Lunge sowie allfällige Lungenkrankheiten und –beschwerden betreffen. Während der Druck von Wasser bei Tauchgängen (Druckausgleich) erfahren werden kann, ist der Luftdruck vor allem bei Veränderungen der Höhenlage (Ferien in den Bergen) spürbar. Jene Lernende, welche bereits einmal geflogen sind oder sich für das Fliegen interessieren, wissen unter Umständen, dass Druckunterschiede auch in diesem Bereich eine grosse Rolle spielen (z. B. Auftrieb bei den Flugzeugflügeln, Druck im und ausserhalb des Flugzeuges). Zudem können wir das Prinzip von Unter- und Überdruck im alltäglichen Leben leicht antreffen: Zum Beispiel Staubsauger, Strohhalme oder Dampfkochtöpfe arbeiten nach genau diesem Prinzip. Indessen wird die Funktionsweise von Pumpen den Schülerinnen und Schülern weniger bekannt sein, obwohl diese in ihrem alltäglichen Leben eine grosse Rolle spielen (z. B. Velopumpen, Blasbalgen von Luftmatratzen etc.). 2.4 Kontext zum Lehrplan und zu den Lehrmitteln 2.4.1 Lehrplan In den nachfolgenden Erläuterungen werde ich mich jeweils auf den Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich beziehen. 2 Skript „Spiralcurriculum aus dem BI210-Modul von A. Jetzer 5 2.4.1.1 Leitbild (Seiten 3 bis 5) Im Leitbild werden zehn Grundhaltungen, welche die Schule prägen sollen, genannt. Während meiner Lektionsreihe lege ich besonderen Wert auf die folgenden Grundhaltungen: Interesse an Erkenntnis und Orientierungsvermögen Die Schülerinnen und Schüler sollen sich neues Wissen erschliessen, Fragen stellen und motiviert und interessiert daran sein, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sie sollen erkennen, dass dieses Wissen für sie und die Gesellschaft eine Bedeutung hat. Verantwortungswille Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, sich eine eigene Meinung zu bilden, diese zu vertreten und wenn nötig sich einem Entscheid einer Gruppe unterzuordnen. Dialogfähigkeit und Solidarität Die Schülerinnen und Schüler sollen kooperative Fähigkeiten entwickeln. In den Gruppenarbeiten sollen sie gemeinsam an der Lösung von Aufgaben arbeiten. Umweltbewusstsein Die Schülerinnen und Schüler sollen von der Natur erstaunt werden und ihr Achtung entgegenbringen. Sie sollen ihre Verantwortung gegenüber den Ressourcen erkennen. Urteils- und Kritikfähigkeit Die Schülerinnen und Schüler sollen eigene und fremde Meinungen in Frage stellen, prüfen und begründen. Sie sollen mit Kritik umgehen können. Offenheit Die Schülerinnen und Schüler sollen offen sein für ihre Umwelt und andere Länder. 2.4.1.2 Bedeutung des Unterrichtsbereichs und Richtziele (Seiten 27 und 29) „Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass wir einerseits von der Umwelt geprägt sind. Andererseits beeinflussen wir die Umwelt. Die Lernenden sollen an Beispielen sich selbst und die Umwelt kennen und verstehen lernen sowie zur Verantwortung und aktiven Mitgestaltung ihrer Zukunft erzogen werden. In den Richtzielen zu Natur und Technik sind in Bezug auf mein gewähltes Thema folgende Punkte am wichtigsten: Unmittelbares Erleben und Beobachten, Benennen von wichtigen Erscheinungen mit Hilfe von klaren Begriffen, Diskussion über aktuelle Probleme, Einblick in komplexe Wechselwirkungen im Zusammenspiel Natur – Mensch – Technik, Nutzen von technischen Hilfsmitteln. 2.4.1.3 Grobziele (Seiten 85 bis 88) Im Bereich Natur und Technik spielen die grundlegenden Arbeitsweisen eine grosse Rolle, welche von der ersten Lektion an angewendet werden sollten. Die Schülerinnen und Schüler sollen „physikalische, chemische und biologische Phänomene in der Alltagswelt sowie an sich selber beobachten und dabei wesentliche Merkmale wahrnehmen. Zudem können sie „naturkundliche Experimente und Untersuchungen planen und durchführen, Beobachtungen und Informationen zweckmässig festhalten und „klare Begriffe bilden. Die Schülerinnen und Schüler sollen während der Lektionsreihe neues Orientierungswissen erwerben, das heisst sie können „Einblicke in die Denk- und Arbeitsweise in Physik, Chemie und Biologie gewinnen, wichtige Erscheinungen und Vorgänge mit genauen Begriffen verbinden sowie „Begriffe und Regeln auf alltägliche Phänomene anwenden. Sie „gewinnen Einblicke in Zusammenhänge und „lernen Kreisläufe und Wechselwirkungen untersuchen und kennen. Zusätzlich sollen Wertvorstellungen geklärt werden: Die Schülerinnen und Schüler lernen die 6 „Konsequenzen eigenen und fremden Tuns in ausgewählten Bereichen untersuchen und gewichten. 2.4.2 Lehrmittel Für die Bearbeitung des Themas „Die Atmung stehen das Biologie-Lehrmittel „Bau und Funktionen unseres Körpers sowie die beiden Physik-Lehrmittel „Physik für die Sekundarstufe (Sek-A-Lehrmittel) und „PHYS!K (Sek-B/C-Lehrmittel) zur Verfügung. Ich habe mich dafür entschieden, sowohl in der Sek als auch in der Sek und mit dem Sek-ALehrmittel „Physik für die Sekundarstufe zu arbeiten (Begründung siehe 2.5). 2.4.2.1 Biologie-Lehrmittel „Bau und Funktionen unseres Körpers Im Biologie-Schülerbuch wird das Thema ausführlich behandelt und eröffnet einen guten Einblick in die Funktionsweise der Lungen. Die Informationen sind jedoch zum Teil zu ausführlich und zu kompliziert geschrieben und sollten von der Lehrperson auf das Wichtigste beschränkt werden. Aufgrund der zeitlichen Beschränkung auf sechs bis acht Lektionen werde ich darauf verzichten, die Atmung im chemischen Bereich3 genauer anzusehen. 2.4.2.2 Physik-Lehrmittel „Physik für die Sekundarstufe Im Physik-Schülerbuch gibt es zahlreiche gute Versuche, welche von den Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden können. Die theoretischen Texte, welche die Begriffe und die Funktionsweise von Pumpen erklären, sind jedoch ohne Hilfe der Lehrperson nicht klar verständlich. Sie sollten von der Lehrperson aufbereitet und in überarbeiteter Form von den Schülerinnen und Schülern als Theorieeintrag abgeschrieben und bearbeitet werden. 2.5 Unterschiedliche Gestaltung des Themas in A-, B- und C-Klassen Ich habe meine Lektionsreihe für die Durchführung in einer Sek-A-Klasse entwickelt. Die bereits formulierten Lernziele sollten jedoch für B- und C-Klassen angepasst werden. Die handlungsorientierte Arbeitsweise kann zwar beibehalten werden, die Schülerinnen und Schüler der Sek und sollten jedoch die Gelegenheit bekommen, Begriffe und Abläufe noch mehr mit den eigenen Händen zu erfahren und das erworbene Wissen in unterschiedlichster Weise immer wieder zu repetieren und in anderen Kontexten anzuwenden. In Bezug auf die modellhafte Darstellung der Atmung mit Hilfe einer PET-Flasche ist das Ziel in Sek-AKlassen, dass die Schülerinnen und Schüler die Funktionsweise der Atmung rein mit Worten erklären können (abstrakte Ebene), während die Lernenden von B- und C-Klassen dies mit Hilfe des Modells, also mit den Händen (in einer konkrete Handlung) können sollten. Bei der Werkstattarbeit sollten das Laufblatt und die Posten so überarbeitet werden, dass zwei zu3 siehe auch 2.6 Kontext zu anderen Inhaltsaspekten des Zürcher Lehrplanes 7 sätzliche Posten zur grundlegenden Wissensaneignung zur Verfügung stehen und die Posten zur Aneignung von erweitertem Wissen und Expertenwissen um je einen Posten reduziert werden. Zudem sollte die Lehrperson eine noch stärkere Führung und Organisation an den Tag legen. Dabei soll gewährleistet werden, dass die Schülerinnen und Schüler nicht durch eine zu grosse Freiheit und der damit verbundenen Überforderung demotiviert werden. Vergleich der Physik-Schülerbücher für A- und B/C-Klassen Wenn man die beiden Physik-Schülerbücher vergleicht, stellt man sehr rasch fest, dass die beiden Lehrmittel eine unterschiedliche Auffassung davon haben, wie die Hydraulik eingeführt und behandelt werden soll. Beide Lehrmittel führen zwar den Druck und den Luftdruck ein, jedoch erfolgt dann beim Sek-A-Lehrmittel eine Ausweitung auf das Thema Ventile und Pumpen. Diese Ausweitung finde ich notwendig, da das Prinzip der hydraulischen Hebebühne nur dann wirklich verstanden werden kann, wenn man bereits das Prinzip von Ventilen und Pumpen kennen gelernt hat. Aufgrund dieses Vergleiches und den Schlüssen daraus habe ich mich dafür entschieden, sowohl in der Sek als auch in der Sek und mit dem Physik-Lehrmittel „Physik für die Sekundarstufe (Sek-A-Lehrmittel) zu arbeiten. 2.6 Kontext zu anderen Inhaltsaspekten des Zürcher Lehrplanes Neben den physikalischen und biologischen Aspekten kann die Atmung auch im Chemieunterricht thematisiert werden (z. B. Kohlenstoffdioxid-Nachweis, Zellatmung). Wenn möglich sollte gleich auf meine Lektionsreihe eine Lektionsreihe oder eine Projektwoche zum Thema „Rauchen (Suchtprävention) folgen. Die Funktionsweise von Pumpen und Ventilen kann zudem auf das Biologie-Thema „Herz, Blutkreislauf übertragen werden. Die Atmung kann auch im Sportunterricht behandelt werden, indem zum Beispiel unterschiedliche Atemtechniken erprobt werden oder getestet wird, wie sich die Atmung bei verschiedenen Laufstrecken verhält. Verschiedene Atemtechniken, das bewusste Beeinflussen der Stimme und verschiedene Arten der Stimmbildung kann zudem im Musikunterricht thematisiert werden. 3 Grobplanung Ich habe meine Lektionsreihe für eine zweite Sek-A-Klasse geplant. Dabei gehe ich davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler bereits die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 1 Die Schülerinnen und Schüler können den Druckbegriff definieren und kennen die Einheit des Druckes und die Formel für dessen Berechnung. 2 Die Schülerinnen und Schüler wissen bereits, dass mit Hilfe von Kalkwasser der Nachweis von CO2 erfolgen kann. 3 Die Schülerinnen und Schüler haben bereits mehrere Male eine Werkstattarbeit durchgeführt und wissen, wie diese abläuft. Sie kennen das Postenblatt und können selbstständig mit diesem arbeiten. 8 In der nachfolgenden Grob- bzw. Feinplanung verwende ich die Abkürzung „Sch. sinngemäss für „Schülerinnen und Schüler, LP für Lehrperson und „SB für Schülerbuch. Lektion 1 23 4 5 Inhalt Wissen und Kenntnisse Fähigkeiten und Fertigkeiten Thema: Einführung „Die Atmung Die LP verbreitet vers. Gerüche: Geruchssinn Einzel und zu zweit: Verfolge so gut wie möglich den Weg der Luft durch deinen Körper. Die Sch. wissen, dass beim Riechen und Atmen die Luft als Erstes die Nase passiert und dabei Gerüche wahrgenommen werden. Die Sch. können über ihre eigene körperliche Tätigkeit nachdenken und formulieren, wie sie gewisse körperliche Tätigkeiten wahrnehmen. Theorie: A4-Blatt mit Zeichnung des Körpers: 1. Farbe für den Weg der Luft, wie ich ihn fühle. 2. Farbe für den richtigen Weg der Luft. Begriffe mit 1. Farbe notieren (Vorwissen). Die Sch. aktivieren ihr Vorwissen. Die Sch. kennen die folgenden wichtigen Organe, welche die Luft passiert: Nasenhöhle, Rachen, Kehlkopf, Luftröhre, Lungenflügel. Die Sch. können ihre eigene körperliche Tätigkeit wahrnehmen und ihre Empfindungen in Worte fassen und anderen mitteilen. Werkstattarbeit zu „Ich und meine Atmung Die Sch. können individuell ihr Wissen über die Atmung (Werkstatt-Themen) aufbauen. Besprechen und Präsentieren der Tabellen (Werkstattarbeit) mit anschliessendem Theorieteil (Aufbau und Merkmale der Lungen). Die Sch. kennen den Weg der Luft sowie den Aufbau und die Merkmale der Lungen. Sie können individuell oder mit einem Partner Versuche durchführen und einem Text die wichtigsten Informationen entnehmen. Sie können verschiedene Resultate vergleichen und Schlüsse ziehen. Thema: Aufbau und Merkmale der Lungen Thema: Atmen Was geschieht da genau? Zu zweit mit dem SB und weiteren Unterlagen (Bilder) herausfinden, was genau bei der Atmung passiert. Besprechen und Theorieteil. Die Sch. wissen, dass das Atmen durch das Atemzentrum gesteuert wird. Sie wissen, wie das Ein- und Ausatmen genau funktionieren. Die Sch. können in Zweiergruppen arbeiten, die Arbeit gerecht verteilen, Meinungen und Vorstellungen austauschen und diskutieren. Basteln des Modellversuches zur Atmung (in 3er-Gruppen): Ballon in einer Flasche. Funktionsweise herausfinden durch Erweitern des Wissens in den kommenden Lektionen. Die Sch. wissen, wie (nicht warum!) das Modell für die menschliche Atmung funktioniert. Die Sch. können ruhig und konzentriert das Modell selber herstellen und sich dabei eigene Gedanken zur Funktionsweise machen. Sie gehen sorgfältig mit dem Material um. Die Sch. wissen, dass die Luft Gewicht hat und auf alle Körper der Erde drückt. Sie wissen, dass der Luftdruck mit der Höhe abnimmt. Die Sch. können konzentriert einem Demonstrationsversuch folgen, diesen genau beobachten, Hypothesen aufstellen und diese begrün- Thema: Einführung des Luftdruckes und der Begriffe Unterdruck V2 (Seite 121 SB) mit Sch. als Demonstrationsversuch durchführen. Theorieteil: Definition Luftdruck, Lufthülle 9 der Erde, Druck auf den Körper. Gruppenarbeit: Wie öffnet man ein Gurkenglas? Theorieeintrag Unterdruck 6 7 Die Sch. wissen, dass bei Unterdruck der äussere Luftdruck grösser ist als im Gefäss. Die Sch. können in Gruppen zusammenarbeiten und ihr Vorwissen aktivieren. Funktionsweise von Pumpen (Bilder): V3 und V4 (Seite 130 SB) Theorie-Input 1 (Spritze) Die Sch. wissen, dass Pumpen mit Hilfe des Prinzips von Unter- und Überdruck arbeiten. Wasserpumpen (Seite 131 SB): Kurzer Input und Versuch V2 (Seite 128 SB) zur Funktionsweise von Ventil in 3er-Gruppen Theorie-Input 2 (Wasserpumpe) Die Sch. wissen, wie Ventile funktionieren. Sie wissen auch, wie Pumpen mit Ventilen arbeiten und können diese Funktionsweise mit Hilfe der Wasserpumpe erklären. Die Sch. können selbstständig oder in Gruppen einen Versuch durchführen und eine Hypothese darüber bilden, was beim Versuch genau geschieht. Die Sch. können einen sauberen Theorieeintrag erstellen und aktiv mitdenken. Thema: Einführung der Funktionsweise von Pumpen und von Über-/Unterdruck Thema: Auflösung Modellversuch Repetition Funktionsweise von Pumpen (Experimente, Erklärung durch Unter-/Überdruck) Die Sch. wissen, wie der Modellversuch genau abläuft und können die Funktionsweise des Modells und somit der Atmung mit Hilfe des Prinzips von Unter-/Überdruck (Pumpen) erklären. Die Sch. können ihr Vorwissen (Erfahrung, bereits Erworbenes) aktivieren und anwenden. Die Sch. können einen Versuch sorgfältig durchführen und Hypothesen bilden. 3er-Gruppenarbeit: Thema (Krankheiten, Beschwerden, Sucht, rechtliche Regelung etc.) bearbeiten und Plakat anfertigen. Die Sch. eignen sich selbstständig spezifisches Wissen zu einem Thema an. Die Sch. können in Gruppen arbeiten, die Arbeit gleichberechtigt verteilen, miteinander diskutieren und sich auf etwas einigen. Im Klassenzimmer herumlaufen, Plakate betrachten und Fragen stellen. Die Sch. informieren sich mit Hilfe der Plakate über die verschiedenen Themen. Die Sch. können konzentriert Texte lesen und bei Verständnisproblemen Fragen formulieren. Modellversuch (Flasche mit Ballon): Versuch in der 3er-Gruppe nochmals durchführen. Mit Hilfe der Theorie Erklärungen suchen 8 den. Thema: Rauch und andere Beschwerden 10 4 Feinplanung der Lektionen 2 und 3 „Aufbau und Funktionsweise der Lungen Lektionsziele: Wissen und Kenntnisse Fähigkeiten und Fertigkeiten • Die Sch. wissen, wie die Lungen genau aufgebaut sind und kennen jede Stelle im Körper (Organe), welche von der Luft passiert wird. • Die Sch. können selbstständig mit ihrem Laufblatt an den verschiedenen Posten arbeiten. • Die Sch. kennen verschiedene Merkmale der Lungen wie zum Beispiel das Fassungsvermögen der Lungen. • Die Sch. können individuell oder mit einem Partner Versuche durchführen. Dabei handeln sie anderen gegenüber sozial kompetent. • Die Sch. wissen, dass in den Lungenbläschen der Gasaustausch erfolgt und dass dabei der Sauerstoff vom Blut aufgenommen und Kohlendioxid vom Blut abgegeben wird. • Die Sch. können einem fachwissenschaftlichen Text die wichtigsten Informationen entnehmen. Sie können verschiedene Resultate vergleichen, Schlüsse ziehen und Hypothesen bilden. Lektionsablauf Zeit Inhalte Unterrichtsform Material Teilziele 5 LP gibt Inhalt und Lernziele der Lektion bekannt und erklärt das weitere Vorgehen (Organisation der Werkstatt) mit Hilfe des Laufblattes: Laufblatt-Aufbau erläutern (Schwierigkeiten, erledigt), Vorstellen der einzelnen Posten (Ort, Inhalt), Sozialform, Ziele, eingeschränkte Auswahl der Posten. Ein(e) Sch. liest das Vorgehen auf dem Laufblatt vor. Sch.-Fragen werden geklärt. Die Sch. erhalten klare Vorgaben zur Organisation der Werkstatt. Sie wissen, was sie während der Werkstatt-Zeit zu tun haben und verstehen den Ablauf der Werkstatt. LP, Plenum Laufblätter, Orientierungsplan (wo liegen die einzelnen Posten?) an der Wandtafel 39 Individuelle Arbeit an den verschiedenen Werkstatt-Posten. Die Lehrperson befindet sich dabei bei den Posten 5 und 7. Die Sch. setzen sich durch die verschiedenen Versuche aktiv mit ihrem Körper und dessen Funktionen auseinander. Durch die individuelle Arbeit mit den Texten bauen die Sch. sich ihr Wissen über den Aufbau der Lungen und deren Funktionsweise auf. Sie vertiefen dieses Wis- Einzel-/Partnerarbeit Laufblätter, Postenblätter, Material der verschiedenen Posten (siehe Postenblätter) 11 sen durch selber gewählte Aspekte und arbeiten selbstständig. 1 Die LP achtet darauf, dass die Sch. vor der Pause noch die wichtigsten Erkenntnisse notieren und das Material und ihre Blätter so hinlegen, dass sie nach der Pause ohne Weiteres weiterarbeiten können. Bereits erledigte Blätter sollen bereits auf das Pult gelegt werden. Die Sch. sollen Ordnung bewahren, das heisst sie sollen ihr Material ordnen und so hinlegen, dass sie nach der Pause gleich weiterarbeiten können. LP, Einzelarbeit Laufblätter, Heft resp. individuell bearbeitete Blätter, Postenmaterial Pause 25 Individuelle Arbeit an den verschiedenen Werkstatt-Posten siehe Teilziel für die 39 der ersten Lektion Einzel-/Partnerarbeit Laufblätter, Postenblätter, Material der verschiedenen Posten (siehe Postenblätter) 20 Präsentieren der Werkstatt-Tabellen: Die Sch. erläutern ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, was sie erlebt, beobachtet und herausgefunden haben. Ergänzen und Besprechen des Aufbaus und der Merkmale der Lungen: Die LP bespricht die Erkenntnisse aus den verschiedenen Posten anhand eines Theorieeintrages, welcher die wichtigsten Informationen zusammenfasst. Sie schreiben den Theorieeintrag der Lehrpeson ab. Die Sch. denken aktiv mit und haben den Mut, ihre Antworten zu präsentieren. LP, Plenum Blatt mit Zeichnung des Oberkörpers (bereits in 1. Lektion erhalten) Während dem Abschreiben des Theorieeintrags, können sie ihre verschiedenen Postenblätter selbstständig korrigieren. Die Sch. können das Theorieblatt sorgfältig ausmalen und selbstständig und ehrlich ihre Postenblätter korrigieren. Einzelarbeit Theorieblatt, Wandtafel, Lösungsblätter zu den Werkstattposten Die Sch. können den Theorieeintrag konzentriert und sauber abschreiben. Das für diese Doppellektion benötigte Unterrichtsmaterial (Theorieeintrag, Werkstatt) habe ich im Anhang aufgeführt. 12 5 Quellenverzeichnis 5.1 Bücher WALDER, PAUL (1989): Bau und Funktionen unseres Körpers (Schülerbuch und Lehrermaterial). Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. Zürich WAIBLINGER, WILLY (1991): PHYSIK für die Sekundarstufe (Schülerbuch und Lehrerkommentar). Cornelsen Verlag Berlin. Orell Füssli Verlag Zürich. BILDUNGSDIREKTION DES KANTONS ZÜRICH (2004): Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürichs. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. Zürich. 5.2 Skript JETZER, ARTHUR (HS 2007): Spiralcurriculum, Unterrichtskonzepte für die Sekundarstufe I. BI 210 Biologiedidaktik. PHZH. 5.3 Internet Wikipedia (25.11.2007, 18:15 Uhr) Vitanet (25.11.2007, 18:45 Uhr) edoc-server (25.11.2007, 19:05 Uhr) Samariter LI (26.11.2007, 18:20 Uhr) Sportunterricht.de (26.11.2007, 18:30 Uhr) Medführer.de (29.11.2007, 09:00 Uhr) Bilder: Bilder auf dem Titelblatt (05.12.2007, 18:10 Uhr) Aufbau der Lungen (Werkstatt, P1) lunge_funktionsgrundlagen (02.12.2007, 22:00 Uhr) Nasenhöhle P6)26/HTML/image003.gif (02.12.2007, 22:15 Uhr) Stimmbänder (Werkstatt, P9) (02.12.2007, 22:30 Uhr) 13 Anhang Theorieeintrag: Die Atmung Aufbau der Lungen Nasenhöhle mit drei Muscheln Rachen Stimmbänder Kehlkopf Luftröhre Rechter Lungenflügel Linker Lungenflügel Luftröhre Bronchie mit Verästelung Flimmerhärchen Lungenbläschen Herz Die Atemwege Nase Reinigung, Erwärmung und Befeuchtung der Luft, Geruchssinn Kehlkopf Spannen der Stimmbänder Luftröhre Flimmerhärchen befördern kleine Verunreinigungen nach aussen Lungenflügel Der rechte Lungenflügel umfasst 3, der linke nur 2 Lungenlappen Bronchien Stammbronchien in jedem Lungenflügel, Verästelung der Bronchien Lungenbläschen Gasaustausch (Sauerstoff Ù Kohlenstoffdioxid) Merkmale der Lungen Fassungsvermögen: Bei ruhigem Ein- und Ausatmen: 0.5 Liter pro Atemzug Reserveluft: 1.5 Liter Luft Gesamtfassungsvermögen: 3.5 bis 4 Liter Atemrhythmus: (eigener Atemrhythmus) 17-Jähriger: 20 Atemzüge pro Minute Der Atemrhythmus hängt vom Alter ab. Gasaustausch: Durch die zarte Haut der Lungenbläschen wandert der Sauerstoff aus der Atemluft ins Blut und in umgekehrter Richtung das Kohlendioxid vom Blut in die Atemluft. Obwohl in der Luft 21% Sauerstoff enthalten sind, werden nur ca. 4% Sauerstoff in den Lungen ausgetauscht. ii Werkstatt: Laufblatt Die Atmung Name: Nr. Posten Zeitaufwand BI Datum: Schwierigkeiten? Erledigt? Grundlegendes Wissen 1 Modell der Lungen ca. 15 min 2 Um wie viele cm vergrössert sich mein Brustkorb beim Atmen? max. 5 min 3 Wer hält am längsten den Atem an? max. 5 min 4 Messen der Atemfrequenz: In Ruhe und nach sportlicher Aktivität ca. 10 min 5 Fassungsvermögen der Lungen max. 15 min 6 Unterschied zwischen dem Atmen durch die Nase und durch den Mund ca. 5 min Erweitertes Wissen 7 Atmung verbraucht Sauerstoff ca. 15 min 8 Was geschieht beim Husten? ca. 5 min 9 Stimmbänder ca. 10 min 10 Reserveluft ermitteln ca. 15 min Expertenwissen 11 Atembeschwerden in den Bergen ca. 10 min 12 Wieso kommt es bei schnellem Laufen rasch zur Übermüdung? ca. 10 min Vorgehen: 1. Versuch 1 aus „Grundlegendes Wissen muss jeder durchführen. 2. Wähle aus dem Block „Grundlegendes Wissen 2 Versuche aus (Die Reihenfolge ist egal). Entscheide selber, ob du die Postenarbeit alleine oder zu zweit durchführen sollst. 3. Wenn du die 3 Versuche aus dem 1. Block ohne oder mit gelösten Schwierigkeiten erledigt hast, wähle 1 bis 2 Versuche (je nach Zeitaufwand) aus dem Block „erweitertes Wissen aus und bearbeite diese. 4. Hast du noch Schwierigkeiten mit dem Thema oder fühlst du dich noch unsicher? Wenn ja, dann löse weitere Versuche aus dem 1. und 2. Block. 5. Der 3. Block ist freiwillig und für jene, welche bereits die oberen Punkte erledigt und keine Schwierigkeiten oder Unsicherheiten mehr haben. Sozialform: Prinzipiell Einzelarbeit, Partnerarbeit möglich (keine Gruppenarbeit!) Zeit: 65 Minuten Material: 1 Werkstatt-Heft zur Dokumentation und Beantwortung von Fragen iii Posten 1: Modell der Lungen Die Atmung BI Nimm das Buch „Bau und Funktionen unseres Körpers und öffne es auf der Seite 70. Löse den Lückentext mit Hilfe der Seiten 70 und 71 und ergänze die Zeichnungen. Unten sind zahlreiche Begriffe aufgeführt, welche du nach dem Einsetzen durchstreichen kannst. Begriffe: Kehlkopf Luftröhre Brustkorb Lungenflügel Bronchien (2 x) Zwerchfell Rippen Rippenfell Lungenwurzel Lungenbläschen (2 x) O2-reich (O2 Sauerstoff) O2-arm Aufbau und Funktion der Lungen Die Lungen bestehen aus zwei, die gut Brustkorb Lungenwurzel geschützt im liegen, der von den , Lungenbläschen dem Brustbein und der Wirbelsäule gebildet wird. Gegen die Bauchhöhle wird er durch das , dem wichtigsten Atemmuskel, abgeschlossen. Die Lungenflügel sind in zwei Lungenlappen auf der linken Seite und drei Lungenlappen auf der rechten Seite unterteilt. Der Weg der Luft Die eingeatmete Luft gelangt zunächst in die Luftröhre, die etwa 12 cm lang vom Kehlkopf hinunter in den Brustkorb zieht. An der tritt sie jeweils in einen der beiden Lungenflügel ein und teilt sich weiter in immer kleinere Bronchialäste, die . Am Ende dieser Äste sitzen die, durch deren Wände Sauerstoff ins Blut aufgenommen und Kohlendioxid umgekehrt abgegeben wird. Für beide Lungen zusammen rechnet man zwischen 300 und 750 Millionen Lungenbläschen. iv Posten 2: Um wie viele Zentimeter vergrössert sich mein Brustkorb beim Atmen? Die Atmung BI Material: Massband, Tabelle Aufgabenstellung: Nimm das Massband und miss deinen Brustkorb, wenn du einatmest und dann den Atem anhältst. Trage die Zentimeter in die Tabelle ein. Miss deinen Brustkorb noch einmal, aber dieses Mal, wenn du normal ausgeatmet hast. Trage diese in die Tabelle ein. Achte darauf, dass du dann misst, wenn der Brustkorb deiner Meinung nach am grössten ist. Tabelle: Name (oder anonym) 1. Umfang Brustkorb bei angehaltenem Atem (in cm) 2. Umfang Brustkorb beim Ausatmen (in cm) Differenz zwischen 1. und 2. Posten 3: Wer kann am längsten den Atem anhalten? Die Atmung BI Material: Stoppuhr, Tabelle Aufgabenstellung: Nimm die Stoppuhr und miss damit, wie lange du deinen Atem anhalten kannst. Mache zwei Versuche und notiere dann in die letzte Kolonne die bessere Zeit. Tabelle: Name (oder anonym) 1. Versuch in Minuten und Sekunden 2. Versuch in Minuten und Sekunden Bessere Zeit aus dem 1. und 2. Versuch vi Posten 4: Miss deine Atemfrequenz in Ruhe und nach sportlicher Aktivität Die Atmung BI Material: Stoppuhr, Tabelle Aufgabenstellung: Nimm die Stoppuhr und miss damit, wie viele Atemzüge du in Ruhe (ohne körperliche Anstrengung) während einer Minute machst. Miss danach, wie viele Atemzüge du nach einer Runde um das Schulhaus (Rennen!) während einer Minute machst. Trage die Atemfrequenz in die unten stehende Tabelle ein. Buch „Bau und Funktionen unseres Körpers: Lies auf der Seite 74 den Abschnitt zum Atemrhythmus und jenen zum Sauerstoffbedarf (bis zur Angabe in Liter) und vergleiche die Angaben mit deinen Messungen. Tabelle: Name (oder anonym) 1. Atemfrequenz in Ruhe (Anzahl Atemzüge pro Minute) 2. Atemfrequenz nach dem Rennen (Anzahl Atemzüge pro Min.) Differenz zwischen 1. und 2. vii Posten 5: Fassungsvermögen der Lungen Die Atmung BI Material: Glasglocke, 2 Glasrohre, Gummischlauch mit Quetschhahn, Wanne, Tabelle Aufgabenstellung: Atme einmal gewöhnlich, ruhig ein und aus. Notiere dir jeweils den Wasserstand in der Glasglocke. Beim zweiten Mal darfst du nun versuchen, so viel wie möglich einzuatmen und so viel wie möglich auszuatmen. Wie gross ist der Unterschied? Tabelle: Name (oder anonym) 1 Gewöhnlich einund ausatmen (in l) Einatmen 2 So viel wie möglich ein- und ausatmen (l) Ausatmen Einatmen Unterschied 1 und 2 Ausatmen Einatmen Ausatmen viii Posten 6: Unterschied zwischen dem Atmen Die Atmung durch die Nase und durch den Mund BI Warum soll das Atmen durch den Mund angeblich ungesund sein? Informiere dich mit Hilfe des Buches „Bau und Funktionen unseres Körpers. Öffne es auf der Seite 66/67, lese den Text zum Thema „Nase und beantworte die unten stehenden Fragen. 1. Welche Funktion übernimmt die Nase? 2. Wieso ist es gefährlich, wenn wir durch den Mund atmen und dadurch zahlreiche Staubteilchen in die Lungen geraten würden? Posten 7: Atmung verbraucht Sauerstoff Die Atmung BI Material: Pipette, Schlauch, Waschflasche, Kalkwasser, Mundstücke Aufgabenstellung: Atme neben dem Schlauch ein. Dann atme in den Schlauch (mit deinem Mundstück darauf) hinein aus, sodass das Kalkwasser zu blubbern beginnt. Beantworte die folgenden Fragen mit dem Versuch und mit Hilfe des Buches „Bau und Funktionen unseres Körpers (Text Seite 70, Bilder auf den Seiten 73 und 75). VORSICHT: Nicht in den Schlauch einatmen! NUR ausatmen! 1. Was kannst du beobachten, wenn du in das Kalkwasser ausatmest? 2. Was beweist diese Veränderung? 3. Wir atmen Sauerstoff ein. Wo im Körper wird dieser gegen einen anderen Stoff ausgetauscht? 4. Wie viele Prozent Sauerstoff und Kohlendioxid enthält die eingeatmete Luft, wie viel die ausgeatmete Luft? Eingeatmete Luft (in %) Ausgeatmete Luft (in %) Sauerstoff Kohlendioxid ix Posten 8: Was geschieht beim Husten? Die Atmung BI Lies den Text zum Thema „Husten und beantworte die folgenden Fragen: 1. Welchen Zweck hat das Husten? 2. Welche Organe sind beim Husten beteiligt? Und was geschieht mit diesen Organen? 3. Wann musst du am meisten husten? In welchen alltäglichen Situationen? Husten Husten hat die biologische Funktion der Atemwegsreinigung. Keime oder Fremdkörper, welche sich eventuell in den Lungen oder in der Luftröhre befinden, werden abgehustet. Beim Husten zieht sich das Zwerchfell zusammen und die in den Atemwegen befindliche Luft wird ruckartig ausgestossen. Die durch den Hustenreiz ausgestossene Luft kann eine Geschwindigkeit von bis zu 480 Kilometer pro Stunde erreichen. Husten ist ein Symptom und keine Krankheit. Die gewöhnliche Erkältung stellt die häufigste Ursache dar. (Informationen aus und Posten 9: Stimmbänder Die Atmung BI Wie kommt unsere Stimme zustande? Wie können wir sprechen? Informiere dich mit Hilfe des Buches „Bau und Funktionen unseres Körpers. Öffne es auf der Seite 68, lies den Text zum Thema „Kehlkopf und beantworte die folgenden Fragen: 1. Wo liegen die Stimmbänder im menschlichen Körper? 2. Wie entsteht unsere Stimme? Welche Rolle spielen dabei die Stimmbänder? 3. Welchen Unterschied gibt es zwischen den männlichen und weiblichen Stimmbändern? 4. Wo wird der Ton, wo werden die Sprechlaute gebildet? 5. Zu welchem Zweck spannen wir unsere Stimmbänder? Was nützt dies uns? Gespannte Stellung Normale, lockere Stellung Posten 10: Reserveluft ermitteln Die Atmung BI 1. Reserveluft experimentell bestimmen: Benütze das Material von Posten 5 „Fassungsvermögen der Lungen. Atme zuerst gewöhnlich aus (nicht in den Schlauch hinein). Es ist wichtig, dass du hier wie sonst auch ausatmest und nicht zu stark. Dann stosse die noch in den Lungen vorhandene Luft kräftig aus und bestimme die Zunahme in Liter. Wie gross war die Zunahme? Notiere dir die Zahl in Liter. 2. Theoretische Erklärung zum Nutzen der Reserveluft suchen: Öffne das Buch „Bau und Funktionen unseres Körpers auf der Seite 74. Lies den Abschnitt „Fassungsvermögen der Lungen und beantworte die unten stehenden Fragen: 1. Wie gross sollte die Reserveluft gemäss Buch sein? 2. Besteht ein grosser Unterschied zwischen der Liter-Angabe im Buch und jener, welche du selber gemessen hast? Wenn ja, wieso wohl? 3. Wie gross ist das Fassungsvermögen der Lungen insgesamt? 4. Wie viel Luft bleibt immer in den Lungen? Wie nennt man diese? Posten 11: Atembeschwerden in den Bergen Die Atmung BI Lies den unten stehenden Text und beantworte die folgenden Fragen. 1. Wie geschieht mit dem Luftdruck mit zunehmender Höhe? 2. Was bedeutet „die Luft wird dünner? 3. Wieso fällt einigen Menschen in der Höhe das Atmen schwer? 4. Warum nehmen Bergsteiger z. B. auf den Himalaya Sauerstoff-Flaschen mit? Die Lufthülle der Erde (aus „Chemie heute von Schrödel und „PHYSIK von Cornelsen) In der Lufthülle der Erde ist der Luftdruck über dem Erdboden am grössten. Nach oben hin wird die Luft immer dünner. Schon in 6000 Höhe ist der Luftdruck nur noch halb so gross wie in Meereshöhe. Vielen Menschen fällt das Atmen in einer solchen Höhe schwer, weil man in solchen Höhen viel schneller atmen muss, um die zum Leben notwendige Luft und damit den Sauerstoff zu bekommen. Das heisst, wer auf einen Berg steigen will, muss seinen Körper daran gewöhnen, mit nur der Hälfte an Sauerstoff pro Atemzug auszukommen. In 8000 Höhe können sich Menschen ohne Sauerstoffversorgung nur maximal einen Tag aufhalten. Jede körperliche Leistung bereitet wegen des Sauerstoffmangels grösste Mühe. xi Posten 12: Wieso kommt es beim schnellen Laufen rasch zur Ermüdung? Die Atmung BI 1. Öffne das Buch „Bau und Funktionen unseres Körpers auf der Seite 74. Lies den Abschnitt „Ermüdung (von „Eine plötzliche maximale Muskeltätigkeit bis „wieder zu Zucker aufgebaut.) und beantworte die unten stehenden Fragen: 1. Wieso haben wir nach einem Lauf Atemnot? Wenn wir plötzlich zu rennen beginnen, was verbrauchen dann unsere Muskeln zuerst? 2. Wann entsteht Milchsäure und was bewirkt sie? 2. Lies die beiden unten stehenden Texte zum Thema anaerobes Training und Ausdauertraining und beantworte die folgenden Fragen: 1. Was bedeutet anaerob? Was bedeutet aerob? 2. Worin liegt der Unterschied zwischen anaerobem Training und aerobem Ausdauertraining? Nenne zu jedem Training noch ein Beispiel einer sportlichen Betätigung. 3. Worauf musst du beim Ausdauertraining achten, damit es zu keiner Milchsäureproduktion (Übersäuerung) kommt? „Anaerobes Training Unser Körper greift auf anaerobe Energiebereitstellung zurück, wenn er kurzfristig eine hohe Leistung vollbringen muss. Die Verwertung der Energiereserven erfolgt dann ohne Sauerstoff (anaerob ohne Luft). Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn wir ein Gewicht hochstemmen müssen. Bei länger andauenden Belastungen wie einem schnellen Lauf (z. B. 400 m-Lauf) wird vermehrt Milchsäure (Laktat) in den Muskeln gebildet. Dies führt schließlich zu einer Übermüdung des Muskels und Abbruch des Laufes. Bei Ausdauertraining sollte daher das Tempo so gewählt werden, dass es nicht zu schnell ist und keine Übersäuerung stattfindet. Anaerobes Training ist auch nur bei einer guten Grundlagenausdauer sinnvoll und leistungssteigernd. Ausdauertraining Ausdauertraining unter dem Aspekt der Gesundheitsförderung ist ein Training der dynamischen aeroben Ausdauer. Das bedeutet, dass ein Training immer mit dynamischer Bewegung, beispielsweise Jogging, verbunden ist. Die Belastung ist nur so hoch, dass die Körperzellen ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden also aerob arbeiten können.4 4 (29.11.07, 19:00 Uhr) xii