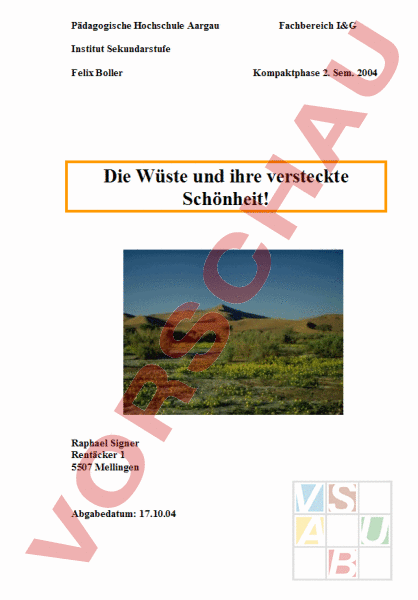Arbeitsblatt: Wüste
Material-Details
Didaktische Grundlage zur Erarbeitung des Themas
Geographie
Anderes Thema
7. Schuljahr
15 Seiten
Statistik
23010
1434
41
05.08.2008
Autor/in
Raphael (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Pädagogische Hochschule Aargau Fachbereich I&G Institut Sekundarstufe Felix Boller Kompaktphase 2. Sem. 2004 Die Wüste und ihre versteckte Schönheit! Raphael Signer Rentäcker 1 5507 Mellingen Abgabedatum: 17.10.04 Inhaltsverzeichnis Einleitung 3 1. Didaktische Umsetzung 1.1 Aufbau der Unterrichtseinheit 4 1.2 Lektion 1 5 1.3 Arbeitsblatt 7 1.4 Experiment 8 2. Lehrerinformationen 2.1 Wie entstehen Wüsten? 9 2.2 Welche Wüstentypen gibt es? 10 2.3 Was sind die formbildenden Kräfte in der Wüste? 11 2.4 Gibt es Pflanzen in der Wüste? 12 2.5 Wie passen sich die Tiere an? 13 2.6 Woher kommt der Sand? 14 Quellen Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 15 2 Raphael Signer Einleitung In einer Lektionsreihe von vier bis fünf Stunden sollen sich die Schüler ein revidiertes und erweitertes Bild der Klimazone Wüste erarbeiten. Es ist von Vorteil, wenn diese Lektionsreihe in die Behandlung aller Klimazonen eingebettet ist und auch die Kenntnisse der mathematischen, wie der natürlichen Klimazonen vorausgesetzt werden können. Die Behandlung der Klimazonen lässt auch eine breitgefächerte Abdeckung von verschiedenen Themenbereichen zu. So können nebst ethischen Sitten und Bräuchen auch religiöse Zusammenhänge mit der jeweiligen Zone hergeleitet werden oder physikalische Prinzipien wie das Dampfdruckgesetz, aber auch soziale Probleme, wie die Ausbeutung der Drittweltländer oder die Landflucht. Worum geht es und was muss vorher überdacht werden? Ziel dieser Lektionsreihe ist unter anderem, dass die Schüler das landläufige Bild der Sandwüste relativieren können. Sie sollen sich bewusst werden, dass die Sandwüsten lediglich 5% der gesamten Wüstenfläche der Erde ausmachen. So wie das Bild der Sandwüste aus Ferienprospekten eine anhaltende Wirkung zeigen, so soll nun auch zur Relativierung mit Bildern gearbeitet werden. Die Lehrperson sollte sich zuerst mit zahlreichen Bildern von verschiedenen Wüstentypen eindecken. Dafür dienen Internet, zahlreiche Bücher, Ferienprospekte usw. (kann auch den Schüler als Auftrag gegeben werden, aber Achtung: 90% Sandwüsten!). Weiter soll geklärt werden, woher die Wüste kommt und dass die Wüste lebt! Ich wünschte mir, dass mit dieser Lektionsreihe, das Interesse der Schüler geweckt wird, selber einmal in die Wüste zugehen. Es ist wichtig, dass man sich der Zielgruppe bewusst ist. Mit einer Realklasse ist eine vereinfachtere Form zu finden. Oft gilt der Grundsatz: „Weniger wäre mehr!. Ich habe mich bei den Lehrerinformationen vor allem auf das Buch von Horst Eichler „Gesichter der Erde gestützt. Weiter empfehle ich zum Arbeiten mit Bezschülern das Lehrmittel „die Erde, in welchem sehr hilfreiche Grafiken mehr als viele Worte aussagen und ergänzen. Mit einer Realklasse könnte man auch den Tagebucheintrag aus dem Lehrmittel „Mensch und Raum 2 lesen und anhand dieser Aussagen die Fakten an Beispielen erklären. Unbedingt lohnt sich auch der Aufwand, das im Anhang erwähnte Experimentmodell zu konstruieren, um das Wandern einer Sanddüne zu zeigen. Es lohnt sich den Lektionsplan zu studieren und eventuell an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. So kann man dort mehr Zeit aufwenden, wo man selbst am meisten fasziniert ist. Auf alle Fälle sollen die Schüler interessiert gemacht werden für die Wüste, die unheimlich schön ist! Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 3 Raphael Signer 1. Didaktische Umsetzung 1.1 Aufbau der Unterrichtseinheit Lektion 1 und ev. 2 In der ersten Lektion werden die verschiedenen Typen von Wüsten und deren Entstehung analysiert. Der Einstieg wird mit Bildern von Erg bis Hamada gemacht. Es soll den Schülern veranschaulicht werden, dass man unter Wüste nicht nur den Typ Sahara versteht! Mit Hilfe eines Arbeitsblattes werden die drei Entstehungsarten erarbeitet. Die Schüler suchen dann selbstständig die verschiedenen Wüsten im Atlas. Lektion 3 und 4 In der zweiten Lektion sollen die Schüler mit den Lebewesen der Wüste vertraut werden. Dazu werden die beiden Arbeitsblätter „Pflanzen und „Temperatur in Bodennähe behandelt. Es könnten auch ein Kaktus und ein Zwerghamster oder Springmaus als Anschauungsmaterial organisiert werden. In einem zweiten Teil sollen die Schüler ein Plakat zusammenstellen, das eine Wüstenpflanze oder ein Wüstentier näher erklärt (Informationen aus Büchern, Internet usw.) Lektion 5 In der vierten Lektion werden den Schülern die verschiedenen Lebensformen der Menschen näher gebracht. Bsp. Las Vegas, Nomadismus, Oasenbewohner. Im weiteren wird die Wüstenwanderung anhand eines Experiments erklärt. Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 4 Raphael Signer 1.2 Lektion 1 (Einstiegslektion) Thema Verschiedene Wüstentypen und deren Entstehung Voraussetzungen Gewisse Vorkenntnisse über die Klimazonen sollten vorhanden sein. Vor allem die mathematischen, aber auch die natürlichen Faktoren einer Klimazonen sollten schon behandelt worden sein. Lernziele Die Schüler wissen, dass es verschiedene Wüstentypen gibt und können diese anhand der äusseren Erscheinung erkennen. Zudem können sie aufgrund des Reliefs erklären, wie eine solche Wüste entstanden ist. Didaktisch-methodische Schwerpunkte Den Schülern soll mit dem Einstieg bewusst gemacht werden, welches WüstenVerständnis der normale Bürger hat. Sie sollen mit Hilfe der Lehrperson oder des Lehrmittels auch die jeweiligen Charaktere einer Wüste aus den Bildern ablesen können. Im weiteren Verlauf lernen sie die Reliefs im Atlas zu erkennen und zu interpretieren. Im Lehrgespräch werden Erkennungsmerkmale erarbeitet, mit denen die jeweiligen Charaktere einer Wüste aus Bildern abgelesen werden kann. Hilfsmittel und Darstellungsformen Dias und Projektor (sofern vorhanden), oder Bilder aus Bücher; Hellraumprojektor; Arbeitsblätter; Weltatlas; Lehrmittel „Die Erde. Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 5 Raphael Signer Lektionsplanung Zeit Unterrichtsverlauf Lektionsaufbau, Lehr- und Lerntätigkeiten Bilder der verschiedenen Wüstentypen projizieren oder zeigen. Mit der Frage: Welches sind Wüsten? Organisation Sozialform, Medien, Figuren Plenum Didaktischer Kommentar Begründen einzelner Schritte, Verweis auf Teilziele Provozierender Unterrichtseinstieg. Die Schüler sollen ihr eigene Wahrnehmung reflektieren. 10 Mit Schüler Abbildung im Buch „Die Erde auf Seite 230/231 besprechen. Merkmale auf Bilder zusammen tragen. Plenum; Lehrmittel „Die Erde Lehrgespräch. Die Charaktere der Wüstentypen erkennen lernen. 10 Entstehung von Klima-, Küsten-, Binnenwüste erklären mit Folie. Plenum; Folie Kurz-Vortrag Schüler kennen und verstehen die drei Entstehungsformen 15 Arbeitsblatt lösen und Wüsten im Atlas suchen. Zu Zweit; Schweizer Weltatlas; Arbeitsblatt Partnerarbeit. Schüler lernen Relief aus dem Atlas zu lesen. 05 Kontrolle ob die richtigen Namen der Wüsten zu den jeweiligen Entstehungsformen zu geordnet wurden. Plenum Lernprozesssicherung. Lektionsabschluss 05 Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 6 Raphael Signer 1.3 Arbeitsblatt Entstehung von Wüsten Es gibt drei mögliche Gründe für die Entstehung einer Wüste. Es lässt sich anhand dieser Gründe erklären, warum sich die Wüsten gerade dort auf der Erde befinden, wo sie eben sind. Die Entstehung einer Wüste hat immer mit Luft (bzw. Winden) und derer Temperatur zu tun. Aufrag: Suche nun im Weltatlas die ariden Gebiete. Fülle anschliessend die Namen der Wüsten in die Lücken der dazu passenden Beschreibung. Klimawüste: Sie befinden sich nördlich und südlich des Äquators. Durch die sinkende Luft der Passatwinde wird der Boden völlig ausgetrocknet und es fällt fast kein Regen. Beispiele für Klimawüsten sind:, ,, . Küstenwüsten: Sie befinden sich an der Westküste Afrikas, Süd- und Nordamerikas. Durch die kalten Meeresströmungen kommt kalte Luft mit wenig Feuchtigkeit auf das Festland, diese Luft wird dort erhitzt und entzieht dem Boden alle Feuchtigkeit. Ausser dem Tau am morgen gibt es auch fast keinen Regen. Beispiele für Küstenwüsten sind: , ,. Binnenwüsten: Sie befinden sich im Landesinnern. Meistens sind sie von hohen Gebirgen umringt. Die Luft steigt auf, um über die Gebirge hinweg zu kommen, dabei kühlt sich die Luft stark ab. Auf der anderen Seite erwärmt sich die Luft und saugt alle Feuchtigkeit aus dem Boden. Der Boden innerhalb des Gebirges trocknet aus. Beispiele für Binnenwüsten sind:,, , . Dieses Arbeitsblatt wurde für eine Realklasse gestaltet. Müsste eventuell angepasst werden. Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 7 Raphael Signer 1.4 Experiment Mit diesem Experiment kann das Wandern einer Düne veranschaulicht werden. Das Aufwirbeln des Sandes und die neue Ablagerung hinter der Düne, bewirkt eine langsame, aber dynamische Fortbewegung. Pro Jahr kann eine Düne 10 Meter zurück legen. Konstruktion: Es wird ein Plexiglasplatte auf einem festen Sockel montiert, in einem Abstand von ca. 8cm wird eine dunkle (schwarze) Platte ebenfalls parallel auf den Sockel befestigt. Oben wird die Konstruktion mit einem sehr feinen Netz abgeschlossen. Weiteres Utensil ist der Föhn. Erklärung: Mit dem Föhn kann der eingefüllte Sandhaufen angeblasen werden. Die „Düne wird nun abgetragen und schichtet sich wenige Zentimeter dahinter wieder auf. Mit wasserfestem Filzstift können die Bewegungen festgehalten werden. Schöpfer: Konstruiert und angefertigt wurde das hier gezeigte Modell von Florian Horath, Gebenstorf. Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 8 Raphael Signer 2. Lehrerinformationen 2.1 Wie entstehen Wüsten? Mit Ausnahme der Polargebiete kommen weitflächig zusammenhängende Trockengebiete zwischen 50 südlicher Breite und 55nördlicher Breite vor. Das Windsystem der Passate sind massgebliche Faktoren für die Wüstenbildung. So befinden sich die grössten Flächen von ariden Gebieten zwischen dem 15. und 35. Breitengrad der nördlichen bzw. südlichen Halbkugel. Es gibt aber nebst den Passaten zahlreiche andere Gründe die zur Wüstenbildung beitragen, wie Relief, Meeresströmungen, Gebiergsketten usw. Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Lagetypen von Wüsten.1 Passat- und Wendekreiswüsten „Sie liegen im Bereich der Wendekreise unter dem weltumspannenden Hochdruckgürtel der Rossbreiten. In den Rossbreiten selbst führt die hier dauernd absinkende Luft zu einer starken Erwärmung dieser Luftmassen, demzufolge zu fast ganzjähriger Wolkenlosigkeit, intensiver Sonneneinstrahlung, geringer relativer Luftfeuchte und schliesslich zu einer hochgradigen Bodenaustrocknung. Die äquatorwärts gerichtete Verfrachtung trockenheisser Luftmassen durch die Passatströmung führt überall dort zur Wüstenbildung, wo die Winde nur Festlandflächen überwehen und keine Gelegenheit erhalten, über Meeresflächen Feuchtigkeit aufzunehmen, 2 um diese dann abgeben zu können. Wüsten dieser Art sind: Sahara, Arabische Wüste, Wüste Lut, Trockengebiete Australiens Relief- oder Binnenwüsten „Überall dort, wo im humiden Klimabereich der Aussertropen – und das sind in der Regel in globaler Sicht immer die gemässigten Mittelbreiten der Westwindzone – aus Reliefgründen ein Regenschatteneffekt auftritt, der eine Austrocknung der Böden zur Folge hat, „werden die so entstandenen Trockengebiete dieser Kategorie zugerechnet.3 Wüsten dieser Art sind: Trockengebiete Nevadas (Great Basin und Death Valley), Wüste Gobi, Takla Makan, Turkestanische Wüste. Küstenwüsten „Wo in tropischen und subtropischen Breiten kalte Meeresströmungen als schmale Bänder an den Küsten der Kontinente vorbeiziehen – und dies ist nur an den Westküsten Nord- und Südamerikas sowie der Westküste im südlichen Afrika der Fall – da werden die feuchtheissen, landeinwärts strömenden Luftmassen durch die starke Abkühlung beim Überstreichen der kalten Strömungen schon über dem offenen Meer zur Kondensation (Nebel- und Wolkenbildung) und zum Ausregnen gezwungen. Erreichen die so ihrer Feuchtigkeit beraubten Luftmassen das Land, saugen sie hier den physikalischen Dampfdruckgesetzen folgend – wie Vampire auch noch das letzte 1 Eichler, 1999, S.129 Eichler, 1999, S.129 3 Eichler, 1999, S.130 2 Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 9 Raphael Signer Nass aus den küstennahen Landstrichen. Statt sie – wie an vielen Küsten der Erde der Fall – mit dem über dem Meer aufgenommenen Wasser zu übergiessen, verwandeln sie sie in Wüsten: in Küstenwüsten.4 Wüsten dieser Art: Atacama, Namib, Trockengebiete Niederkaliforniens. Achtung: nicht jede Wüste an der Küste muss auch zwingend eine Küstenwüste sein, Bedingung hierfür ist die kalte Meeresströmung!! Siehe auch Grafik im Lehrmittel „Die Erde auf Seite 228 2.2 Welche Wüstentypen gibt es? Durch die speziellen klimatischen Bedingungen in der Wüste, verfügen diese auch über ein spezifisches Relief. Die Formungskräfte Temperatur und Wasser haben einen besonderen Stellenwert. Felswüste (Hamada) Sie ist viel verbreiteter als die Sandwüste und erhält ihren Namen von der mit blockigem, kantigem Schutt- oder Felsmaterial dicht übersäten Oberfläche, die durch die physikalische Verwitterung hervorgerufen wird. Diese Wüstengebiete sind mit Fahrzeugen und selbst mit Kamelen kaum begehbar und gelten aufgrund der äusserst geringen Wasserreserven im Untergrund zu den lebensfeindlichsten Wüstengegenden. Pflanzen können sich nur in Felsspalten oder Klüften entwickeln. (arab. Hamada bedeutet: tot oder abgestorben) Kieswüste (Serir) Die Oberflächen der Kieswüsten verfügen über eine dichte Kies- oder Geröllschicht, die durch ihre identischen Korngrössen auffallen. Es gibt zwei mögliche Erklärungen für deren Entstehung. Man spricht von einer „autochthonen Bildung (vor Ort entstanden), wenn sich durch die Verwitterung von Konglomeraten (Sedimentgestein), die Bindemittel(Ton, Sand) vom Winde verweht werden, und nur die groben Körner zurückbleiben. Die häufigere Entstehungsform, erkennbar durch die runde Kieselform, sind ausgetrocknete Flussläufe, deren Ablagerung zurückgeblieben ist oder wasserverfrachtete Aufschüttungen im Vorland arider Gebierge. An gewissen Orten sind diese Serire ganz jung, meisten stammen sie aber aus Zeiten, als diese Gebiete noch feuchter waren. Die Kieswüsten dehnen sich in der Regel über nur kleine Räume aus (arab. Serir bedeutet: die Kleine). Sie sind normalerweise völlig vegetationslos, weil die Pflanzen keine Wurzeln bilden können. Dafür ist sie leicht begehbar. Sandwüste (Erg) Sandwüsten machen weltweit nur etwa 5 aller Wüstengebiete aus. Sie gleichen einem Meer von Sand, welches sich wellenartig fortbewegt. Die Rippel werden durch den vom Wind überlappenden Sand geformt. Die Gesteine der verschiedenen Sandwüsten können sehr verschieden sein und lassen sich auf den ersten Blick nur durch die Farbe unterscheiden. Auch das Alter hat einen Einfluss auf die Farbe: roter 4 Eichler, 1999, S.130 Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 10 Raphael Signer Sand ist meistens älter. Die Wasserhäufigkeit in Dünengebieten ist erstaunlich hoch. Für Kamele sind die Sandwüsten ideal zu durchwandern. Was man klären sollte: Die grösste Sandwüste ist nicht die Sahara, sondern die Rub al Khali auf der arabischen Halbinsel. Salzwüste (Sebka) Das durch den Niederschlag vorhandene Wasser verdunstet durch die grosse Hitze fortwährend. Dabei lösen sich die im Wasser vorhandenen Mineralien und verkrusten den Boden. Durch die Übersalzung der Böden wird jegliche Fruchtbarkeit vorweggenommen. Siehe auch Grafik im Lehrmittel „Die Erde auf Seite 230/231 Siehe auch Grafik im Lehrmittel „Mensch und Raum 2 auf Seite 70/71 2.3 Welches sind die formbildenden Kräfte in der Wüste? Temperaturschwankungen Die extremen Temperaturschwankungen in der Wüste führen zu einer mechanischen Verwitterung des Gesteins. Da sich gerade in Sedimentgesteinen nicht alle Materialien gleich schnell und stark ausdehnen, führt dies zu Spannungen die das Gestein spalten können. Auch kann es in der Nacht Temperaturen unter null Grad geben, was allfällige Feuchtigkeit zu gefrieren lässt. Da Wasser in festem Zustand 9% mehr Volumen beansprucht, führt dies zu Rissen im Gestein. Winde Die heftigen, trockenen Winde, die durch keine natürlichen Hindernisse gebremst werden, bearbeiten das Gestein wie mit Werkzeugen. Die feinen Sandpartikel polieren und schleifen mit der Kraft des Windes ganze Gesteinsbrocken und verwandeln diese auf Zeit in Sand. Winde aus der Sahara machen sich auch in Europa bemerkbar. Nicht selten ist es, dass wir in der Schweiz eine feine, rötliche Sandschicht auf dem Autodach oder den Gartenstühlen wahrnehmen. Diese Sandpartikel werden vom Saharawind „Schirokko bis in unsere Breitengrade verstreut. Wasser Gibt es in der Wüste einmal einen Niederschlag, verändert sich das Bild der Wüste schlagartig. Das Wasser kann auf dem ausgetrockneten und verkrusteten Boden nicht versickern. Es sammeln sich riesige Wassermassen, die wie eine Flutwelle die geröllbeladenen Hänge hinab donnern. Der feine Sand vermischt sich mit dem Wasser und wird zu einer zerstörerischen galertartigen Substanz. Nachdem das Wasser verdunstet ist, kann zum Beispiel eine Kieswüste zurückbleiben (Serir). Das Wasser kann auch kontraproduktiv auf die Vegetation wirken. Wenn Wasser nämlich verdunstet bleiben die Mineralien zurück, welche den Boden versalzen. Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 11 Raphael Signer 2.4 Gibt es Pflanzen in der Wüste? Obwohl es in der Wüste kaum regnet und kaum Wasser hat, gibt es zahlreiche Pflanzen in diesen trockenen Gebieten. Es gibt 2 Gruppen von Wüsten-Pflanzentypen: • mehrjährige • einjährige Die mehrjährigen Pflanzentypen Die mehrjährigen Pflanzentypen gehören zur Dauervegetation. Sie sind immer vorhanden. Sie können verdorren und überleben so auch Zeiten ohne Wasser. Während dieser Zeit wachsen sie aber nicht. Sie haben dicke, ledrige Blätter, in welchen sie Wasser speichern können. Meistens haben sie aber davon nur wenige, weil Blätter Energie verbrauchen. Andere haben anstelle von Blättern Stacheln, mit welchen sie am Morgen die Feuchtigkeit der Luft binden können; es bildet sich Tau. Auch haben sie ganz tiefe und fein verästelte Wurzeln, die bis ins Grundwasser reichen und viel Wasser aufsaugen können. Die einjährigen Pflanzentypen Die einjährigen Pflanzentypen gehören zu den dürreempfindlichen Pflanzen. Man sieht sie nicht, denn sie liegen als Samen oder als Zwiebel während Jahren unter dem Boden. Wenn es aber regnet, spriessen sie innert wenigen Stunden aus dem Boden und blühen in bunten Farben. Deshalb verwandelt sich die Wüste nach einem Regenguss in ein farbiges Blumenmeer. Nach kurzer Zeit verdorren die Blüten und sie versamen. Die Samen werden vom Wind über weite Strecken verteilt und lagern sich erneut am Boden ab. Die Wüste ist wieder öde, scheinbar ohne Pflanzen, bis zum nächsten Regen. Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 12 Raphael Signer 2.5 Wie passen sich die Tiere an? Temperaturen in Bodennähe Die Temperaturen in der Bodennähe nehmen sowohl nach oben als auch nach unten stark ab. Dies ist ein entscheidender Grund dafür, dass Tiere überhaupt in der Wüste leben können. In der Abbildung sehen wir, wo die Tiere sich aufhalten und welche Temperaturen dort am Tage herrschen. Abb. Eichler. 1999. S.179 Dank den langen Beinen und dem langen Hals des Kamels, befindet sich der grösste Teil seines Körpers über 1 Meter, der Kopf sogar über 2 Meter. Dort ist es schon 35 C kühler als an der Bodenoberfläche. Die Schlange befindet sich auf einem 1 Meter hohen Busch, dadurch gewinnt auch sie 25C an kühlere Luft, als eine Eidechse am Boden. Dort ist es nämlich 75C heiss. Die Maus, die sich in der Höhle 1 Meter unter dem Boden aufhält, hat sogar nur 30C warm, so wie bei uns im Sommer. Bei 75C Hitze würde es ausser einem Reptil oder einem Insekt kein Tier aushalten, Durch die Tatsache, dass die Temperaturen gegen oben und unten so stark abnehmen, können auch kleinere Säugetiere gut in der Wüste überleben. Nachts, wenn die Temperaturen bis null Grad sinken, werden sie aktiv und gehen auf Futtersuche. Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 13 Raphael Signer 2.6 Woher kommt der Sand? Die riesigen Sandmengen lagern an den Talausgängen arider Gebirge. Es handelt sich dabei um die Ablagerungen von erodierten Schuttmassen die von Flüssen oder Winden transportiert wurden. Von geringerer Bedeutung ist die Entstehung vor Ort durch Verwitterung und Gesteinszerfall, ausser es handelt sich bei dem Gestein selbst um Sandstein. Dies ist beispielsweise in der Wüste Rub al Khali der Fall, wo der nubische Sandstein als wesentliche Quelle der Versandung zu nennen ist. Wüsten können auch wandern. Sogenannte Barchane sind Dünen, die durch den Wind vorangetrieben werden. Sie können bis 10 Meter pro Jahr wandern. Für die Zivilisation können sie auch eine erhebliche Bedrohung darstellen, denn diese Sandriesen lassen sich nicht aufhalten und gelangen auch in die hintersten Winkel, wo sie Vegetation und Gebäude gnadenlos begraben. Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 14 Raphael Signer Quellen Eichler, Horst. Gesichter der Erde. Hannover. 1999 Erzner, Franz. Mensch und Raum 2. Berlin. 1999 Jätzold, Ralph andere. Physische Geographie und Nachbarwissenschaften. München. 1986 Kugler, Astrid. Die Erde. Unser Lebensraum. Zürich. 1999 Arbeitsmappe zur Klimazone „Wüste 15 Raphael Signer