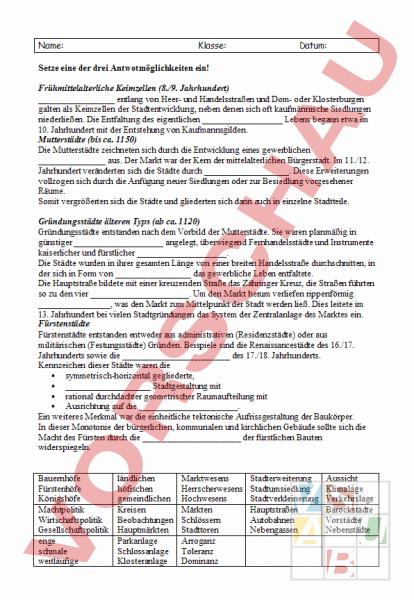Arbeitsblatt: Historische Stadttypen
Material-Details
Lückentext mit Lösung
Geographie
Anderes Thema
9. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
23182
835
3
07.08.2008
Autor/in
montey1 (Spitzname)
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Name: Klasse: Datum: Setze eine der drei Antwotmöglichkeiten ein! Frühmittelalterliche Keimzellen (8./9. Jahrhundert) entlang von Heer- und Handelsstraßen und Dom- oder Klosterburgen galten als Keimzellen der Stadtentwicklung, neben denen sich oft kaufmännische Siedlungen niederließen. Die Entfaltung des eigentlichen Lebens begann etwa im 10. Jahrhundert mit der Entstehung von Kaufmannsgilden. Mutterstädte (bis ca. 1150) Die Mutterstädte zeichneten sich durch die Entwicklung eines gewerblichen aus. Der Markt war der Kern der mittelalterlichen Bürgerstadt. Im 11./12. Jahrhundert veränderten sich die Städte durch. Diese Erweiterungen vollzogen sich durch die Anfügung neuer Siedlungen oder zur Besiedlung vorgesehener Räume. Somit vergrößerten sich die Städte und gliederten sich dann auch in einzelne Stadtteile. Gründungsstädte älteren Typs (ab ca. 1120) Gründungsstädte entstanden nach dem Vorbild der Mutterstädte. Sie waren planmäßig in günstiger angelegt, überwiegend Fernhandelsstädte und Instrumente kaiserlicher und fürstlicher . Die Städte wurden in ihrer gesamten Länge von einer breiten Handelsstraße durchschnitten, in der sich in Form von das gewerbliche Leben entfaltete. Die Hauptstraße bildete mit einer kreuzenden Straße das Zähringer Kreuz, die Straßen führten so zu den vier . Um den Markt herum verliefen rippenförmig , was den Markt zum Mittelpunkt der Stadt werden ließ. Dies leitete im 13. Jahrhundert bei vielen Stadtgründungen das System der Zentralanlage des Marktes ein. Fürstenstädte Fürstenstädte entstanden entweder aus administrativen (Residenzstädte) oder aus militärischen (Festungsstädte) Gründen. Beispiele sind die Renaissancestädte des 16./17. Jahrhunderts sowie die des 17./18. Jahrhunderts. Kennzeichen dieser Städte waren die • symmetrisch-horizontal gegliederte, • Stadtgestaltung mit • rational durchdachter geometrischer Raumaufteilung mit • Ausrichtung auf die . Ein weiteres Merkmal war die einheitliche tektonische Aufrissgestaltung der Baukörper. In dieser Monotonie der bürgerlichen, kommunalen und kirchlichen Gebäude sollte sich die Macht des Fürsten durch die der fürstlichen Bauten widerspiegeln. Bauernhöfe Fürstenhöfe Königshöfe Machtpolitik Wirtschaftspolitik Gesellschaftspolitik enge schmale weitläufige ländlichen höfischen gemeindlichen Kreisen Beobachtungen Hauptmärkten Parkanlage Schlossanlage Klosteranlage Marktwesens Herrscherwesens Hochwesens Märkten Schlössern Stadttoren Arroganz Toleranz Dominanz Stadterweiterung Stadtumsiedlung Stadtverkleinerung Hauptstraßen Autobahnen Nebengassen Aussicht Klimalage Verkehrslage Barockstädte Vorstädte Nebenstädte Lösung: Setze eine der drei Antwotmöglichkeiten ein! Frühmittelalterliche Keimzellen (8./9. Jahrhundert) Königshöfe_entlang von Heer- und Handelsstraßen und Dom- oder Klosterburgen galten als Keimzellen der Stadtentwicklung, neben denen sich oft kaufmännische Siedlungen niederließen. Die Entfaltung des eigentlichen gemeindlichenLebens begann etwa im 10. Jahrhundert mit der Entstehung von Kaufmannsgilden. Mutterstädte (bis ca. 1150) Die Mutterstädte zeichneten sich durch die Entwicklung eines gewerblichenMarktwesens_aus. Der Markt war der Kern der mittelalterlichen Bürgerstadt. Im 11./12. Jahrhundert veränderten sich die Städte durch Stadterweiterung. Diese Erweiterungen vollzogen sich durch die Anfügung neuer Siedlungen oder zur Besiedlung vorgesehener Räume. Somit vergrößerten sich die Städte und gliederten sich dann auch in einzelne Stadtteile. Gründungsstädte älteren Typs (ab ca. 1120) Gründungsstädte entstanden nach dem Vorbild der Mutterstädte. Sie waren planmäßig in günstiger Verkehrslageangelegt, überwiegend Fernhandelsstädte und Instrumente kaiserlicher und fürstlicher Machtpolitik. Die Städte wurden in ihrer gesamten Länge von einer breiten Handelsstraße durchschnitten, in der sich in Form von Hauptmärktendas gewerbliche Leben entfaltete. Die Hauptstraße bildete mit einer kreuzenden Straße das Zähringer Kreuz, die Straßen führten so zu den vier Stadttoren. Um den Markt herum verliefen rippenförmig Nebengassen, was den Markt zum Mittelpunkt der Stadt werden ließ. Dies leitete im 13. Jahrhundert bei vielen Stadtgründungen das System der Zentralanlage des Marktes ein. Fürstenstädte Fürstenstädte entstanden entweder aus administrativen (Residenzstädte) oder aus militärischen (Festungsstädte) Gründen. Beispiele sind die Renaissancestädte des 16./17. Jahrhunderts sowie die Barockstädtedes 17./18. Jahrhunderts. Kennzeichen dieser Städte waren die • symmetrisch-horizontal gegliederte, • weitläufigeStadtgestaltung mit • rational durchdachter geometrischer Raumaufteilung mit • Ausrichtung auf die Schlossanlage. Ein weiteres Merkmal war die einheitliche tektonische Aufrissgestaltung der Baukörper. In dieser Monotonie der bürgerlichen, kommunalen und kirchlichen Gebäude sollte sich die Macht des Fürsten durch die Dominanzder fürstlichen Bauten widerspiegeln.