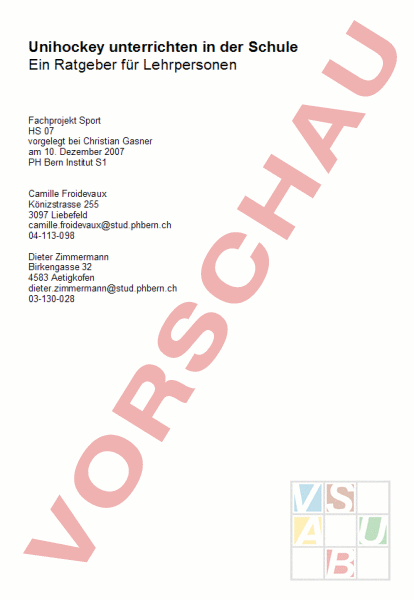Arbeitsblatt: Unihockey unterrichten in der Schule - ein Ratgeber für Lehrpersonen
Material-Details
Projektarbeit
Bewegung / Sport
Spiel
klassenübergreifend
23 Seiten
Statistik
24180
1913
86
26.08.2008
Autor/in
Dieter Zimmermann
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Unihockey unterrichten in der Schule Ein Ratgeber für Lehrpersonen Fachprojekt Sport HS 07 vorgelegt bei Christian Gasner am 10. Dezember 2007 PH Bern Institut S1 Camille Froidevaux Könizstrasse 255 3097 Liebefeld 04-113-098 Dieter Zimmermann Birkengasse 32 4583 Aetigkofen 03-130-028 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 3 1.1 Unihockey als attraktive Sportart für die Schule . 3 1.2 Ziele und Aufbau dieser Arbeit . 4 1.3 Grundlagen zum Unihockey-Spiel 6 2. Unihockey in der Schule 7 2.1 Didaktische Grundüberlegungen 7 2.2 Organisation . 8 2.2.1 Grundannahmen 8 2.2.2 Vor Lektionsbeginn 9 2.2.3 Mannschaften 10 2.2.4 Torhüter/in . 14 2.2.5 Schiedsrichter/in 16 2.2.6 Material 18 2.3 Eine Quartalsplanung . 19 2.3.1 Aufbau einer Lektion 19 2.3.2 Allgemeine Bemerkungen zur längerfristigen Planung 22 2.3.3 Übersicht Quartalsplanung Unihockey. Fehler! Textmarke nicht definiert. 2.3.4 Lektionspräparationen . Fehler! Textmarke nicht definiert. 2.4 Material: Empfehlungen für die Schule . Fehler! Textmarke nicht definiert. 3. Zusammenfassung: Unihockey unterrichten auf einen Blick Fehler! Textmarke nicht definiert. 4. Bibliografie Fehler! Textmarke nicht definiert. 5. Anhang Fehler! Textmarke nicht definiert. 5.1 Umfrage Fehler! Textmarke nicht definiert. 5.2 Lösungen zum Quiz Fehler! Textmarke nicht definiert. 5.3 Unihockeyregeln für die Schule Fehler! Textmarke nicht definiert. 1. Einleitung 1.1 Unihockey als attraktive Sportart für die Schule Unihockey hat in den letzten 20 Jahren in der Schweiz eine rasante Verbreitung erlebt. Seit die Schweiz zusammen mit Finnland und Schweden im Jahr 1986 den internationalen Unihockey-Verband IFF (International Floorball Federation) gründete, hat sich die junge Spielsportart in der schweizerischen Sportszene etablieren können.1 Der Schweizerische Unihockey-Verband (swiss unihockey) zählt mittlerweile über 29�00 Lizenzierte, die in über 2�00 Teams von rund 440 Vereinen dem Unihockey-Spiel nachgehen.2 Rund 5�00 der Lizenzierten sind Frauen.3 Unihockey steht damit nach Fussball mit rund 230�00 Lizenzierten4 und Volleyball mit etwa 40�00 Lizenzierten5 an dritter Stelle. Im Gegensatz zu diesen Zahlen steht jedoch eine relativ geringe Medienpräsenz, vor allem im nationalen Rahmen.6 Es sind nicht die Anzahl der Lizenzen oder die Medienpräsenz, die eine Sportart auch für die Schule geeignet machen. Unihockey bietet sich jedoch für einen allgemeinen Spiel-Unterricht in der Schule vorzüglich an7: • • • • • Unihockey braucht kaum Vorkenntnisse und kann sofort gespielt werden. Regeln und Spielmaterial sind einfach. Als Mannschaftssport fördert Unihockey das soziale Lernen. Unihockey ist sowohl für Mädchen als auch für Jungen geeignet. Im Unihockey-Spiel kommen die Leistungsunterschiede zwischen den Jugendlichen weniger zum Tragen, da „() geschicktes Positionsspiel läuferische Mängel ausgleichen hilft der Spielstock als Armverlängerung ein grosses Aktionsfeld besitzt der Charakter des Balles dem Spiel unberechenbare Komponenten verleiht ausgesprochene physische Eigenschaften wie Körpergrösse oder Sprungkraft eine weniger zentrale Rolle einnehmen der Lerneffekt in der direkten Anwendung relativ gross ist8 Die grosse Beliebtheit und Verbreitung von Unihockey als Schulsport wird sogar als Grund gesehen, dass sich diese junge Sportart auf der Ebene des Leistungssports etablieren konnte.9 Die Attraktivität von Unihockey als Schulsport und unser persönlicher Hintergrund sowohl als Sportlehrkräfte wie auch als aktive Sportler/innen haben uns dazu bewogen, uns detaillierte Überlegungen zum Unterrichten von Unihockey in der Schule zu machen und diese festzuhalten. 1 Eine genaue Aufzeichnung der Entwicklung des Unihockeys in der Schweiz liefert der Bericht „Unihockey in der Schweiz von Marc Eilinger, online verfügbar unter www.swissunihockey.ch/weblounge/repository/trainerausbildung/anmeldung/Unihockey%20in%20der%20Schweiz.pdf. Darin wird zum Beispiel ersichtlich, dass die Anzahl der Lizenzierten vor allem in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre stark angestiegen und mittlerweile wieder etwas abgeflacht ist. 2 Pressekonfenrenz von swiss unihockey vor Beginn der Saison 2007/08: 29.10.2007 3 www.swissunihockey.ch/weblounge/repository/Label/Foerderstruktur%20Damen.pdf 4 29.10.2007 5 29.10.2007 6 www.swissunihockey.ch/weblounge/repository/trainerausbildung/anmeldung/Popularitaet.pdf 7 Nach mit eigenen Überlegungen ergänzt. 8 11.11.2007 9 Praxisbeilage von Sporterziehung in der Schule: „Unihockey – ein ideales Spiel für den Sportunterricht, unter downloadbar. 1.2 Ziele und Aufbau dieser Arbeit Eine kleine Umfrage unter den Studentinnen und Studenten der Veranstaltung „Fachprojekt bestätigte die Vermutung, dass Unihockey und Spielsportarten im Allgemeinen in der Beliebtheitsskala von Sportlehrpersonen zum Unterrichten deutlich obenaus schwingen.10 Das Unterrichten von Sportspielen scheint für angehende Sportlehrkräfte kein Problem zu sein. Zahlreiche Übungssammlungen, neuere Lehrmittel und gut ausgebaute Informationsmöglichkeiten auf dem Internet (hier ist besonders das Projekt Unihockey online11 von swiss unihockey zu nennen) liefern gute Anregungen. Swiss unihockey bietet zudem speziell für Lehrpersonen eine Internetseite mit Übungen und Informationen an, so auch zum nationalen Schülerinnen- und Schülerturnier im Unihockey, den Rivella Games.12 Die Palette der Lehrmittel und Literatur, in der hauptsächlich Technik, Taktik und Spielübungen vorgestellt werden, wird durch ein Handbuch, welches den Ursprüngen des (Uni)Hockeys nachgeht und die didaktische Struktur des Unihockeys aufzeigt, ergänzt.13 Wieso sich also im Rahmen dieses Fachprojekts mit beschränkten zeitlichen Möglichkeiten mit Unihockey befassen, wenn scheinbar kein Bedarf dafür besteht, da sich einerseits Lehrkräfte im Unterrichten sicher fühlen und andererseits auch bereits viele Unterrichtsmaterialien verfügbar sind? Diese Frage ist durchaus berechtigt. Von den bereits bestehenden Materialien unterscheidet sich unsere Arbeit jedoch durch die konsequente Ausrichtung auf Unihockey als Schulsport. Unsere Zielsetzung besteht in der Erarbeitung eines Ratgebers, welcher sich mit den Herausforderungen des Unterrichtens in der Turnhalle, sozusagen direkt „an der Front, befasst und dafür Lösungen anbieten kann. Der Erfolg von Unterricht und das Gelingen einer Sportstunde wird unserer Meinung nach nicht unwesentlich durch die Vorbeugung und Problemlösestrategien der „kleinen Probleme vor Ort beeinflusst. Diese „kleinen Probleme lauten im Unihockey-Unterricht zum Beispiel wie folgt: • • • Eine Schüleraussage: „Herr Zimmermann, diesen verschwitzen Torhüterhelm ziehe ich sicher nicht an! Ausserdem habe ich sowieso keine Lust, ins Tor zu gehen. 25 Knaben, sprühend vor Energie, drängen sich in eine Einfach-Turnhalle. Martin, Andrea und Marko spielen im Unihockey-Club und lassen sich während dem Spiel nie auswechseln. Zu diesen oder ähnlichen Problemen, die durch die spezifische schulische Situation des Sportunterrichts zustande kommen und die in Vereinstrainings wenn überhaupt nur in sehr abgeschwächter Form auftreten, nehmen die Autoren der zitierten Lehrmittel nur sehr knapp oder gar nicht Stellung.14 Ihre Überlegungen sind mehrheitlich auf freiwillige Trainings in einigermassen leistungshomogenen und interessensgeleiteten Gruppen ausgerichtet, welche nicht mit dem obligatorischen Sportunterricht an einer Schule verglichen werden können. Das bestehende Angebot an Literatur zum Unihockey-Unterricht für Sportlehrpersonen weist unserer Einschätzung nach vor allem diese konkreten Angebotslücke auf: Die Lösung der 10 Modul „Fachprojekt Sport, LLB-Studiengang, Fachausbildung Sport Institut Sekundarstufe 1, Pädagogische Hochschule Bern. Resultate siehe Anhang. 12 und 13 Frank-Thiele (2001) 14 Ersichtlich zum Beispiel in „Unihockey basics, in welchem das Thema „Mannschaftsgrösse nur in drei allgemeinen Sätzen behandelt wird (S. 123). 11 oben beschriebenen beispielhaften „kleinen Probleme des Unihockey-Unterrichts in der Schule. Mit dieser Arbeit möchten wir diese Lücke zu schliessen versuchen. Die aufgelisteten Situationen ergeben sich nicht nur im Unihockey-Unterricht, sondern treten in ähnlicher Form allgemein bei Sportspielen auf, so dass wir uns persönlich von dieser Arbeit einen allgemeinen Wissenszuwachs für das Unterrichten von Sportspielen erhoffen. Denn: Sportspiele unterrichten heisst nicht, den Schülerinnen und Schülern einen Ball und zwanzig Schläger aus dem Geräteraum zu holen, sich eine Pfeife um den Hals zu hängen und Tore zu zählen. Sportspiele unterrichten heisst, geschickt die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu planen, sie vor herausfordernde Spielsituationen zu stellen, sie soziale und gruppendynamische Aspekte erleben zu lassen, sie auf die körperlichen Anforderungen vorzubereiten und nicht zuletzt alle organisatorischen Aspekte im Griff zu haben. Das ist alles andere als einfach und simpel. Die vorangegangenen Erläuterungen sollten gezeigt haben, dass für das Unterrichten von Unihockey grundsätzlich eine gute Auswahl an Materialien besteht. Je grösser die Fülle, desto schwieriger gestaltet sich jedoch auch der Überblick und die adäquate Auswahl. Fragen bezüglich des Aufbaus einer einzelnen Lektion und der längerfristigen Planung beschäftigen Lehrpersonen und bedingen eine zeitaufwendige Auseinandersetzung mit dem Thema. Mit Erläuterungen zum Aufbau einer einzelnen Stunde und einer exemplarischen Quartalsplanung möchten wir als zweites Ziel auch zu diesen Fragen schulbezogene Antworten liefern. Mit dieser doppelten Zielsetzung deckt sich der Aufbau der Arbeit. Im Kapitel 2, Unihockey in der Schule, erfolgt nach einigen kurz gehaltenen didaktischen Grundüberlegungen (2.1) die Diskussion von organisatorischen Aspekten (2.2), denen wir ein grosses Gewicht zugemessen haben und die wir jeweils mit Lösungsmöglichkeiten abschliessen. Aufbau und Planung werden in 2.3 diskutiert und mit einer Quartalsplanung konkretisiert. Kapitel 3 schliesslich führt zusammenfassend die wichtigsten Punkte nochmals auf. In Kapitel 4 finden sich die bibliografischen Angaben der verwendeten Literatur. Der Anhang besteht aus weiteren für die Schule nützlichen Materialien aus dem bestehenden Angebot. 1.3 Grundlagen zum Unihockey-Spiel Geschichte Die Wurzeln des Unihockeys finden sich in zahlreichen Stockballspielen wie Feldoder Eishockey, die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts in verschiedenen Ländern gespielt wurden. Fünf Jahre nach der Gründung des ersten nationalen UnihockeyVerbandes in Schweden gründete die Schweiz zusammen mit Finnland und eben Schweden den internationalen Unihockey-Verband IFF (International Floorball Federation). Die ersten offiziellen Regeln wurden 1983 aufgestellt. Seit 2004 ist die IFF ordentliches Mitglied im internationalen Verband der Sportverbände (GAISF). Unihockey ist zurzeit keine olympische Sportart.15 Grundlagen des Unihockey-Spiels Unihockey wird in der Halle als Mannschaftssportart gespielt. Als Grundausstattung braucht es Schläger, einen Ball und zwei Tore. Ziel ist es, möglichst viele Tore zu schiessen. Je nach Alter und Niveau der Spieler/innen wird im Leistungssport auf zwei Spielfeldgrössen gespielt: Dem Kleinfeld (24mx14m) einerseits, und andererseits dem Grossfeld (40mx20m), wobei dieses mit einer 50cm hohen Bande aus einzelnen ineinander verkeilbaren Kunststoffelementen umgeben ist. In den Ecken ist die Bande abgerundet. Auf dem Grossfeld stehen sich jeweils fünf Feldspieler/innen und ein/e Torhüter/in gegenüber; auf dem Kleinfeld wird mit drei Spieler/innen und einem Torhüter oder einer Torhüterin gespielt. Je nach Spielklasse variiert auch die Spieldauer. In den oberen Ligen beträgt die effektive Spielzeit 60 Minuten und ist in drei Drittel à je 20 Minuten aufgeteilt. Auf die Einhaltung der Regeln achten bis zu zwei Schiedsrichter/innen. Die genauen offiziellen Spielregeln sind im Internet zu finden.16 15 Informationen aus dem Starter Kit des Internationalen Unihockeyverbandes IFF. Die Broschüre ist downloadbar unter 16 2. Unihockey in der Schule 2.1 Didaktische Grundüberlegungen Die Inszenierung von Spielen in der Schule Das Spiel ist für die Spielenden eine in sich geschlossene und gestaltete Zeitspanne, die sich vom restlichen Leben abhebt.17 Die spezifische Situation des Sportunterrichts bedingt eine adäquate Anpassung der offiziellen Spielregeln einer Sportart für die Schule. Wie diese im Einzelnen aussehen, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Grundsätzlich kann jedes Spiel durch die Gestaltung der Spielstruktur verändert werden. Folgende Instrumente und Variabeln können das Spiel regulieren18: • • • • • • Spielidee Regeln und Spielhandlungen Anzahl Spieler/innen Spielfeldgrösse Material Zeit Anpassung der offiziellen Spielregeln von Unihockey für die Schule Mit Hilfe der genannten Instrumente kann das Unihockey-Spiel an die Zielsetzung des Unterrichts und an die Voraussetzungen der Jugendlichen angepasst werden. Als Spielfeldgrösse kommt in der Schule vor allem das Kleinfeld, allenfalls nochmals in zwei Felder unterteilt, zum Zuge. Das Kleinfeld wird in einer Einfachturnhalle oder einem einzelnen Drittel einer Dreifachturnhalle im Normalfall nicht mit Bodenmarkierungen angegeben, sondern definiert sich auf allen vier Seiten durch die Hallenwände. In den Ecken werden Langbänke aufgestellt, um auch dort ein Bandenspiel zu ermöglichen. Die weiteren organisatorischen Bestimmungen wie Spieldauer, Strafen bei Foulspiel usw. bei regulären Unihockeyspielen sind für die Schule von geringer Bedeutung. Sie können mit motivierten und fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern bei Interesse in den Unterricht eingebaut werden, gehen aber über die Anforderungen an den Sportunterricht in der Schule hinaus. Leistungshomogene oder leistungsheterogene Gruppen Der in der Einleitung aufgeführte Grund für die Eignung von Unihockey in der Schule – Leistungsunterschiede zwischen den Jugendliche kommen weniger stark zum Tragen – darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich auch im Unihockey sichtbare Niveauunterschiede bestehen, die ein Spiel sehr wohl beeinflussen können. Gerade weil Unihockey unter den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 1 ein beliebter Freizeitsport ist, sind die Voraussetzungen und Vorkenntnisse sehr unterschiedlich. Schwächere Schüler/innen können von den Stärkeren profitieren, von ihnen jedoch auch unter Druck geraten. Umgekehrt sollen stärkere Spieler/innen bewusst lernen, auch ihre schwächeren Mitspieler/innen zu integrieren, müssen dadurch jedoch meist 17 18 Lehrmittel Sporterziehung, Band 1, Broschüre 5, S. 2. nach ders., S. 6, und Skript Grundlagen des Spiels und der Sportspiele, S. 20 ihr eigenes Leistungsvermögen zurückstellen. Aus unserer Sicht bietet sich im Unihockey an, in Übungsphasen alle Schüler/innen zusammen zu unterrichten, im Spiel jedoch leistungshomogene Teams oder Blöcke zu bilden. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass sich die Schüler/innen zuerst nach eigenem Empfinden entweder auf Spielfeld oder auf Spielfeld begeben, wo dann je ein Spiel stattfindet. Spielfeld ist für diejenigen Schüler/innen, welche sich ein intensives Spiel wünschen; Spielfeld für leistungsschwächere Schüler/innen. Bei leistungshomogenen Blöcken treffen jeweils die besseren Spieler/innen der einen Mannschaft auf die besseren Spieler/innen des Gegners. In jedem Fall sollen die beiden sich gegenüberstehenden Mannschaften in etwa ausgeglichen besetzt sein. 2.2 Organisation Organisatorische Herausforderungen einer Sportlektion lassen sich nicht bis ins Detail voraussehen, planen und mit allgemeinen Lösungen überwinden. Vieles hängt von der vorhandenen Infrastruktur, vom Verhältnis der Lehrperson zu den Schülerinnen und Schülern, dem Charakter der Lehrperson und weiteren nicht zu verallgemeinernden Faktoren ab. Im Rahmen dieser Arbeit müssen wir einige Grundannahmen treffen, die vielleicht vom konkreten Unterrichtsfall etwas abweichen, jedoch auf durchschnittliche Verhältnisse übertragbar sein sollten. Des Weiteren sind zwar nicht alle, jedoch sehr viele der organisatorischen Probleme (und damit verbunden disziplinarische Schwierigkeiten, ein geringerer Lerneffekt für die Schüler/innen, ineffiziente Zeitnutzung, usw.) durch eine gezielte Planung und durchdachte Inszenierung umgehbar. 2.2.1 Grundannahmen Wir gehen grundsätzlich einzig davon aus, dass für den Sportunterricht eine normale Turnhalle mit den ungefähren Massen 25m 15m (ein Drittel einer Dreifachturnhalle) zur Verfügung steht. Diese Fläche entspricht ungefähr den Massen eines Kleinfeldes. Erfahrungsgemäss sind Unihockeyschläger in fast jeder Turnhalle vorhanden; unklar ist natürlich deren Zustand. Wenn möglich sollte eine grosse Anzahl (mindestens so viele wie Schüler/innen) von Unihockeybällen bereitstehen. Die Überlegungen gelten, wenn nicht anders gekennzeichnet, sowohl für Mädchen als auch für Jungen. 2.2.2 Vor Lektionsbeginn Material Vor jeder Unterrichtseinheit Unihockey ist es wichtig, das Sportmaterial rasch zu kontrollieren. Die Schläger und Bälle, der Torhüterhelm und allfällige weitere Torhüterausrüstung sind in den meisten Fällen in einem Schrank eingeschlossen, so dass die Lehrperson das Material vor der Stunde hervornehmen muss und in der Turnhalle bereitstellen kann. Die Anzahl der Bälle sollte mindestens der Anzahl Schüler/innen entsprechen, besser ist es, noch einige Ersatzbälle bereit zu halten. Ebenso braucht jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin einen Schläger, wobei hier die links- oder rechtsseitige Biegung zu beachten ist. Erfahrungsgemäss beträgt das Verhältnis von links spielenden zu rechts spielenden Spieler/innen ungefähr drei Viertel zu ein Viertel.19 Ausschlaggebend für die Bezeichnung ist die untere Hand am Schaft des Schlägers; Rechtshänder/innen spielen meist mit einem linksseitig gebogenen Stock. Es ist ausserdem zu erwarten, dass einige Schülerinnen und Schüler einen eigenen Stock in den Sportunterricht mitbringen werden. Für die Schiedsrichterrolle sollte zudem eine Trillerpfeife vorhanden sein. Verhaltensregeln Neben der Materialkontrolle und –herausgabe ist es unerlässlich, mit den Schülerinnen und Schülern Verhaltensregeln abzumachen, die in den Minuten in der Turnhalle vor Lektionsbeginn zu tragen kommen. Die Antwort auf die grundsätzliche Frage, ob das Material bereits von der Lehrperson zur Verfügung gestellt werden soll oder nicht, haben wir mit dem oberen Abschnitt schon vorweggenommen: Wir sind der Meinung, dass es mit entsprechenden Regeln machbar und sinnvoll ist, die Zeit vor Lektionsbeginn zu nutzen und den Schülerinnen und Schülern einen selbstverständlichen Umgang mit Ball und Schläger zu ermöglichen. Ausserdem werden so die Jugendlichen, welche keinen eigenen Schläger mitbringen, nicht benachteiligt. Schläger sollen in genügender Anzahl bereitgestellt werden, jedoch erst ein einzelner Ball pro zwei Schüler/innen, um das Zusammenspiel zu fördern und ein Abschiessen zu verhindern. Die Tore bleiben ebenfalls noch im Geräteraum, um die Verletzungsgefahr durch starke Schüsse einzudämmen. Verhaltensregeln vor Lektionsbeginn sind somit: 19 • Vor Lektionsbeginn darf zu zweit mit einem Ball das Passen geübt werden. Dazu kann auch ein genauerer Auftrag formuliert werden, zum Beispiel Passen im Laufen. Es sollen Übungsformen gewählt werden, welche bereits eingeführt wurden und welche die Jugendlichen nun einüben sollen. • Der Pfiff der Lehrperson ist das Signal zum Lektionsbeginn. Ab diesem Zeitpunkt wird nicht mehr mit dem Ball gespielt. Die Lehrperson gibt die Anweisung, wohin die Bälle gespielt werden sollen, danach begeben sich die Schüler/innen in ihre Nähe, wo die Lehrperson nun die Lektion eröffnen kann. Erst jetzt werden bei Bedarf die Tore und in den Spielfeld-Ecken vier Langbänke im 45-Winkel aufgestellt. Beutler/Wolf (2004), S. 128. Die meisten Stock-Sets für die Schule weisen dieses Verhältnis zwischen linksseitig und rechtsseitig gebogenen Schaufeln aus. • Es ist verboten, Mitschüler/innen abzuschiessen. 2.2.3 Mannschaften Bestimmung der Gruppenzusammensetzung In einem Spiel in der Schule sollen sich zwei ähnlich starke Teams gegenüberstehen. Die Lehrperson ist somit bemüht, die Schülerinnen und Schüler ihren Fähigkeiten entsprechend möglichst gleichmässig auf die Mannschaften zu verteilen. Dafür hat sie verschiedene Möglichkeiten, die einen unterschiedlichen Grad an Einbezug der Schüler/innen auf den Entscheid aufweisen: • Beim Einspielen beobachtet die Lehrperson die Schüler/innen und verteilt Bändeli. Dabei ist es wichtig, bestimmt aufzutreten und sich durch Schülerwünsche nicht beeinflussen zu lassen. • Zwei Schüler/innen, die sich etwa gleich stark einschätzen, bilden ein Paar. Jeweils ein Mitglied des Paares wird einer Mannschaft zugeteilt. • Die Gruppenzugehörigkeit wird durch das Zufallsprinzip entschieden. Dabei kann ein für die sportliche Leistung irrelevantes Kriterium (Hausnummer, Haarfarbe, Losentscheid usw.) gewählt werden, welches zu stark zufallsgeprägten und somit unausgeglichenen Teams führen kann, oder ein Kriterium wie Körpergrösse oder Alter, bei welchen eine gewisse Ausgeglichenheit in der Durchmischung der Mannschaften zustande kommt. Wenn das Zufallsprinzip angewendet werden soll, können grosse Ungleichheiten auch dadurch vermieden werden, dass beispielsweise starke Spieler/innen oder Jungen und Mädchen gleichmässig auf die Teams verteilt werden und somit aus dem „Zufallstopf herausgenommen werden. • Einige Zugehörigkeitskriterien bewirken eine Anspornungssituation: „Alte gegen Junge; Knaben gegen Mädchen (ev. mit Unterstützung einiger Knaben) usw. • Besitzen die Schülerinnen und Schüler ein gutes Einschätzungsvermögen ihrer spielerischen Fähigkeiten und besteht in der Klasse eine gut entwickelte Diskussionskultur, kann die Gruppenbildung mit dem klaren Auftrag, gleich starke Mannschaften zu bilden, auch der Klasse überlassen werden. Die Entscheidungsfindung sollte zeitlich jedoch eingeschränkt und durch die Lehrperson überwacht werden. • Die Lehrperson bildet die Gruppen bereits in der Planung des Unterrichts. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass selten alle Schülerinnen und Schüler in den Sportstunden mitmachen und diese Planung zeitaufwendig ist. Allerdings können damit für die Jugendlichen auch motivierende Anreize geschaffen werden: Wenn die Schülerinnen und Schüler die Turnhalle betreten, finden sie an der Wandtafel bereits die Mannschaftszusammenstellung, die Lehrperson kündigt das heutige Spiel an Der Unterricht erhält damit eine Verbindlichkeit und steigert sich in seinem momentanen Wert, denn es geht um etwas! Besteht ein Team einmal, kann und soll es auch über einige Unterrichtseinheiten beibehalten werden. Dies gilt besonders innerhalb von Blöcken; sie sollten bei gutem Funktionieren nicht stets verändert werden. Das „Wählen durch die Schüler/innen erachten wir als pädagogisch unhaltbar, da dadurch die Beliebtheitsstruktur bzw. die Ablehnung gegen ein Kind und die Leistungshierarchie innerhalb der Klasse sehr deutlich hervortreten und schwächere und/oder unbeliebte Jugendliche stets mit der Schmach konfrontiert werden, die letzte Wahl eines Mitschülers oder einer Mitschülerin zu sein. Mannschaftsgrösse Der Sportunterricht soll möglichst alle Schülerinnen und Schüler im wahrsten Sinne des Wortes bewegen. Eine hohe Bewegungsaktivität und ein hoher Grad an Eingebundenheit in ein Spiel bedingen, dass sich alle Schülerinnen und Schüler aktiv am Spiel beteiligen können. Zu lange Pausen zwischen den Wechseln und niedrige Aktivität durch eine zu grosse Anzahl Spieler/innen auf dem Feld sind die zwei Hauptprobleme, die es zu vermeiden gilt. Diese Überlegung soll bei der Bestimmung der Mannschaftsgrössen im Vordergrund stehen. Folgende Empfehlungen geben wir ab: • Mit einer kleinen Turnklasse (rund 15 Schüler/innen) kann auf der ganzen zur Verfügung stehenden Hallenfläche ein Spiel mit zwei Teams gespielt werden. Jedes Team besteht somit aus rund sieben bis max. 9 Spieler/innen. • Eine mittelgrosse Klasse mit rund 20 Schüler/innen wird auf zwei (eher passive Mädchenklassen) oder drei Teams (aktive Mädchenklassen und Knabenklassen) aufgeteilt. Bei drei Teams findet nach einer vorgegebenen Zeit oder einem vorbestimmten Torstand eine Rochade der Teams statt. Dabei besteht die Gefahr, dass das pausierende Team passiv herumsitzt und diese Einstellung auch auf das Spielfeld mitnimmt. Deshalb haben wir die Überlegung gemacht, dass passive Klassen besser in zwei Teams aufgeteilt werden, bei denen sich abgesehen von den etwas längeren Wartezeiten zwischen den Blockwechseln keine grösseren Pausen ergeben. Für aktive Klassen hingegen, bei denen sich die Schüler/innen während einem Spiel stark ausgeben, bedeutet die Spielpause im positiven Fall eine Erholungsgelegenheit. Dem pausierenden Team kann auch eine Lese-, Beobachtungs- oder Diskussionsaufgabe gestellt werden. • Bei grossen Klassen mit über 25 Schüler/innen ergeben sich zwei Möglichkeiten: es kann mit drei Teams wie oben beschrieben im Spielbetrieb rotiert werden, oder es werden vier Teams gebildet, welche in einer halben Hallenhälfte jeweils diagonal mit Schwedenkästen als Torhüter spielen. Anzahl Spieler/innen auf dem Spielfeld Die Anzahl der direkt auf dem Spielfeld stehenden Schüler/innen hängt von der Spielfeld- und folglich der Mannschaftsgrösse ab. Eine hohe Schüleraktivität während dem Spiel zu erreichen ist wie erläutert das oberste Ziel. Eine hohe Intensität kann durch eine eher geringe Anzahl auf dem Feld stehende Spieler/innen und kurze Wechsel erreicht werden. Wird über das ganze Kleinfeld mit einer Knabenklasse gespielt, werden je drei Feldspieler und ein Torhüter (oder eine Torhüteralternative) eingesetzt. Bei Mädchenklassen spielen auf dem Kleinfeld vier gegen vier Spielerinnen mit jeweils einer Torhüterin. Werden quer in der Halle zwei Partien gleichzeitig gespielt, stehen sich jeweils drei Spieler/innen gegenüber, der Schwedenkasten, der als Tor dient, wird von den Feldspieler/innen verteidigt. Wechsel und Blöcke Die Art des Auswechselns und der Entscheid für oder gegen Linien- oder Blockbildung hängen insofern zusammen, dass es in der Schule, im Gegensatz zum Leistungssport, weniger gut möglich ist, die Jugendlichen selbstständig in Blöcken wechseln zu lassen. Bei angesagten Wechseln wird die gesamte Linie gleichzeitig ausgewechselt, bei nicht angesagten Wechseln wird nach der Einschätzung der Schüler/innen rotiert. Als Zwischenform dieser zwei Extreme sehen wir ein Zählsystem, bei dem die Schüler/innen als erstes gleichmässig auf die drei oder vier Positionen verteilt werden und danach auf dieser Position eine Nummer erhalten. Verteidigerin 1 wird somit immer von der Verteidigerin 2 abgelöst, auf welche wiederum Verteidigerin 3 folgt, bis wieder Verteidigerin 1 an der Reihe ist. Jede Position muss dafür genau benannt werden, beispielsweise: • • Verteidiger/in – Mittelfeldspieler/in – Stürmer/in Linke/r Verteidiger/in – rechte/r Verteidiger/in – linke/r Stürmer/in – rechte/r Stürmer/in In der Literatur wird für den Schulunterricht empfohlen, das Auswechseln der Feldspieler/innen durch die Lehrperson anzusagen.20 Bei durch die Lehrperson bestimmten Wechselzeitpunkten besteht die Möglichkeit, die Schüler/innen in vorher gebildeten Blöcken gleichzeitig spielen zu lassen. Bleibt ein Block über einige Zeit in der gleichen Zusammensetzung bestehen, können sich die Schüler/innen aufeinander einstellen und gewinnen ein genaueres Gefühl füreinander; sie sind miteinander eingespielt. Unstimmigkeiten kann es jedoch geben, wenn Jugendliche über ihre Zuteilung unzufrieden sind. Wie der Gruppenbildung können auch für die Block-Einteilung die verschiedenen Prinzipien angewandt werden. Bei allgemeinem Widerstand gegen angesagte Wechsel kann mit den Schüler/innen auch die Situation im Leistungssport thematisiert werden, wo der Wechsel in den meisten Fällen mit dem Trainer abgesprochen ist oder von diesem direkt einberufen wird. Werden die Wechsel nicht angesagt, besteht die Gefahr, dass leistungsschwächere Schüler/innen weniger Spielzeit in Anspruch nehmen als die stärkeren Teammitglieder/innen. Andererseits erbringen die Schülerinnen und Schüler bei dieser Form eine grössere Eigenleistung, da sie sich auch sozial engagieren müssen. Dies ist jedoch in einem Spiel meistens nicht mit dem Wettkampfgedanken zu vereinbaren. Wenn das Spiel nicht unterbrochen ist, erfolgt der Wechsel fliegend und bewirkt kein Anhalten des Spiels. Der Zeitpunkt des Wechselns soll nach Ablauf der Richtzeit von ungefähr 90 Sekunden in einem ruhigen Moment des Spiels erfolgen. Die Lehrperson ruft dazu laut „Wechsel! und die Schüler/innen lassen sich entsprechend den Anweisungen durch ausgeruhte Mitspieler/innen ersetzen. 20 Beutler/Wolf (2004), S. 123 Kennzeichnung der Mannschaften Um die Teamzugehörigkeit zu kennzeichnen, werden aus Entfernung erfassbare und auch bei nur kurzem Augenkontakt eindeutige optische Signale eingesetzt. Wiederum bestehen verschiedene Möglichkeiten, dies zu erreichen: • Ein Set von farbigen Überzügen wäre die ideale Kennzeichnung, da die grossflächige Farbe im Spiel gut erkennbar ist. Bei Überzügen besteht jedoch das Problem, dass sie durch die Schweissabsonderung rasch unangenehm riechen und sich je nach Häufigkeit des Gebrauchs eine wöchentliche Reinigung aufdrängt. Hier müsste beispielsweise ein Turnus unter den Sportlehrkräften vereinbart oder mit dem Hauswart eine Lösung gesucht werden. • Bändeli, die quer über den Oberkörper getragen werden (und immer wieder von den Jugendlichen auch als Stirn- oder Armbänder gebraucht werden), sind die gängigste Art, Mannschaften zu kennzeichnen. Der Nachteil gegenüber den Überzügen besteht darin, dass sie auf weite Distanz schlechter sichtbar sind. Da sich die Schülerinnen und Schüler jedoch gegenseitig kennen und sich im Normalfall nichts anderes gewöhnt sind, ist der Einsatz von Bändelis vertretbar. • Ebenfalls beliebt und unter dem Aspekt des Erkennens sinnvoll sind durch die T-Shirt-Farbe bestimmte Gruppen. Für Schülerinnen und Schüler ist diese Methode jedoch leicht durchschaubar, weshalb wir von ihr abraten. Weniger wichtig als die Wahl der Mittel erscheint uns, dass die Mannschaften überhaupt gekennzeichnet werden, da die Erkennbarkeit doch erhebliche Auswirkungen auf die Spielqualität hat. 2.2.4 Torhüter/in Bestimmung der Torhüterin/des Torhüters Der Torhüter, die Torhüterin innerhalb eines Teams besetzt eine spezielle Rolle im Team und wird auch als Einzelsportler/in inmitten von Mannschaftssportlern bezeichnet. In einer Schulklasse ist es meist nicht zu erwarten, dass der Torhüterposten von den Jugendlichen begehrt wird. Als Anreiz, sich als Torhüter/in zu melden, kann während einer Unterrichtssequenz auch ein spezielles Torhütertraining in den Unterricht integriert werden. Gerade laufschwache Jugendliche können so ihre Rolle im Spiel finden und zu einem wichtigen Teil der Mannschaft werden. Grundsätzlich sollen entweder beide Mannschaften mit oder eben ohne Torhüter/in spielen. Als erste Wahl gelten immer freiwillige Schüler/innen. Es soll niemand gezwungen werden, den Torhüterposten einzunehmen. Bei einer Torhüterrochade ist der Wechsel von der Lehrperson anzusagen, da ansonsten die Zeit fehlt, um die Ausrüstung zu wechseln. Torhüterausrüstung Es besteht eine strikte Helmpflicht, um Kopfverletzungen, vor allem der Augen, vorzubeugen. Dies gilt auch wenn das Innenpolster des Helmes bereits verschwitzt und nass ist; hier kann ein Frottiertuch helfen. Knieschoner sind, wenn vorhanden, unbedingt anzubieten, um das lange Knien angenehmer zu machen und Verschiebungen durch Rutschen zu ermöglichen. Ausserdem sollte die Lehrperson zwei grosse Pullover und zwei Paar lange Trainerhosen bereithalten, die der Schüler oder die Schülerin im Tor anziehen kann. Vor allem Mädchen spielen zudem gerne mit Handschuhen. Ein Paar alter Velohandschuhe kann für die Motivation im Tor förderlich sein. Alternativen als Torhüter-Ersatz Finden sich keine Torhüter/innen oder wird bewusst darauf verzichtet, können verschiedene Gegenstände aus dem Geräteraum den Torraum statisch begrenzen. Grundsätzlich steht bei der Wahl im Vordergrund, wie Tore möglich sein sollen und wie nicht. Wird beispielsweise die gesamte Bodenfläche abgedeckt, können mit flachen Schüssen keine Tore erzielt werden. Dies kann zum Beispiel dann erwünscht sein, wenn die Jugendlichen einen hohen Schuss im Spiel anwenden sollen. Bleibt hingegen am Boden ein kleiner Raum offen, kann auch ein bodennaher Schuss zum Torerfolg führen, vorausgesetzt, er ist präzise geschossen. Einige Beispiele für Torhüter-Alternativen: • Malstäbe, direkt aneinandergereiht, schirmen vor allem flache Schüsse ab. • Das Oberteil eines Schwedenkastens, der Länge nach aufgestellt, seitlich daneben zwei Medizinbälle ist eine Konstruktion, welche für schwächere Gruppen als Torhüter ausreichen kann. • Zwei weitere Möglichkeiten: • Die Tore können umgekehrt hingelegt werden und/oder mit der Toröffnung entgegen dem Spielfeld platziert werden. Einen ähnlichen Effekt haben die kleinen Tore. In diesem Fall wird um das Tor herum ein Torraum fixiert, welcher von niemandem betreten werden darf. • Eine Blache vor dem Tor mit Löchern auf unterschiedlicher Höhe ist im Handel für rund 60 Franken käuflich oder auch selbst herstellbar, möglicherweise in Absprache mit der Lehrkraft für Technisches Gestalten. Die Anordnung der Löcher bestimmt den Schwierigkeitsgrad, grundsätzlich eignet sich die Blache jedoch vor allem für fortgeschrittene Spieler/innen. Weibliche Goalies in einer gemischten Klasse Wird mit geschlechterdurchmischten Teams gespielt und ein Mädchen als Torhüterin eingesetzt, schiessen die Knaben meist von sich aus etwas weniger stark aufs Tor. Ist dies nicht der Fall, kann mit der Klasse einen Bereich abgemacht werden, ausserhalb welchem nicht aufs Tor geschossen werden darf. Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass dieses Thema nicht speziell angeschnitten werden soll, wenn sich aus dieser Situation keine Probleme ergeben, da gerade auf diesem Posten die Mädchen den Jungen nicht zwingend nachstehen müssen. Es kann für die restlichen Spieler/innen der Mannschaft auch eine Aufgabe sein, bei einem unsicheren Torhüter oder einer unsicheren Torhüterin die eigene torgefährliche Zone möglichst gut abzuschirmen. 2.2.5 Schiedsrichter/in Spiel mit oder ohne Schiedsrichter/in Ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin leitet ein Spiel und greift bei Regelübertretungen ein. Hierarchisch gesehen steht er oder sie in einem Spiel an oberster Stelle. Grundsätzlich soll er oder sie keine Spiele entscheidend beeinflussen, sondern sich nur in regelwidrigen Situationen einschalten. Wir befürworten ein Spiel mit Schiedsrichter/in, um die Einhaltung der Regeln und der Respekt vor einer in dieser Situation höher gestellten Person einzuüben. Andererseits kann argumentiert werden, dass sich die Jugendlichen meist auch selbst zu helfen wissen, sofern sie motiviert sind, ein Spiel aufzuziehen. Dem ist aber entgegenzustellen, dass sie diese Situation in ihrer Freizeit bereits vorfinden und dort zudem oft ähnlich gesinnte Jugendliche mit einem homogenen Leistungsniveau miteinander spielen. Verhalten des Schiedsrichters/der Schiedsrichterin Zu Beginn einer Unterrichtssequenz ist es wichtig, dass zuerst einmal die Lehrkraft die Schiedsrichterrolle übernimmt und mit konsequenten Entscheiden den Grundstein für das Regelverständnis der Schülerinnen und Schüler legt. Abgepfiffen wird bei offensichtlichen Regelübertretungen, ohne jedoch zu kleinlich zu sein und den Spielfluss stetig zu unterbrechen, und bei Verletzungsgefahr. Der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin platziert sich an einer Stelle, von welcher aus er oder sie das gesamte Spielfeld überblicken kann. Dies kann im Spielfeld selbst sein, was je nach Spielgeschehen immer wieder eine räumliche Verschiebung bedingt, oder beispielsweise vor der Sprossenwand, auf dessen Sprossen er oder sie stehen kann, wenn sich das Spiel in diese Richtung bewegt. Im Verlauf der Unterrichtssequenz können die Schülerinnen und Schüler in den Entscheidungsprozess eines Schiedsrichters einbezogen werden. Sie sollen selber in diese Rolle schlüpfen und ein Spiel oder einen Teil eines Spiels pfeifen. Dies empfiehlt sich vor allem bei Jugendlichen, welche wiederholt Unzufriedenheit über Schiedsrichterentscheide äussern. Akzeptanz des Schiedsrichters/der Schiedsrichterin Wird die Schiedsrichterrolle besetzt, müssen die Entscheide akzeptiert und respektiert werden. Aus der medialen Sportwelt erfahren die Jugendlichen jedoch immer wieder, wie Schiedsrichterentscheide von gestandenen Sportlern in Frage gestellt werden. Stellt dies in einer Klasse ein ernsthaftes Problem dar, kann die Thematik fächerübergreifend aufgegriffen und die Rolle und Funktion des Schiedsrichters diskutiert werden. Dass dies ein sehr aktuelles Thema ist, zeigt beispielsweise der Streik der Fussball-Schiedsrichter im Kanton Freiburg.21 Es geht beim Einsatz eines Schiedsrichters oder einer Schiedsrichterin nicht darum, Autoritätsgehorsam einzuüben. Vielmehr stellt sich den Jugendlichen so die Herausforderung, sich in einer begrenzten Zeitspanne mit den Entscheiden einer Person, die eine höher gestellte Rolle innehat, zu arrangieren. Handzeichen Schiedsrichter/innen im Leistungssport geben ihre Entscheide stets mit Handzeichen bekannt. Für die Schule ist dies nicht zwingend, könnte jedoch aus unserer Sicht spannend und hilfreich sein. Wenn auf einen Pfiff ein Handzeichen folgt, muss die Spielerin zuerst zu der Lehrperson schauen, das Handzeichen interpretieren und kann erst dann reagieren, falls sie nicht einverstanden ist. Reagiert die Gegnermannschaft in dieser Situation schneller, wird sich die Spielerin beim nächsten Mal überlegen, ob sie nochmals ausrufen will. Die Kenntnis von Handzeichen ist zudem nicht nur für das Unihockey-Spiel nützlich, sondern begegnet den Jugendlichen in Sportspielen immer wieder. So sind beispielsweise die Unihockey-Handzeichen den Handzeichen für das Eishockey, welches die Jugendlichen vielleicht im Fernsehen oder live mitverfolgen, sehr ähnlich. Voraussetzung für die Einführung von Handzeichen ist natürlich, dass die Lehrperson (und später auch die Schüler/innen) eine Regelübertretung erkennt. Beim Out-Ball dürfte dies klarer sein als bei Fouls oder bei einem knappen Tor. Ist diese Voraussetzung gegeben, werden die Handzeichen schrittweise im Unterricht eingeführt und im Spiel angewandt. 21 Siehe Zeitungsartikel der NZZ in der Planung zu Lektion 5: Schiedsrichter treten in Streik, 4.11.2007 2.2.6 Material Im Umgang mit dem Material soll der Grundsatz herrschen, dass alles gebraucht werden soll und somit eine natürliche Abnutzung unvermeidbar ist, jedoch nicht mutwillig Material zerstört werden darf. Stock Unihockeystöcke bestehen aus einem Schaft und einem austauschbaren Schaufelblatt, das am Schaft angeschraubt wird. Für die Schule gibt es spezielle Stöcke mit einer vorgebogenen Schaufel und einem mittelharten Schaft. Es ist nicht zu erwarten, dass in einer Schule verschiedene lange Stöcke vorhanden sind, wie dies als Anpassung an die Körpergrösse ideal wäre.22 Die Schläger sind aus robustem Material und gehen bei sachgemässer Verwendung im Schulsportunterricht nicht kaputt. Zum sorgfältigen Umgang gehört, dass die Schaufeln von den Schülerinnen und Schülern während dem Turnunterricht nicht gebogen werden dürfen. Die Schlägerblätter werden meist aus verschiedenen Kunststoffen, Kohlefasern, Laminat oder einer Nylonmischung hergestellt und sind nur unter Wärmeeinfluss biegbar. Wenn die Schaufel in kaltem Zustand gebogen wird, erhält der Kunststoff kleine Risse, wird spröde und nutzt sich dadurch schneller ab. Da erfahrungsgemäss die meisten Jugendlichen, vor allem die Knaben, in der Turnhalle immer noch rasch die Schaufelbiegung verändern wollen, indem sie die Schaufel beispielsweise über das Knie legen und nach unten drücken oder mit einem Fuss auf die Schaufel stehen und den Schläger hochziehen, ist auf diesen Punkt besonderen Wert zu legen. Um die physikalischen Gesetze zu verdeutlichen, kann ein dünnes Stück Plastik, zum Beispiel von einem Joghurtbecher, als Versuchsobjekt genommen werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen erfahren, dass das Plastikstück bei Raumtemperatur unter mechanischem Druck bricht, während es nach einer gewissen Wärmezufuhr durch heisses Wasser oder einen Haarföhn weich und biegbar und schliesslich flüssig wird. Bei der Schaufelbiegung ist zudem zu beachten, dass sie nicht stärker als 3cm sein darf. Gemessen wird dabei beim mit der offenen Schaufelseite am Boden liegenden Stock vom Boden bis zum höchsten Punkt der gebogenen Schaufel. Bei folgenden Anzeichen sollten Schläger ausgewechselt werden: • • Die Schaufel weist Risse auf, mehrere Verstrebungen sind durchgebrochen. Die Unterseite der Schaufel ist abgewetzt und weist scharfe Kanten auf. Zudem sollte das Griffband regelmässig ausgewechselt werden, da es sich bei häufigem Gebrauch abnutzt und an den Seiten ausfranst. Ball Bälle werden im Spiel oft durch Draufstehen beschädigt und müssen ersetzt werden, sobald sie an der Schweissnaht eine offene Stelle aufweisen. Aufbewahrt und gesammelt werden die Bälle in Kunststoffeimern, Stofftaschen oder ähnlichem. Verschieden farbige Bälle können für die Übungsorganisation helfen. 22 Das obere Ende des Schafts soll dem Spieler/der Spielerin dabei etwa bis zum Bauchnabel oder etwas höher reichen. Tore Bei den Toren besteht bei der Torumrandung meist höchstens die Gefahr von Farbschäden oder einer Beschädigung des Tornetzes, welches bei kleineren Löchern mit Nadel und Faden selbst geflickt werden kann. Torhüterhelm Ein Torhüterhelm ist aus stabilem Material gefertigt und Schäden eher unwahrscheinlich. Aus hygienischen Gründen sollten die Innenpolster regelmässig abgewaschen werden. Das Aufbauen von Banden empfiehlt sich aus zeitlichen Gründen nicht, als Spielfeldabgrenzung reichen in den Ecken aufgestellte Langbänke. Anschaffungen für eine Schule Besteht in einer Schule die Gelegenheit, neues Unihockey-Material anzuschaffen, können bei swiss unihockey oder bei Sportartikelherstellern wie AlderEisenhut Sets für die Schule bezogen werden. Swiss unihockey bietet im Zusammenhang mit der Organisation des Schülerturniers Rivella Games eine spezielle Aktion an23. 2.3 Eine Quartalsplanung 2.3.1 Aufbau einer Lektion Aufwärmen Beim Aufwärmen werden Körper und Geist auf die folgende sportliche Betätigung eingestimmt. Hier sollen bereits unihockey-spezifische Aspekte miteinbezogen werden: 23 • Das Aufwärmen des Herz-Kreislauf-Systems und der besonders beanspruchten Muskulatur: Fussgelenke, Wade, hintere und vordere Oberschenkelmuskulatur, Arme. • Miteinbezug von Stock und Ball so weit als möglich, um damit die Koordination und das Ballgefühl zu schulen. Beinahe alle läuferischen Einlaufen lassen sich auch mit Ball und Stock gestalten. • Kraftübungen sind unserer Meinung nach gemäss dem Motto „Wenige Übungen, dafür bei jedem Aufwärmen als festes Ritual durchzuführen. Die Übungen sollen der Kräftigung hauptsächlich von Rumpf und Beinen dienen und auf die Belastungen im Spiel vorbereiten. Siehe 2.4 Material: Empfehlungen für eine Schule. • Auch Koordinationsübungen wie eine kurze Sprungschule bereiten die Muskulatur vor und entwickeln die Koordinationsfähigkeit. Die Lehrperson nimmt beim Aufwärmen zu Beginn der Unterrichtssequenz die Rolle des Vorzeigens ein. Indem sie die Übungen vorzeigt und selbst mitmacht, zeigt sie den Schülerinnen und Schülern einerseits am Modell die korrekte Ausführung, andererseits verschafft sie sich so auch den Respekt, die Übung als Lehrperson selber zu beherrschen. Wenn die Klasse das Repetoire der Übungen kennt, wird die Lehrperson zum Berater zur Beraterin, korrigiert fehlerhafte Ausführungen und übergibt den Jugendlichen stetig mehr Verantwortung. So kann das Aufwärmen oder Teile davon an einzelne Schüler/innen abgegeben werden, die dann zu Captains für das Einlaufen werden. Übungsphase Die Übungen sollen für die Schülerinnen und Schüler herausfordernd sein, ohne sie zu überfordern. Im Üben können technische und taktische Abläufe geschult werden, für die im Spiel nur wenig Zeit bleibt. Der Aufbau der Fähigkeiten und Fertigkeiten folgt dem Stufenmodell Erwerben – Anwenden – Gestalten und den Abstufungen alleine spielen – zu zweit spielen – in der Gruppe spielen. Die Übungen werden so ausgewählt, dass sie vom Einfachen zum Schwierigen gehen. Für den Schulunterricht ist die Auswahl weniger Übungen, welche mehrmals wiederholt und eingeübt werden können, angebracht, um Fortschritte wirklich spür- und sichtbar zu machen. Die Einführung von Übungen soll eine Visualisation beinhalten, zum Beispiel in Form einer Zeichnung oder einer Demonstration mit einzelnen Schüler/innen. Im Handel sind auch spezielle Trainer-Tafeln erhältlich24. Im Laufe der Zeit kann die Übung ohne Erklärungen von den Jugendlichen selbstständig durchgeführt werden. Bestehen in der Klasse grosse Leistungsunterschiede, können starke Schüler/innen auf Schlüsselpositionen (z.B. Pässe verteilen) eingesetzt werden. Auch wenn das Üben grundsätzlich in leistungsheterogenen Gruppen erfolgen kann und soll, ist es unter Umständen manchmal sinnvoller, die Klasse aufgrund der Leistungsfähigkeit in zwei Gruppen zu teilen und die Übung auf zwei Tore ausführen zu lassen. Eine Übung sollte nicht zu lang andauern, jedoch genug lange laufen gelassen werden, um einen Lerneffekt zu ermöglichen. Wenn die Aufmerksamkeit der Schüler/innen nachlässt, ist dies ein Anzeichen, etwas an der Übungsanlage zu verändern, beispielsweise die Seite zu wechseln oder aber eine neue Übung anzusagen. Die allgemeine Motivation zum Üben kann auf der Sekundarstufe 1 gering sein, wenn die Schülerinnen und Schüler den Sinn des Übens nicht erleben können und lieber nur spielen würden. Im Sportunterricht hat beides – Spiel und Üben – seinen Platz, das soll den Jugendlichen klar kommuniziert werden. Können die Schülerinnen und Schüler die Erfahrungen machen, dass sie sich durch das Üben verbessern können, und ist die Struktur des Unterrichts zudem transparent offengelegt und die Übungsphase zeitlich klar begrenzt, werden die Voraussetzungen geschaffen, dass auch abgeneigte Jugendliche den Sinn des Übens erfassen können. Zudem kann es motivierend sein, mit der Klasse zu thematisieren, wie leistungsorientierte Mannschaften trainieren. Schülerinnen und Schüler, die in einem Club Unihockey spielen, können von ihren Erfahrungen erzählen, und wo der Bezug zum Unihockey fehlt (beispielsweise möglicherweise bei 24 Bestelladresse siehe Anhang. ausländischen Jugendlichen), kann die Einsicht über andere Spielsportarten wie zum Beispiel Fussball hergestellt werden. Sehr wichtig sind positive Rückmeldungen der Lehrperson über Fortschritte im Spiel, gerade wenn sie aus eingeübten Varianten entstanden sind. Der Torhüter, die Torhüterin kann bei den meisten Übungen sehr gut integriert werden. Findet sich eine motivierte Schülerin oder ein motivierter Schüler, kann es ein spezieller Anreiz sein, bei den Übungen im Tor stehen zu können. Wenn der Torhüterposten unbesetzt bleibt, kommen die Torhüteralternativen zur Anwendung. Spielphase Auf die Übungsphase sollte in der Schule aus Motivationsgründen stets eine mindestens zehnminütige Spielphase folgen. Das Spiel besteht in einer nach den Instrumenten Spielidee – Regeln – Anzahl Spieler/innen – Raum – Material – Zeit modifizierten Version des eigentlichen offiziellen Unihockey. Ziel ist eine Heranführung an das reguläre Spiel auf einem Kleinfeld. Je nach Dauer und Intensität des Spiels ist es sinnvoll, kurze Spielpausen einzulegen, während denen die Schüler/innen etwas trinken können: • • • Bei einem Spiel von rund 20 Minuten können zwei Hälften à je 10 Minuten mit einer einminütigen Pause gemacht werden. Bei einem Spiel unter 15 Minuten Dauer wird normalerweise kein Unterbruch gemacht. Bildet das Spiel der Hauptteil der Lektion, kann es in drei Drittel à rund 12 Minuten unterteilt werden. Reflexionsphase Im Anschluss an eine Übungs- oder Spielphase kann immer auch eine Reflexionsphase eingeschaltet werden, während der sich die Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken zur Lektion äussern. Dabei können zum Beispiel das Zusammenspiel, Anregungen an Mitspieler/innen und eigene Fortschritte thematisiert werden. Cool down und Auslaufen Im Sportunterricht mit seiner engen zeitlichen Begrenzung kann im Normalfall kein ausgedehntes Cool down gemacht werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen jedoch an das Auslaufen gewöhnt werden und nach einer Unihockey-Lektion noch einige Minuten zur Verfügung haben, zwei Runden auszulaufen oder zu dehnen. Der Zusammenzug der Schülerinnen und Schüler am Ende der Lektion gehört zur Struktur des Unterrichts: Fazit, Lob und ein Ausblick haben hier ihren Platz. 2.3.2 Allgemeine Bemerkungen zur längerfristigen Planung Für die Erstellung der exemplarischen Quartalsplanung haben wir uns auf die folgenden Planungsgrundsätze gestützt: • Das Prinzip EAG: Erwerben – Anwenden – Gestalten • alleine üben – zu zweit üben – in der Gruppe üben • Aufbau der unihockeyspezifischen Fähigkeiten: Vom Passen zum Zusammenspiel Vom Schiessen zum Tore erzielen Vom Ballführen zum Zweikampf Die Planung beinhaltet 11 Einzellektionen, die beispielsweise im Herbstquartal (Ende der Herbstferien bis Weihnachten) unterrichtet werden können. Am Ende wird in einer Doppellektion klassenintern ein Weihnachtsturnier durchgeführt. Weiterführend kann auch eine Teilnahme an einem kantonalen Turnier der Rivella Games ins Auge gefasst werden. Die Bewertung der Unterrichtseinheit Unihockey erfolgt einerseits aufgrund einer Lernkontrolle, welche das genaue Passen und das genaue Schiessen prüft. Der Spieleinsatz und das Spielverhalten andererseits werden in einem bewusst einfach gehaltenen Erfassungsbogen mit mindestens zwei Einträgen jeweils nach dem Ende einer Lektion von der Lehrperson dokumentiert. Diese Fremdbeurteilung wird mit einer Selbsteinschätzung der Schülerin oder des Schülers ergänzt. Die Benotung der Lernkontrolle Schuss und Pass und die Spielbeurteilung bilden zusammen zu je der Hälfte die Note für diese Unterrichtseinheit. Die Auflösung des Quiz in Lektion 11 findet sich im Anhang.