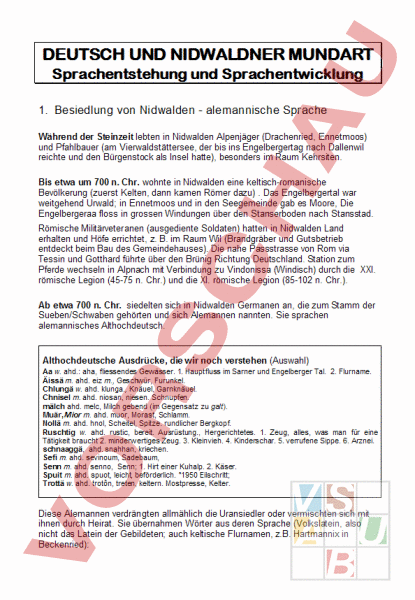Arbeitsblatt: Dialekt
Material-Details
Dialekt: Deutsch und Nidwaldner Mundart
Deutsch
Wortschatz
9. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
24696
1022
5
03.09.2008
Autor/in
Magnos Huwyler
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
DEUTSCH UND NIDWALDNER NIDWALDNER MUNDART Sprachentstehung und Sprachentwick Sprachentwicklung 1. Besiedlung von Nidwalden alemannische Sprache Während der Steinzeit lebten in Nidwalden Alpenjäger (Drachenried, Ennetmoos) und Pfahlbauer (am Vierwaldstättersee, der bis ins Engelbergertag nach Dallenwil reichte und den Bürgenstock als Insel hatte), besonders im Raum Kehrsiten. Bis etwa um 700 n. Chr. wohnte in Nidwalden eine keltisch-romanische Bevölkerung (zuerst Kelten, dann kamen Römer dazu) Das Engelbergertal war weitgehend Urwald; in Ennetmoos und in den Seegemeinde gab es Moore, Die Engelbergeraa floss in grossen Windungen über den Stanserboden nach Stansstad. Römische Militärveteranen (ausgediente Soldaten) hatten in Nidwalden Land erhalten und Höfe errichtet, z. B. im Raum Wil (Brandgräber und Gutsbetrieb entdeckt beim Bau des Gemeindehauses). Die nahe Passstrasse von Rom via Tessin und Gotthard führte über den Brünig Richtung Deutschland. Station zum Pferde wechseln in Alpnach mit Verbindung zu Vindonissa (Windisch) durch die XXI. römische Legion (45-75 n. Chr.) und die XI. römische Legion (85-102 n. Chr.). Ab etwa 700 n. Chr. siedelten sich in Nidwalden Germanen an, die zum Stamm der Sueben/Schwaben gehörten und sich Alemannen nannten. Sie sprachen alemannisches Althochdeutsch. Althochdeutsche Ausdrücke, die wir noch verstehen (Auswahl) Aa w. ahd.: aha, fliessendes Gewässer. 1. Hauptfluss im Sarner und Engelberger Tal. 2. Flurname. Äissä m. ahd. eiz m., Geschwür, Furunkel. Chlungä w. ahd. klunga., Knäuel, Garnknäuel. Chnisel m. ahd. niosan, niesen. Schnupfen. mälch ahd. melc, Milch gebend (im Gegensatz zu galt). Muär, Mior m. ahd. muor, Morast, Schlamm. Nollä m. ahd. hnol, Scheitel, Spitze. rundlicher Bergkopf. Ruschtig w. ahd. rustic, bereit. Ausrüstung., Hergerichtetes. 1. Zeug, alles, was man für eine Tätigkeit braucht 2. minderwertiges Zeug. 3. Kleinvieh. 4. Kinderschar. 5. verrufene Sippe. 6. Arznei. schnaaggä, ahd. snahhan, kriechen. Sefi m. ahd. sevinoum, Sadebaum, Senn m. ahd. senno, Senn; 1. Hirt einer Kuhalp. 2. Käser. Spuit m. ahd. spuot, leicht, beförderlich. 1950 Eilschritt; Trottä w. ahd. trotôn, treten, keltern. Mostpresse, Kelter. Diese Alemannen verdrängten allmählich die Uransiedler oder vermischten sich mit ihnen durch Heirat. Sie übernahmen Wörter aus deren Sprache (Volkslatein, also nicht das Latein der Gebildeten; auch keltische Flurnamen, z.B. Hartmannix in Beckenried): 20080903-135401Deutsch_und_Nidwaldner_Mundart[1].doc Lateinische Ausdrücke, die wir noch verstehen (Auswahl) Ankä m., lat. unguen, unguentum, Fett. Sirtä w., lat. serum; rom. sirun, Molke Milchserum. Schottä w., lat. materia excocta Käsewasser, Molke, Milchserum, Turner m., lat. turnare, drehen, Dreharm für den Käsekessel bei der Feuerstelle. Goon m., Geeni s., lat. congius, Schöpfgefäss; hölzerner Schöpf-, Esslöffel. Staafel m., lat. stabulum, Stall; Voralp. stääflä eine Voralp bewirtschaften. Ab etwa 1000 n. Chr.: Übergang zum Mittelhochdeutschen Die deutsche Sprache entwickelte sich von Althochdeutsch über Mittelhochdeutsch zu Neuhochdeutsch oder einfach Hochdeutsch, unserer heutigen Standardsprache. Mittelhochdeutsche Ausdrücke, die wir noch verstehen (Auswahl) alwär mhd. alwaere, albern. wählerisch, bes. beim Essen. Atzig w. mhd. aunge. Nutzung fremden Weidelandes gegen Entgelt. Baarg m. mhd. barc. 1. kastrierter Eber. 2. schmutzige Person. Bedmer m. mhd. bodem Boden. Liegeplatz des Viehs im Freien auf den Alpen. Blitzg w. mhd. blicze Blitz. (ütr. Blitzmacherin, Hexe). sehr abschätziger Schimpf für Frau. Bryysli s.(mhd. brîsen, engschnüren, einfassen. Bordenabschluss, Ärmel-, Halsborde an Wäschestücken und Kleidern. chiderä mhd. kiuten, schwatzen. 1. frech, ärgerlich reden. 2. höhnisch lachen. Chlank m. mhd. klank Klang. einseitiger Anschlag des Glockenklöppels. Chlänk-gloggä s. Totenglocke. chräsmä mhd. kresen, kriechen, auf allen Vieren gehen. klettern. Ab etwa 1100 n. Chr.: Italienische Wörter Im 13. Jahrhundert ist in Nidwalden die Rodung des Urwaldes für Weideland im Talboden und im 14. Jahrhundert diejenige der Alpen weitgehend abgeschlossen. Zusätzliche Produktion ermöglicht Handel. Oberitalienische Städte (z.B. Mailand mit fast 100�00 Einwohnern haben Grossbedarf an Schlachtvieh und Milchprodukten (Käse, Butter). Kürzeste Verbindung zu oberitalienischen Markt ist der Brünigpass. Katholische Priester wurden im Seminar in Mailand ausgebildet. Nidwaldner Söldner zogen in italienische Dienste: Sie dienten als Soldaten. Ab etwa 1800 zogen Arbeiter in unsere Gegend: Maurer, im 20. Jahrhundert Strassenbauer und Servicefachleute. Italienische Audrücke, die wir verstehen (Auswahl) Sèllä, die Schwelle. la soglia,. Bèllä, die Zwiebel. la cipolla, Joppä; Tschoopä, Jacke. la giuppa. Kalazä, das Frühstück. la colazione Gänterli; Kantrum. Speiseschrank, Wandmöbel, Kommode. la cantoniera. Fazäneetli, Fazäneetzli, Neezli, Neetli, Taschentuch. il fazzoletto. Tschiferä, Rückenkorb. la civera (lombard) Spyynä, der Fasshahn. la spina. Talosch, das Pflasterbrett. il taloscio (südit.) Magroonä, Makkaroni. il maccerone. Paläntä m., Mais (schlechthin). la polenta (Mais-) Brei. Triggóóni m. hochgreifende, schwere Beschläge an Schuhsohle/Absatz. (Fabrikatsname Tricuoni). Adaptierte Vorlage nach dem Manuskript „OBWALDNER MUNDART von Karl Imfeld, Kerns, 2001 Seite 2 von 4 20080903-135401Deutsch_und_Nidwaldner_Mundart[1].doc Reislaufen: Französische Wörter durch Söldner Nach Frankreich lieferte Nidwalden während Jahrhunderten ganze Söldnertruppen, die zum Teil von Nidwaldner Kommandanten befehligt wurden. Französische Ausdrücke, die wir noch verstehen (Auswahl) aparti frz. à part. besonders, extra. aschúir frz. à jour. auf neuestem Stand, aufgeschlossen. áwegg frz. avec. Kaffe mit Schnaps. Äs Kaffee áwegg, Balángs m. frz. balance. 1. Gleichgewicht. 2. Lenkstange des Fahrrades. Bossä w. frz.: bosse, Buckel. vorstehende Unebenheit am zu bearbeitenden Stein (A., Guber). Bräisi s. frz. braiser, braten. 1. kleine geröstete, gebratene Stücklein aller Art. 2. Röstkartoffeln plasiärä frz. blaser, abstumpfen. sich wichtig geben; wichtig tun. pudlä frz. bouteille, Flasche. 1. einen Schoppen (frz. chopine) trinken (pudled) 2 trinken. 3. etwas schlürfen, essen. ramisiärä frz. ramasser, sammeln. raffen. Schalisyy w. frz. jalousie, Missgunst. Fensterladen schluis frz. jalous. eifersüchtig. schiniärä frz. gêner, sich genieren, gehemmt sein. Tabrettli s. frz. tabouret. Hocker. Tambuir m. frz. tambour, Trommler. Tschägg m. afrz. eschiec, Schach; schachbrettartig. 1. unregelmässiger Fleck; Fell-, Hautfleck. 2. geschecktes Tier. tuschuir frz. toujours. immer. Ra.: tuschuir äister, gar immer. 2. Entwicklung der deutschen Sprache 800 1100 ALTHOCHDEUTSCH Gang ût, nesso, mid nigun nessiklînon, ût fana themo marge an that bên, fan themo bêne an that flêsg. 1100 1500 MITTTELHOCHDEUTSCH Nieman kann mit gerten kindes zuht beherten: den man zêren bingen mac, dem ist ein wort als ein slac. gleichzeitig DIALEKTE, z. B. Nidwalden: Etz hed är syner Frai ä scheenä n(e)yywä Huäd gchaift. 1545 HOCHDEUTSCH Bibelübersetzung 1522 von Martin Luther: „Die gantze Heilige Schrift deudsch auffs new zugericht in sächsisches Kanzleideutsch. Diese Sprache wird deutsche Standardsprache. 1920 seit 1960 2000 NEUHOCHDEUTSCH Wandel der Dialekte durch Arbeitskräfte in Industrie, Bau, Gastgewerbe; durch die Medien Entwicklung hin zu einem allgemeinen Schwizerdütsch Adaptierte Vorlage nach dem Manuskript „OBWALDNER MUNDART von Karl Imfeld, Kerns, 2001 Seite 3 von 4 20080903-135401Deutsch_und_Nidwaldner_Mundart[1].doc 3. Sprachbeispiel zur Entwicklung des Deutschen Althochdeutsch Gang ût, nesso, mid nigun nessiklînon, Mittelhochdeutsch Gang ûz, wurm, mit niun klînen würmelìn! Nidwaldnerdialekt Gang uisä, Wurm, mid n(e)yn chl(e)ynä Wirmli! Hochdeutsch Geh hinaus, Wurm, mit neun kleinen Würmlein! Schweizerdeutsch Gang use, Wurm, mid nüün chliine Würmli! Jugendliches Schweizerdeutsch Hau ab, Wurm, mit diine nüün Beybi! Jugendsprache Ziä Läine, Wurm, mit diine nüün Kids! 4. Dialekt schreiben Mundart wird vor allem gehört und gesprochen. seltener geschrieben. Schreiben ist aber oft leichter als Mundart lesen. Doch durch die SMS wird heute viel mehr in Dialekt geschrieben. Oft muss man die Texte laut lesen, bis man den Inhalt begreift. Für die Schreibweise der Mundart gibt es verschiedene Vorschläge. Je einfacher sie sind, desto eher werden sie befolgt. Beachte folgende Regelvorschläge: 1. Vergiss alle Rechtschreibregeln des Hochdeutschen. 2. Schreibe die Dialektwörter so, wie du sie hörst! 3. Schreibe keine Apostrophe: Muäter chas, nicht dMuäter chas. 4. Stummes wird geschrieben z.B. Der B(e)yrer, (oder Beyrèr). 5. Dehnungen erhalten Doppelvokal, z.B. Oor, Ugfeel, häigaa, gäärä. Langes kann yy oder ii geschrieben werden. Pfyyl Pfiil. E-i kann ei oder ey geschrieben werden, aber „ei muss als äi stehen: Gmäind, häigaa, eläi. Schärfungen (nie aber ch und sch) erhalten Doppelkonsonant z.B. Pfiiffä, Vatter, linggs. Weich gesprochene Konsonanten werden weich geschrieben z.B. Bredig, Blad. Hart gesprochene Konsonanten werden hart geschrieben, z. B. Tach, gluägt, [aber: gsäid]; ich tänkä, ich ha tänkt; ich dankä, ich ha tanked, aber: ich bi dankbar]; ich bringä, aber: ich ha praacht Binde-N wird dem vorangehenden Wort angehängt z.B. Ich han än menän Oord gsee. St und sp am Wortanfang gelten als scht bzw. schp. Im Wortinnern: Gschpänscht, Gischpu Adaptierte Vorlage nach dem Manuskript „OBWALDNER MUNDART von Karl Imfeld, Kerns, 2001 Seite 4 von 4