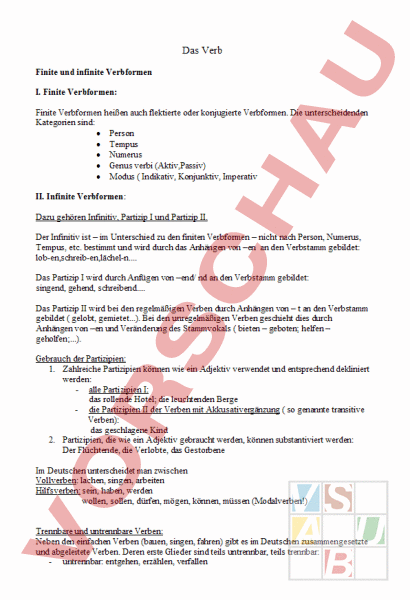Arbeitsblatt: Das Verb
Material-Details
Übersicht über die Funktionen des Verbs
Deutsch
Grammatik
9. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
25328
993
20
14.09.2008
Autor/in
Brigitte Simon
Land: Österreich
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Das Verb Finite und infinite Verbformen I. Finite Verbformen: Finite Verbformen heißen auch flektierte oder konjugierte Verbformen. Die unterscheidenden Kategorien sind: • Person • Tempus • Numerus • Genus verbi (Aktiv,Passiv) • Modus Indikativ, Konjunktiv, Imperativ II. Infinite Verbformen: Dazu gehören Infinitiv, Partizip und Partizip II. Der Infinitiv ist – im Unterschied zu den finiten Verbformen – nicht nach Person, Numerus, Tempus, etc. bestimmt und wird durch das Anhängen von –en an den Verbstamm gebildet: lob-en,schreib-en,lächel-n Das Partizip wird durch Anfügen von –end/ nd an den Verbstamm gebildet: singend, gehend, schreibend Das Partizip II wird bei den regelmäßigen Verben durch Anhängen von – an den Verbstamm gebildet gelobt, gemietet.). Bei den unregelmäßigen Verben geschieht dies durch Anhängen von –en und Veränderung des Stammvokals bieten – geboten; helfen – geholfen;.). Gebrauch der Partizipien: 1. Zahlreiche Partizipien können wie ein Adjektiv verwendet und entsprechend dekliniert werden: alle Partizipien I: das rollende Hotel; die leuchtenden Berge die Partizipien II der Verben mit Akkusativergänzung so genannte transitive Verben): das geschlagene Kind 2. Partizipien, die wie ein Adjektiv gebraucht werden, können substantiviert werden: Der Flüchtende, die Verlobte, das Gestorbene Im Deutschen unterscheidet man zwischen Vollverben: lachen, singen, arbeiten Hilfsverben: sein, haben, werden wollen, sollen, dürfen, mögen, können, müssen (Modalverben!) Trennbare und untrennbare Verben: Neben den einfachen Verben (bauen, singen, fahren) gibt es im Deutschen zusammengesetzte und abgeleitete Verben. Deren erste Glieder sind teils untrennbar, teils trennbar: untrennbar: entgehen, erzählen, verfallen trennbar: abfahren, ankommen, mitbestimmen Verben, Substantive, Adjektive, Adverbien und Präpositionen als Vorsilben: In diesem Falle gilt als Normalfall die Getrenntschreibung, die Zusammenschreibung ist Ausnahme. Verbindungen mit sein werden immer getrennt geschrieben: zufrieden sein, zu Mute sein. Verb Verb: Treffen 2 Verben aufeinander, so werden sie grundsätzlich getrennt geschrieben: kennen lernen, liegen lassen, sitzen bleiben Substantiv Verb: Grundsätzlich wird die Verbindung von Substantiv und Verb als trennbare Wortgruppe aufgefasst. Das Substantiv wird groß geschrieben. Ausnahmen sind jene Fälle, bei denen das vorangestellte Substantiv entweder nicht mehr selbständig vorkommt oder in seiner Bedeutung verblasst ist. Auto fahren, Rad fahren, Ski laufen, Schlange stehen. Aber: heimkehren, irreführen, preisgeben, standhalten, stattfinden, teilnehmen Untrennbare Zusammensetzungen gibt es fast ausschließlich nur im Infinitiv: bergsteigen, kopfrechnen, notlanden, segelfliegen, sonnenbaden, wettschwimmen. Wenn das Partizip möglich ist, tritt – ge zwischen Susbtantiv und Verb: notgelandet, hausgehalten, probegelaufen. Adjektiv Verb: Hier gilt die Regel der Steigerbarkeit/Erweiterbarkeit mit „sehr: Ist das Adjektiv steigerbar/erweiterbar, wird die Wortgruppe getrennt geschrieben, ansonsten ist es eine untrennbare Zusammensetzung: gut schreiben wie: besser schreiben) kurz treten, locker sitzen Ebenso Adjektive auf – ig, isch, lich: übrig bleiben, kritisch denken. Dagegen weil nicht trennbar: langweilen, liebkosen, vollbringen) Adverb Verb: Die Getrenntschreibung gilt bei allen zusammengesetzten Adverbien: Abhanden kommen, abseits stehen, auseinander laufen, auswendig lernen. Präposition Verb: Zusammensetzungen mit durch-, hinter-, über-, um-, unter- werden zusammengeschrieben, wenn der Akzent auf der Stammsilbe liegt: Durchbrechen, hintergehen, übersetzen, umgehen Wird die Präposition hingegen zusammen mit dem nachfolgenden Verb als Wortgruppe aufgefasst und liegt der Akzent auf der Präposition wird in der flektierten Form getrennt geschrieben: Abfahren – er fährt ab Folgende Varianten sind möglich: Danksagen – Dank sagen Gewährleisten – Gewähr leisten Imstande sein – im Stande sein Zumute sein – zu Mute sein Infrage stellen – in Frage stellen Persönliche und unpersönliche Verben: Persönliche Verben: ich bade, du badest, er badet Unpersönliche Verben: es schneit, es regnet, es donnert, es stürmt. Reflexive Verben und reziproke Verben: Reflexive Verben: Sich beeilen, sich waschen Reziproke Verben: Reziproke Verben kommen nur im Plural vor, da stets mindestens 2 Personen beteiligt sein müssen. Wir treffen uns. Ihr begnetet euch. Sie schlagen sich. Die Aktionsarten der Verben: Die Verben der deutschen Sprache werden je nach ihrer Bedeutung in Handlungsverben (arbeiten, lachen),Vorgangsverben (blühen, schlafen), Zustandsverben (bleiben, wohnen) unterteilt. Das Tempus Siehe Kopien Funktionen der Tempora Das Präsens 1. Das Präsens drückt ein Geschehen aus, das zum Zeitpunkt der Aussage andauert: Die Tochter zieht sich modisch an. 2. Das Präsens drückt allgemein gültige Sachverhalte aus: Jede Generation kritisiert die andere: 3. Das Präsens drückt Zukünftiges aus: Morgen fliege ich nach New York. 4. Das Präsens drückt Vergangenes aus: 1832 stirbt Goethe historisches Präsens). Zwei Stunden in einem überfüllten Bus. Wir sind die einzigen Fremden in dieser schaukelnden Sardinenbüchse lebhafte Schilderung: episches Präsens). 5. Das Präsens wird in Schlagzeilen gebraucht: Arafat bittet Staatengemeinschaft um Hilfe (Süddeutsche Zeitung). 6. Das Präsens drückt einen Befehl aus: Du räumst jetzt dein Zimmer auf! 7. Das Präsens kann auch eine Vermutung ausdrücken in Verbindung mit einem Partikel): Das geht schon in Ordnung. Sie ist wohl zu Hause. Das Präteritum 1. Das Präteritum wird stets gebraucht, um eine Handlung (ein Geschehen) mitzuteilen, die zum Sprechzeitpunkt vergangen oder abgeschlossen ist Die Umfrage ergab, dass die Umgangsformen wieder förmlicher geworden seien. 2. Das Präteritum ist das charakteristische Erzähltempus in der geschriebenen Sprache episches Präteritum): Eines Morgens kam Ulrich nach Hause und war übel zugerichtet. 3. Das Präteritum dominiert als Vergangenheitstempus bei „haben, sein, werden, wenn sie als Vollverben benutzt werden sowie bei den modalen Hilfsverben: Ich hatte kein Geld bei mir. Er wollte dir nur helfen. 4. Bei einer Reihe von Verben wird als Ausdruck der Vergangenheit ausschließlich das Präteritum verwendet! angehen: Das ging niemanden etwas an. gehen: Das Zimmer ging auf die Straße. pflegen: Er pflegte länger zu schlafen. scheinen: Es schien kein Ende zu nehmen. fortfahren: Der Redner fuhr mit seinem Vortrag fort. heißen: Das hieß nichts anderes, als dass er die Tat begangen hatte. Das Perfekt 1. Das Perfekt drückt im Allgemeinen den Vollzug einer Handlung im Vergangenen, Gegenwärtigen oder Zukünftigen aus: Morgen habe ich die Prüfung bestanden. Dabei kann ein Adverb oder ein Temporalsatz den Zeitpunkt verdeutlichen: Gestern hat er das Auto gekauft. 2. Das Perfekt wird dann gebraucht, wenn das Geschehen bis an den Sprechzeitpunkt heranreicht: Gestern hat er das Auto gekauft. 3. Das Perfekt wird wie das Präsens bei allgemein gültigen Aussagen verwendet: Das haben wir immer so gemacht. Das Plusquamperfekt 1.Wie das Perfekt drückt das Plusquamperfekt den Vollzug einer Handlung/eines Geschehens aus, allerdings nicht für Gegenwart oder Zukunft, sondern ausschließlich für die Vergangenheit. Ich hatte gerade den Fernsehapparat eingeschaltet, da klingelte das Telefon. 2. Das P. steht in einem zeitlichen Verhältnis zum Präteritum, ähnlich dem Verhältnis des Perfekts zum Präsens. Das wird deutlich in temporalen Nebensätzen. Nachdem wir gegessen hatten, rauchte er eine Zigarette. Das Futur 1. Das Futur drückt zukünftiges Geschehen ohne Rücksicht auf die tatsächliche Verwirklichung aus: Er wird auf die Universität gehen. Dieser Bezug auf Zukünftiges kann durch ein Temporaladverb verdeutlicht werden. Morgen werden wir nach München fahren. 2. Das Futur drückt aber auch Gegenwärtiges aus; dabei erwartet der Sprecher Zustimmung. Häufig handelt es sich hier um rhetorische Floskeln oder Sprechhülsen: Sie werden mir sicher zustimmen, meine Damen und Herren 3. Im Futur ist fast immer ein modaler Aspekt enthalten, der von Gewissheit über Vermutung, Unsicherheit und Zweifel bis zum Nichtglauben reicht: Das wird Vater regeln! Gewissheit) Das wird er schon schaffen! (Zuversicht) Er wird jetzt zu Hause sein. (Vermutung) Oft werden in diesem Zusammenhang Begriffe wie „vielleicht, wohl, sicher, bestimmt gebraucht. Das Futur II 1. Das Futur II drückt Zukünftiges aus, also etwas, das man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt als abgeschlossen vorstellt. Dabei schwingt stets ein Moment der Unsicherheit mit: Er wird (wohl) die Lösung gefunden haben. Diese Funktion des Futurs II ist austauschbar mit dem Perfekt: Er hat (wohl) die Lösung gefunden. 2. Häufiger ist der Gebrauch des Futurs II zur Kennzeichnung vergangenen Geschehens, das vermutet wird: Der Gast wird (wohl) (letzte Woche) abgereist sein. Die Zeitenfolge: 1. Bei einem Temporalsatz, der mit „nachdem beginnt, lautet die Regel: Perfekt im Nebensatz, dann Präsens im Hauptsatz; Plusquamperfekt im Nebensatz, dann Präteritum im Hauptsatz. Nachdem er das akzeptiert hat, ist alles klar. Nachdem er das akzeptiert hatte, war alles klar. Das Genus des Verbs: Aktiv und Passiv Das Formensystem von Aktiv und Passiv: Aktiv Präsens Präteritum Perfekt Ich operiere Ich operierte Ich habe operiert Plusquamperfekt Ich hatte operiert Futur Ich werde operieren Futur II Ich werde operiert haben Werden –Passiv (Vorgangspassiv) Ich werde operiert Ich wurde operiert Ich bin operiert worden Ich war operiert worden Ich werde operiert werden Ich werde operiert worden sein Sein – Passiv (Zustandspassiv) Ich bin operiert Ich war operiert Ich bin operiert gewesen Ich war operiert gewesen Ich werde operiert sein Ich werde operiert gewesen sein