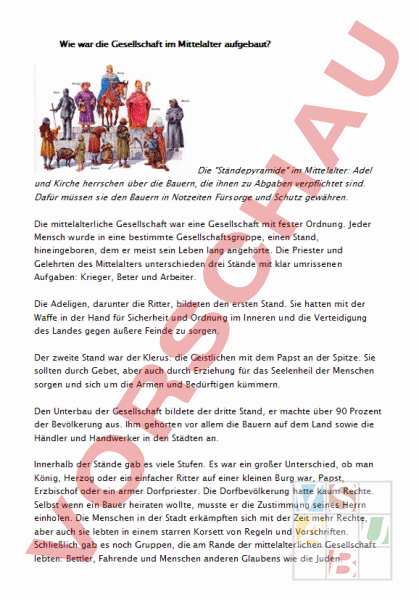Arbeitsblatt: unterschiedliche Lesetexte
Material-Details
einfache Texte für leseschwache Schüler
Deutsch
Textverständnis
6. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
2567
1567
58
01.11.2006
Autor/in
Ingrid Schatzberger
Land: andere Länder
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Wie war die Gesellschaft im Mittelalter aufgebaut? Die Ständepyramide im Mittelalter: Adel und Kirche herrschen über die Bauern, die ihnen zu Abgaben verpflichtet sind. Dafür müssen sie den Bauern in Notzeiten Fürsorge und Schutz gewähren. Die mittelalterliche Gesellschaft war eine Gesellschaft mit fester Ordnung. Jeder Mensch wurde in eine bestimmte Gesellschaftsgruppe, einen Stand, hineingeboren, dem er meist sein Leben lang angehörte. Die Priester und Gelehrten des Mittelalters unterschieden drei Stände mit klar umrissenen Aufgaben: Krieger, Beter und Arbeiter. Die Adeligen, darunter die Ritter, bildeten den ersten Stand. Sie hatten mit der Waffe in der Hand für Sicherheit und Ordnung im Inneren und die Verteidigung des Landes gegen äußere Feinde zu sorgen. Der zweite Stand war der Klerus: die Geistlichen mit dem Papst an der Spitze. Sie sollten durch Gebet, aber auch durch Erziehung für das Seelenheil der Menschen sorgen und sich um die Armen und Bedürftigen kümmern. Den Unterbau der Gesellschaft bildete der dritte Stand, er machte über 90 Prozent der Bevölkerung aus. Ihm gehörten vor allem die Bauern auf dem Land sowie die Händler und Handwerker in den Städten an. Innerhalb der Stände gab es viele Stufen. Es war ein großer Unterschied, ob man König, Herzog oder ein einfacher Ritter auf einer kleinen Burg war, Papst, Erzbischof oder ein armer Dorfpriester. Die Dorfbevölkerung hatte kaum Rechte. Selbst wenn ein Bauer heiraten wollte, musste er die Zustimmung seines Herrn einholen. Die Menschen in der Stadt erkämpften sich mit der Zeit mehr Rechte, aber auch sie lebten in einem starren Korsett von Regeln und Vorschriften. Schließlich gab es noch Gruppen, die am Rande der mittelalterlichen Gesellschaft lebten: Bettler, Fahrende und Menschen anderen Glaubens wie die Juden. Warum und wo entstanden Städte? Die ungepflasterten Straßen der Städte waren voller Schmutz, besonders nach einem Regen. Um ihre Schuhe zu schützen, trugen die Leute oft hölzerne Überschuhe, so genannte Trippen. Wo sich wichtige Handelsstraßen und schiffbare Flüsse kreuzten, hatten schon die Römer ummauerte Städte mit großen Brücken gebaut. Nach dem Zerfall des Römerreichs dienten sie oft als Bischofs- oder Fürstensitz. So wurde aus der römischen Provinzhauptstadt Augusta Treverorum die Stadt Trier. Römischen Ursprungs ist auch Regensburg, das sich aus dem Legionslager Castra Regina entwickelte. Insgesamt konzentrierte sich das Leben im Frühmittelalter aber auf den ländlichen Raum, auf die Dörfer, Klöster und Burgen und auf die Königshöfe, die Pfalzen. Wenn Burgen, Pfalzen und Klöster an wichtigen Handelswegen oder Heerstraßen lagen, entstanden oft ringsum kleine Siedlungen. Mit der Zeit wollte man auch diese schützen und umgab sie mit einer Mauer und manchmal mit einem Wassergraben. Während sich so die ersten mittelalterlichen Städte eher naturwüchsig entwickelten, wurden vom 11. Jahrhundert an auch planmäßig Städte gegründet. Kaiser und Fürsten suchten mit ihnen ihre Macht zu stärken. Beispiele sind etwa Lübeck, das als Handelszentrum für Norddeutschland gebaut wurde, oder die Stadt München, mit der Herzog Heinrich der Löwe den Nord-SüdHandel in Bayern kontrollieren wollte. Wie bewegt sich unsere Erde? Die Erde umkreist die Sonne einmal jährlich in einem mittleren Abstand von 149,6 Millionen Kilometer. Das ist eine ideale Entfernung, da es hier für Lebewesen weder zu warm noch zu kalt ist. Die Bahn unseres Planeten ist kein exakter Kreis, sondern eine Ellipse. Bei dieser Bahnform ändert sich der Abstand Erde-Sonne im Laufe des Jahres. In Sonnennähe (Perihel) beträgt er 147,1 Millionen, in Sonnenferne (Aphel) 152,1 Millionen Kilometer. Da wir uns um die Sonne drehen, steht diese für uns jeden Tag in einer etwas anderen Richtung. Im Laufe des Jahres bewegt sie sich scheinbar durch die Sternbilder Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion und Schlangenträger. Die scheinbare Sonnenbahn am Himmel nennt man Ekliptik. Am 1. Januar steht die Sonne im Schützen, den man dann nicht sehen kann, da das Sternbild mit der Sonne zusammen am Tageshimmel ist und von dieser überstrahlt wird. Die Erde dreht sich außerdem in knapp 24 Stunden um ihre Achse, die Linie zwischen Nord-und Südpol. Diese Bewegung nennt man Rotation. Wenn unser Land zur Sonne hingedreht wird, so ist es bei uns hell. Drehen wir uns von der Sonne weg, so wird es dunkel. Auf diese Weise entstehen Tag und Nacht. Durch die Drehung der Erde um ihre Achse, die Linie zwischen Nord- und Südpol, kommen Tag und Nacht zustande. Die Erdachse steht nicht senkrecht auf der Erdbahn, sondern schräg. Im nördlichen Sommer ist die Nordhalbkugel, auf der wir wohnen, zur Sonne hin geneigt. Wir bekommen viel Licht und Wärme, die Sonne steht mittags hoch am Himmel, und die Tage sind lang. Im Winter wenden wir uns von der Sonne ab und erhalten wenig Licht und Wärme. Die Tage sind dann kurz und die Sonne steht auch mittags sehr niedrig. Die Jahreszeiten kommen also durch die Neigung der Erdachse und nicht etwa durch verschiedene Sonnenentfernungen zu Stande. Im tiefsten Winter, Anfang Januar, steht uns die Sonne am nächsten, was jedoch, gemessen an ihrer geringen Mittagshöhe, kaum ins Gewicht fällt. Im Nordsommer ist die Sonne in Erdferne. Wie entstand unser Sonnensystem? Die Erde vor rund vier Milliarden Jahren: Die Uratmosphäre und erste Ozeane haben sich gebildet. Ununterbrochen schlagen Meteorite ein. In der Atmosphäre bilden sich organische Stoffe. Die Milchstraße war rund 7 Milliarden Jahre alt, als unser Sonnensystem vor rund 4,6 Milliarden Jahren vermutlich in einem Sternentstehungsgebiet entstand, in dem sich auch Tausende von anderen Sternen bildeten. Da, wo heute unser Sonnensystem mit seinen Planeten und Monden ist, war zunächst eine langsam rotierende Gas- und Staubwolke. Sie enthielt neben Wasserstoff und Helium auch einen kleinen Prozentsatz von schweren Elementen wie Eisen oder Kohlenstoff. Diese Urwolke zog sich zusammen, da ihre Bestandteile sich gegenseitig anzogen, und drehte sich dabei immer schneller um sich selbst. Schließlich plattete sie sich zu einer Scheibe ab, deren Zentrum die Sonne gebar. Teile der Scheibe ballten sich zu Brocken zusammen, die allmählich zu Planeten anwuchsen. Je massereicher ein Brocken war, desto mehr Materie konnte er aus seiner Umgebung anziehen. Die intensive Strahlung der jungen Sonne pustete große Mengen leichten Wasserstoffs in die äußeren Bereiche des entstehenden Sonnensystems. Dort bildeten sich um kleinere Brocken herum große Wasserstoffkugeln, aus denen Planeten wie Jupiter und Saturn entstanden. Dass unser Planetensystem einmal aus einer Scheibe hervorgegangen sein muss, können wir an seiner Form ablesen. Alle großen Planeten befinden sich ungefähr in einer Ebene, der Ebene der Urscheibe. Sie alle haben auch dieselbe Drehrichtung, nämlich diejenige der Urscheibe. Warum leuchten Sterne? In einer klaren, mondlosen Nacht kann man mit dem bloßen Auge rund 2 000 Sterne erkennen schon mit einem guten Fernglas oder einem kleinen Teleskop dagegen Hunderttausende. Abgesehen von den Planeten wie Venus oder Jupiter sind alle diese Sterne ferne Sonnen, die so weit weg sind, dass sie nur als kleine Lichtpunkte am Nachthimmel erscheinen. Viele von ihnen sind in Wirklichkeit viel heller als unsere Sonne, andere strahlen nur verhältnismäßig wenig Licht ab. Sterne sind große heiße Gaskugeln. In ihrem Inneren ist die Temperatur so hoch, dass dort Kernfusion (Kernverschmelzung) stattfinden kann. Bei diesem Vorgang verschmelzen kleine Atomkerne zu größeren. Dabei werden ungeheure Energiemengen frei. Wie in Milliarden anderen Sternen findet auch in unserer Sonne Kernfusion statt. Vier kleine Wasserstoffatomkerne werden über einige Umwege zu einem großen Heliumatomkern verschmolzen. Dieser ist etwas leichter als seine vier Bausteine. Es geht also Masse verloren, die in Energie (vor allem elektromagnetische Strahlung) umgewandelt wird. Unsere Sonne kann viele Milliarden Jahre lang strahlen, obwohl sie in jeder Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff zu 560 Millionen Tonnen Helium verbrennt. Sie ist ein Stern mit einer vergleichsweise geringen Masse. Massereiche Sterne hingegen gehen sehr verschwenderisch mit ihrem Brennstoff um und leben viel kürzer als unsere Sonne. Alle Sterne bewegen sich mit unvorstellbaren Geschwindigkeiten durchs All. Ihre Entfernung ist aber so groß, dass ein Menschenleben nicht ausreicht, diese Bewegungen zu erkennen. Am Nachthimmel sieht es so aus, als würden gewisse helle Sterne zusammengehören und Figuren bilden, die man Sternbilder nennt. Jahrtausendelang scheinen sie unverändert zu bleiben. Die fernen Sonnen werden im Gegensatz zu den Planeten auch Fixsterne genannt, da man früher glaubte, sie seien am Himmel festgemacht (fixiert) und deshalb bewegungslos, anders als die Planeten.