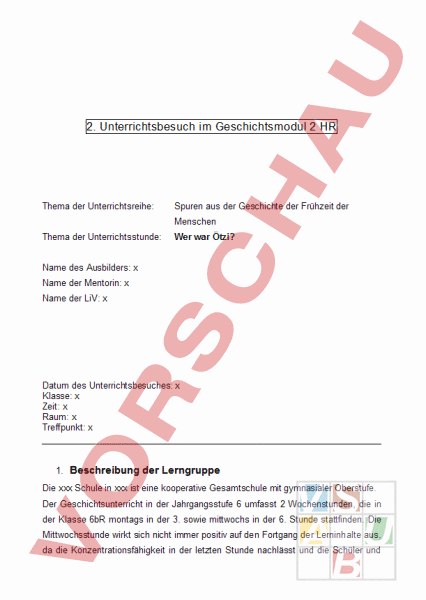Arbeitsblatt: Ötzi
Material-Details
Lehrprobe zum Thema "Wer war Ötzi?"
Geschichte
Altertum
6. Schuljahr
14 Seiten
Statistik
27188
924
17
16.10.2008
Autor/in
ciro1 (Spitzname)
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
2. Unterrichtsbesuch im Geschichtsmodul 2 HR Thema der Unterrichtsreihe: Spuren aus der Geschichte der Frühzeit der Menschen Thema der Unterrichtsstunde: Wer war Ötzi? Name des Ausbilders: Name der Mentorin: Name der LiV: Datum des Unterrichtsbesuches: Klasse: Zeit: Raum: Treffpunkt: 1. Beschreibung der Lerngruppe Die xxx Schule in xxx ist eine kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Der Geschichtsunterricht in der Jahrgangsstufe 6 umfasst 2 Wochenstunden, die in der Klasse 6bR montags in der 3. sowie mittwochs in der 6. Stunde stattfinden. Die Mittwochsstunde wirkt sich nicht immer positiv auf den Fortgang der Lerninhalte aus, da die Konzentrationsfähigkeit in der letzten Stunde nachlässt und die Schüler und Schülerinnen1 häufig motiviert werden müssen, um angemessen zu arbeiten. Dennoch sind die SuS für das neue Fach Geschichte nach Impulssetzung schnell zu begeistern. Die Klasse 6bR ist mir seit Beginn des Referendariats durch regelmäßige Hospitationen und durch angeleiteten Unterricht in den Fächern Religion und Deutsch bekannt. Seit dem Schulanfang nach den Sommerferien unterrichte ich diese Klasse in Geschichte und einen Teil der SuS in Religion eigenverantwortlich. Der hohe Jungenanteil in der Klasse (15 Jungen, 10 Mädchen) führt dazu, dass die Klasse sehr lebhaft und häufig auch unruhig ist. Das stark dominante Verhalten von Leon, Niklas, Kevin und Sebastian verdeutlicht die Präsenz von männlichen Schülern zusätzlich. In der Regel reicht jedoch ein intensiver Blickkontakt oder eine kurze Ermahnung aus, um entstehende „Unruheherde zu beseitigen. Des weiteren zeichnet sich die Lerngruppe durch ein sehr ausgeprägtes Mitteilungs- und Diskussionsbedürfnis aus. Vor allem Jan-Benedict hat schon jetzt ein enorm breit angelegtes historisches Wissen, das sehr speziell ist. Er bringt ständig neue Aspekte in den Geschichtsunterricht mit ein, welche nicht immer qualitativ sind und zu einem fließenden Unterrichtsverlauf beitragen. Die Mädchen der Klasse 6bR sind stärker an einer produktiven Unterrichtsgestaltung sowie funktionierenden Sozialstrukturen interessiert. Hierbei muss vor allem auf die individuelle Wahrnehmung und gleichmäßige Beteiligung aller SuS am Unterricht geachtet werden. Die Klassensprecherin Miriam zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sie in eher unruhigen Situationen versucht für Ruhe zu sorgen. Dennoch hat sie es nicht immer leicht sich gegen den hohen männlichen Anteil durchzusetzen. Die klassischen vorpubertären Konflikte zwischen den Geschlechtern sind nur ansatzweise erkennbar. Hierbei sei vor allem Joanna hervorgehoben, die sich vermehrt mit den Jungen der Klasse abgibt und dadurch auch in manchen Konflikt gerät. Auch sonst wirkt die Lerngruppe noch eher kindlich verspielt. Ismajl hat einen Migrationshintergrund und kann sich nur mühsam seinen Mitschülern anpassen. Er fehlt sehr häufig und ist stets unkonzentriert und abgelenkt. Erwähnenswert ist, dass er und Peter auch ursprünglich für den Hauptschulzweig angemeldet wurden. Da keine 5. Hauptschulklasse zustande kam, wurden beide Schüler in die Realschule eingeteilt. 1 Im folgenden mit SuS abgekürzt. 1 Nach Piaget 2 befinden sich die SuS im vierten kognitiven Entwicklungsstadium, dem sog. formaloperationalen Stadium. Die SuS haben die Fähigkeit zum logischen Denken und die Fähigkeit Operationen auf Verfahren anzuwenden. Demnach können die SuS erkennen, dass archäologische Funde zwar unterschiedliche, aber durchaus gleichwertige Deutungsmöglichkeiten zulassen, je nachdem, welcher Fund in den Vordergrund der Betrachtung rückt. Die heutige Stunde findet im Klassenraum statt, der durch seine Größe und Lage nicht immer die besten Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen und interaktiven Unterricht bietet, da es in diesem begrenzten Raum schwierig ist, Gruppentische zu stellen. 2. Darstellung der Einheit Nach dem Abschluss der Spurensuche in der persönlichen Vergangenheit der einzelnen SuS und der Beschäftigung mit dem Thema „Was ist Geschichte? wird nun der längste Zeitraum der Menschheitsgeschichte thematisiert: die Frühgeschichte. Die einzelnen Stunden ermöglichen den SuS Einblicke in die Lebensumstände der Zeit der Vormenschen, der Zeit der Alt- und Jungsteinzeit sowie der Metallzeit. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen die Menschen in ihren Lebensräumen. Immer wieder muss verdeutlicht werden, dass gerade für die frühen Abschnitte der Menschheitsgeschichte viele Fragen unbeantwortet bleiben. Die SuS werden dadurch ermutigt, eigene Frage zu entwickeln und Vermutungen zu äußern. 2.1 Stellung der Stunde innerhalb der Unterrichtseinheit 1. Stunde: Lucy – nicht Mensch aber auch kein Affe 2. Stunde: Entwicklung des Menschen 3. Stunde: Jäger und Sammler in der Altsteinzeit 4. Stunde: Überleben im Eiszeitalter und Bedeutung des Feuers 5. Stunde: Die ersten Bauern 6. Stunde: Jungsteinzeit: Erfindungen und neue Werkzeuge 7. Stunde: Wer war Ötzi? 8. und 9. Stunde: Kupfer, Bronze und Eisen mit Metall geht vieles besser 2 vgl. Jank, W.; Meyer, H. Didaktische Modelle.5. Auflage. Berlin (1991). S. 191ff. 2 3. Didaktische Überlegungen zur Unterrichtsstunde Während der Beschäftigung mit der Frühzeit der Menschen stellt sich zunächst die Frage nach der Herkunft unseres heutigen historischen Wissens. „Im Sinne eines entdeckenden, erfahrungsorientierten Unterrichts, gewinnen die Schülerinnen und Schüler Einblick in die Arbeitsweise von Archäologen und führen erste eigene Deutungsversuche durch.3 Im Zentrum der hier beschriebenen Stunde steht die Frage nach der jungsteinzeitlichen Gletschermumie Ötzi, deren Name „durch die Medien fester Bestandteil des Sprachgebrauchs4 geworden ist. Wie von Hackenberger/Schalück vorgeschlagen, findet die Behandlung des Ötzi im Anschluss an die Behandlung von Themen der Alt- und Jungsteinzeit statt.5 Die SuS besitzen also die vom Lehrplan geforderten Kenntnisse über das Leben der Jäger und Sammler in der Altsteinzeit sowie über die neolithische Revolution, den Übergang zur produzierenden Wirtschaftsweise und die damit einhergehende Veränderung der Lebens- und Arbeitsweise der Frühmenschen. Generell sind Themen der Urgeschichte für die meisten SuS interessant und können viele Lernende für das neue Fach Geschichte begeistern. Die Beschäftigung mit Ötzi stellt zusätzlich eine Motivation dar. Das liegt nicht nur daran, dass dieser bisher „komplexeste Fund6 seiner Epoche „Weltruhm7 erlangte und daher einigen SuS bereits bekannt sein dürfte. Vielmehr ist der Fall Ötzi in besonderem Maße geeignet, „lebendige Geschichte, hier eine „Entdeckungsreise durch die Jungsteinzeit anhand eines anschaulichen 8 Fallbeispiels zu vermitteln. Geschichte wird hier also konkret und greifbar. Zusätzlich lässt sich, wie auch im Lehrplan vorgeschlagen, am Beispiel des Ötzi der Umgang mit archäologischen Funden als Quelle für den Geschichtsunterricht einüben bzw. schulen. Die gewählte Thematik sowie die Überreste, die bei der 3 Lehrplan Geschichte Hessen. Bildungsgang Realschule 5-10. S. 8. Sulzenbacher, G.: Ötzi und Juanita-Fenster in die Vergangenheit. Archäologische Funde entschlüsseln die (Vor-) Geschichte der Menschen. In: Praxis Geschichte 2/2002. S. 27. 5 Hackenberg, W. Schalück, A.: „Er stand uns nichts nach. Ötzi und seine Welt. In: Geschichte lernen 70/1999. S. 46. 6 Vgl. ebd. S. 46 7 Vgl. ebd. S.46 8 Sulzenbacher, G.: Ötzi und Juanita-Fenster in die Vergangenheit. Archäologische Funde entschlüsseln die (Vor-) Geschichte der Menschen. In: Praxis Geschichte 2/2002. S. 30. 4 3 Gletschermumie gefunden wurden, legen einen forschend-entdeckenden Ansatz nahe.9 Fragen über den Beruf des Ötzi lassen sich anhand der Fundstücke nicht eindeutig beantworten. Indem sich die SuS näher über die Funde informieren und sie hinsichtlich der Frage, wer Ötzi war analysieren, vergegenwärtigen sie sich einerseits, dass die Ereignisse der Vergangenheit nur in Form von Spuren und von Überresten verschiedenster Art gegenwärtig sind. Außerdem erfahren die Lernenden, dass es bei der „Interpretation archäologischer Funde durchaus gleichwertige plausible Interpretationslinien und mehrere Deutungsmöglichkeiten gibt, je nachdem, welche Fundstücke stärker in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt werden.10 Abschließend lässt sich sagen, dass die Frage nach den Voraussetzungen des langsamen gesellschaftlichen, technologischen und kulturellen Wandels im Übergang von der Alt- zur Jungsteinzeit zu der Feststellung führt, dass das Streben nach der Nutzung natürlicher Ressourcen das Leben der Menschen bis heute beeinflusst. 11 4. Methodische Überlegungen zur Unterrichtsstunde12 Zu Beginn der Stunde sitzen die SuS im Halbkreis vor der Tafel. Sie sollen sich spontan zu der anprojizierten Folie der Gletschermumie äußern. Das Bild zeigt den mumifizierten Ötzi an seiner Fundstelle in den Ötztaler Alpen. Eine ganze Reihe von Lerntätigkeiten lassen sich anhand eines Bildes anregen. Die SuS sollen es kommentieren, hinterfragen, erweitern und deuten. Die Lehrkraft ergänzt ggf. wichtige Zusatzinformationen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle SuS über die gleichen Basisinformationen verfügen. Das Bild soll auch dazu anregen darüber zu spekulieren, wie es außerhalb des Bildes aussehen könnte.13 Aus diesem Grunde sollen die SuS Fragen an Ötzi formulieren. Natürlich können nicht alle Fragen in der Stunde beantwortet werden und berücksichtigt werden. Alle Fragen werden stichwortartig von der Lehrkraft an 9 Vgl. Hackenberg, W. Schalück, A.: „Er stand uns nichts nach. Ötzi und seine Welt. In: Geschichte lernen 70/1999. S. 47. 10 Vgl. Sulzenbacher, G.: Ötzi und Juanita-Fenster in die Vergangenheit. Archäologische Funde entschlüsseln die (Vor-) Geschichte der Menschen. In: Praxis Geschichte 2/2002. S. S. 30. 11 Vgl. Lehrplan Geschichte Hessen. Bildungsgang Realschule 5-10. S. 8. 12 Vgl. Meyer, H.: Unterrichtsmethoden II. Praxisband. Berlin (1987). S. 194ff., S. 58, S. 280 ff. 13 vgl. Gautschi, P. Geschichte lehren. Lernwege und Lernsituationen für Jugendliche. Bern (2000). S.123. 4 der Tafel notiert, um ggf. später wieder darauf zurückzugreifen. Unbeantwortete Fragen können in der nächsten Geschichtsstunde aufgegriffen werden. In dieser Stunde soll es nämlich vorrangig um den Beruf14 Ötzis gehen. Die Problemstellung der Stunde ergibt also den Versuch, Antworten auf diverse Fragen an Ötzi zu finden. Die SuS begeben sich also auf eine Forscherreise und versuchen etwas über Ötzis Leben herauszufinden. Fünf Schülergruppen bilden die Forscherteams. Die einzelnen Forscher werden den Teams zugelost. Die fünf Teams bearbeiten drei verschiedenen Themen: War Ötzi ein Hirte? War Ötzi ein Bauer? oder war Ötzi ein Jäger? Die Forscherteams beschäftigen sich mit unterschiedlichen Berufen der Jungsteinzeit und versuchen herauszubekommen, welchen Beruf Ötzi ausgeübt haben könnte. Des Weiteren beschäftigen sie sich mit den archäologischen Funden. Dabei soll den Lernenden lediglich eine Auswahl der verschiedenen Funde präsentiert werden. Eine Beschränkung auf die zugänglichsten bzw. relativ leicht zu interpretierenden Stücke liegt, angesichts des Alters der Lerngruppe, nahe. Für die hier beschriebene Stunde habe ich einen forschend-entdeckenden Ansatz gewählt, der sich motivierend auf die SuS auswirkt. Die Sozialform der Gruppenarbeit ergibt sich zum einen aus dem gewählten forschend-entdeckenden Ansatz, bei dem die SuS selbst in die Rolle von Forschern schlüpfen und in Analogie zur wissenschaftlichen Arbeit in Forscherteams arbeiten. Zum anderen kann in der Gruppe bereits ein intensiver Austausch über die Arbeitsergebnisse stattfinden. Angelehnt an das Praxisbeispiel die „Ötzi Konferenz von Gudrun Sulzenbacher sollen die SuS im Anschluss an die Erarbeitungsphase im Stuhlkreis zusammenkommen. Die Arbeitsergebnisse werden in Form einer angeleiteten Diskussion präsentiert. Erst werden die einzelnen Berufe näher beschrieben und anschließend soll der Frage nachgegangen werden, welchen Beruf denn Ötzi ausgeübt hat. Ein Poster zeigt eine rekonstruierte Person, wie Ötzi früher ausgesehen haben könnte. Die SuS sollen sich bestenfalls auf das Poster beziehen und ihre Argumente mit Hilfe des Posters belegen. Durch die Diskussionsrunde kommt die ganze Klasse miteinander ins Gespräch und die SuS können erneut ihre kommunikativen Fähigkeiten in Bezug auf das Fach Geschichte und ihr historisches Wissen ausbauen, denn Geschichtsunterricht soll immer Platz für Meinungsaustausche bieten. 14 natürlich hat die Bezeichnung „Beruf nicht die heutige Bedeutung eines Berufes. Dennoch scheint es passend, vor allem für die SuS Ötzis Tätigkeiten als Beruf zu bezeichnen. 5 Durch die Diskussion über die einzelnen Berufsmöglichkeiten und dadurch auch Lebensmöglichkeiten Ötzis wird den SuS klar werden, dass man sich nicht 100 %ig festlegen kann, wie Ötzi seinen Alltag gestaltet haben muss. Forscher konnten bisher auch noch keine genaue Aussagen über den Alltag Ötzis machen. Hierbei wird erneut deutlich, wie kontrovers Teilaspekte des Faches Geschichte sind und wie schwierig es ist, treffende Aussagen über längst Vergangenes anzustellen. Während des Gespräches ist es möglich, dass die SuS selbst erarbeiten, dass wir heutzutage spezialisiert in unseren Berufen arbeiten und es nicht möglich ist, alle Tätigkeiten zu beherrschen. 4.1 Lernziele Die SuS sollen. .mit Hilfe eines visuellen Impulses zu dem Unterrichtsthema hingeführt werden und Fragen an die Gletschermumie formulieren können. .in Ergänzung zu ihrem möglicherweise vorhandenen Vorwissen zunächst, durch die Lehrerin, genauer über den Fund der Gletschermumie informiert werden und zur eigenständigen Arbeit mit dem vorgegebenen Quellenmaterial angeregt werden. .sich in Forschergruppen mit den verschiedenen Berufen Jäger, Hirte und Bauer der Steinzeit beschäftigen und überlegen, welche Tätigkeiten Ötzi ausüben musste, um zu überleben. .im Gesprächskreis ihre Meinung zum Beruf Ötzi begründet vertreten können sowie die Arbeitsergebnisse der anderen kritisch würdigen können. . erkennen, wie kontrovers die Geschichtswissenschaft ist und lernen, dass nicht jede Frage an die Vergangenheit beantwortet werden kann. 6 5. Verlaufsplan der Unterrichtsstunde Unterrichtsphase Geplantes Arbeits- und Medien Unterrichtsgeschehen Sozialform Einstieg Lehrerin legt Folie von Gletschermumie auf. SuS äußern sich spontan zu dem Bild. Hinführung Lehrerin stellt Frage zur Mumie: „Was würdest du Ötzi gerne fragen? Was interessiert euch an seinem Leben? SuS stellen Fragen, Lehrerin notiert Stichworte dazu an der Tafel, um ggf. später darauf zurückzugreifen. Visueller OHP Impuls Folie S-S Gespräch Ggf. Ergänzungen von der Lehrerin OHP Impuls Folie Problemstellung/ Vorbereitung Erarbeitung Präsentation S-S Gespräch Tafel Wir versuchen Antworten auf L-S Gespräch einige Fragen zu bekommen, wer Ötzi war. Hierzu müssen Forscherteams gebildet werden, welche Nachforschungen zu Ötzi anstellen. Einteilung der Forscherteams 5 Forscherteams werden gebildet Die Forscherteams beschäftigen sich mit verschiedenen Berufen aus der Jungsteinzeit und versuchen herauszubekommen, welchen Beruf Ötzi ausgeübt haben könnte. Ergebnisse werden im Stuhlkreis vorgestellt. Auslosung der Gruppe Gruppenarbeit AB Aufträge Schülervortrag Notizen der SuS auf Karteikarten Sicherung Eine Diskussion wird angeleitet. Diskutiert werden Diskussion im Plenum, die 7 die Fragen, wer war Ötzi, was musste er alles können, kann man genau sagen, wer er war. SuS sollen sich beim Argumentieren auf das ÖtziPoster beziehen und dort ihre Erkenntnisse aufzeigen. einzelnen Forscherteams vertreten ihre Gruppenmeinung Ötzi-Poster Ergebnis der Diskussion sollte sein, dass es noch nicht gelungen ist, genau festzustellen, wer Ötzi war. Literaturverzeichnis Gautschi, P. Geschichte lehren. Lernwege und Lernsituationen für Jugendliche. Bern (2000). Hackenberg, W. Schalück, A.: „Er stand uns nichts nach. Ötzi und seine Welt. In: Geschichte lernen 70/1999. Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle.5. Auflage. Berlin (1991). Lehrplan Geschichte Hessen. Bildungsgang Realschule 5-10. Meyer, H.: Unterrichtsmethoden II. Praxisband. Berlin (1987). S. 194ff., S. 58, S. 280 ff. Sulzenbacher, G.: Ötzi und Juanita-Fenster in die Vergangenheit. Archäologische Funde entschlüsseln die (Vor-) Geschichte der Menschen. In: Praxis Geschichte 2/2002. Anhang: ABs und Arbeitsaufträge 8 Gruppe 1 War Ötzi ein Jäger? Ötzis Lebensspanne fällt in eine Zeit großer Umwälzungen, die das Leben der Menschen in Europa einschneidend verändert haben. Es ist der Übergang vom Jäger- und Sammlerdasein zu Ackerbau und Viehzucht. Die Jagd spielt aber weiterhin eine wichtige Rolle. Auf Großwildjagd gingen die Menschen der Jungsteinzeit wahrscheinlich in Gruppen. Die einen trieben Tiere, die anderen erwarteten sie mit tödlichen Pfeilen. Wichtigste Jagdtiere waren Hirsch, Wildschwein, Bär, Reh, Gämse und Steinbock. Hasen trieb man ins gespannte Netz und erschlug sie dann mit einer Keule. Fische wurden nicht nur mithilfe von Speeren, sondern auch mit Reusen (schlauchförmige Netze) gefangen. Mit Feuersteingeräten wurde das erlangte Wild verarbeitet. Feuer machte das Fleisch bekömmlicher und leichter verdaulich. Bei Ötzi deuten Pfeil und Bogen, aber auch das Netz in seiner Rückentrage auf die Jagd hin. Auch er konnte mit seinen Feursteingeräten erlegtes Wild verarbeiten. Wenn Ötzi ein Jäger war- warum fand man ihn dann in der Gletscherregion und ohne gebrauchsfertige Waffen? 9 Gruppe 2 War Ötzi ein Bauer? In der Jungsteinzeit legten die Menschen ihre Äcker an und bauten ihre Dörfer. Grundlage ihrer Ernährung waren nun Hülsenfrüchte (Erbsen und Linsen), Ölpflanzen (Lein und Mohn) und vor allem Getreide (Gerste und drei Weizenarten). Die Weizenarten lieferten Brotgetreide, während Gerste eher als Brei oder Einlage in Eintopfgerichten verzehrt wurde. Die reifen Ähren wurden mit Holzsicheln, in denen scharfe Feuersteinklingen eingesetzt waren, geschnitten und dann auf Fellen durchgeklopft. Die Halme dienten als Viehfutter. Zum Reinigen wurden die Körner in einem Flechtkorb hochgeworfen und die Hülsen weggepustet. Gelagert wurde das Korn in Tonkrügen. Als Mahlsteine dienten ein großer flacher und ein kleiner runder Stein Getreidefunde in der Kleidung und im Glutbehälter aus Birkenrinde belegen, dass Ötzi Kontakt zu einer Ackerbau treibenden Gemeinschaft hatte. Wenn er Bauer oder Viehzüchter war und folglich weder Acker noch Vieh vernachlässigen durfte, warum hatte er sich dann für einen längeren Aufenthalt fern der Talsiedlung ausgerüstet? 10 Gruppe 3 War Ötzi ein Hirte? Der Ausdruck Hirte bezeichnet eine Person, die eine Herde von Nutztieren hütet und versorgt. Der Hirte bleibt zum Teil auch nachts auf der Weide und beschützt seine Herde (zumeist Schafe) vor Räubern und Raubtieren. Um sich gegen die Gefahren wehren zu können, hat der Hirte nur eine geringe Bewaffnung. Außerdem führt er oft einen oder mehrere Hunde mit sich, die ihm helfen, seine Herde zusammenzuhalten. Da Hirten in früheren Zeiten ununterbrochen bei ihren Herden blieben und diese nach der Abweidung des Grases an eine andere Stelle führen mussten, hatten die Hirten oft keinen festen Wohnsitz. Sie waren Nomaden. In unmittelbarer Nähe des Fundortes von Ötzi, im hinteren Ötztal, befanden sich schon zu seiner Zeit ausgedehnte Weidengebiete. Noch heute treiben die Bauern dort ihre Schafe über denselben Übergang, den auch Ötzi für seinen Weg benutzte. Er war für längere Aufenthalte im Hochgebirge gut ausgerüstet. Lagerfeuer machen, Nahrung beschaffen und Beschädigtes reparieren gehören zum Alltag eines Wanderhirten. Wenn Ötzi ein Hirte war, warum fand man in seinen Kleidern keine Haare von Schafen, Ziegen oder Hunden? 11 Arbeitsaufträge 1. 2. 3. 4. 5. Lest euch gemeinsam den Text durch! Macht euch Stichpunkte, mit denen ihr später euren Beruf beschreiben könnt! Welche Gegenstände sind auf eurem Arbeitsblatt abgebildet? Erläutert, wozu Ötzi die Gegenstände vermutlich gebraucht hat und überlegt, warum sie gerade aus diesem Material angefertigt wurden! Ihr seid nun Experten für euren Beruf und müsst in der Klasse die Meinung vertreten, dass Ötzi euren Beruf ausgeübt hat. Überlegt euch passende Argumente! Schreibt eure Ergebnisse auf die Karteikarten! Ihr habt 15 Minuten Zeit 12