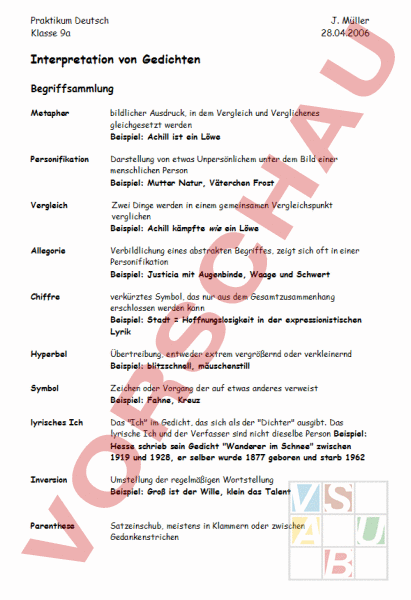Arbeitsblatt: Stichworte mit Erklärung zur Gedichtsinterpretation
Material-Details
Stichworte mit Erklärung zur Gedichtsinterpretation
Deutsch
Leseförderung / Literatur
9. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
27567
1105
20
23.10.2008
Autor/in
Judith Zumstein
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Praktikum Deutsch Klasse 9a J. Müller 28.04.2006 Interpretation von Gedichten Begriffsammlung Metapher bildlicher Ausdruck, in dem Vergleich und Verglichenes gleichgesetzt werden Beispiel: Achill ist ein Löwe Personifikation Darstellung von etwas Unpersönlichem unter dem Bild einer menschlichen Person Beispiel: Mutter Natur, Väterchen Frost Vergleich Zwei Dinge werden in einem gemeinsamen Vergleichspunkt verglichen Beispiel: Achill kämpfte wie ein Löwe Allegorie Verbildlichung eines abstrakten Begriffes, zeigt sich oft in einer Personifikation Beispiel: Justicia mit Augenbinde, Waage und Schwert Chiffre verkürztes Symbol, das nur aus dem Gesamtzusammenhang erschlossen werden kann Beispiel: Stadt Hoffnungslosigkeit in der expressionistischen Lyrik Hyperbel Übertreibung, entweder extrem vergrößernd oder verkleinernd Beispiel: blitzschnell, mäuschenstill Symbol Zeichen oder Vorgang der auf etwas anderes verweist Beispiel: Fahne, Kreuz lyrisches Ich Das Ich im Gedicht, das sich als der Dichter ausgibt. Das lyrische Ich und der Verfasser sind nicht dieselbe Person Beispiel: Hesse schrieb sein Gedicht Wanderer im Schnee zwischen 1919 und 1928, er selber wurde 1877 geboren und starb 1962 Inversion Umstellung der regelmäßigen Wortstellung Beispiel: Groß ist der Wille, klein das Talent Parenthese Satzeinschub, meistens in Klammern oder zwischen Gedankenstrichen Praktikum Deutsch Klasse 9a J. Müller 28.04.2006 Alliteration zwei oder mehr Wörter fangen mit demselben Laut an Beispiel: mit Mann und Maus Anapher Wiederholung des gleichen Wortes an Vers- oder Satzanfängen Antonym Wort mit gegensätzlicher Bedeutung Elision Auslassen eines unbetonten Vokals, häufig um das metrische Schema einzuhalten Euphemismus beschönigender Ausdruck Beispiel: verschlanken statt kürzen, antifaschistischer Schutzwall für die Mauer Klimax Steigerung Beispiel: Bauer, Bürger und Adel Onomatopoesie Lautmalerei, Wortschöpfung zum Zweck der Klangmalerei Beispiel: Der Flügelflagel gaustert durchs Wiruwaruwolz, die rote Fingur plaustert,/ und grausig gutzt der Golz. Häufige Verwendung in der Lyrik des Expressionismus Oxymoron Verbindung scheinbar sich ausschließender Begriffe Beispiel: helldunkel, beredtes Schweigen, alter Knabe Paradoxon scheinbar widersinnige Behauptung Beispiel: und immer süßer tut es weh Polysyndeton Wiederholung desselben Wortes innerhalb desselben Satzes, auch in flektierten Formen Beispiel: und es wallet und siedet und zischet Repetitio Wiederholung Synästhesie Ansprechen von mehreren Sinnesorganen zugleich Beispiel: schreiendes Rot, helle und dunkle Töne Tautologie derselbe Sachverhalt wird mit mehreren Wörtern mit gleicher/ähnlicher Bedeutung beschrieben Beispiel: er dreht und wendet sich Zäsur Einschnitt im Vers, häufig Versmitte Beispiel: Was dieser heute baut reißt jener morgen ein Praktikum Deutsch Klasse 9a J. Müller 28.04.2006 Reimarten Paarreim: aa bb Mitternacht schlägt eine Uhr im Tal, Mond am Himmel wandert kalt und kahl. Unterwegs im Schnee und Mondenschein Geh mit meinem Schatten ich allein. Hermann Hesse: Wanderer im Schnee Kreuzreim: ab ab Als sie einander acht Jahre kannten (Und man darf sagen, sie kannten sich gut), Kam ihre Liebe plötzlich abhanden, Wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. E. Kästner, Sachliche Romanze Umarmender oder verschränkter Reim: ab ba Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, In allen Lüften hallt es wie Geschrei, Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei Und an den Küsten liest man steigt die Flut. Hoddis, Weltende Identischer Reim: Zwei Mal das identische Reimwort Alte Plätze sonnig schweigen, Tief in Blau und Gold versponnen Traumhaft hasten sanfte Nonnen Unter schwüler Buchen Schweigen. Georg Trakl, Die schöne Stadt Waise Ein einzelner Vers in einem Gedicht, der sich nicht auf einen anderen Vers reimt. Praktikum Deutsch Klasse 9a J. Müller 28.04.2006 Gedichtsorten Ballade handlungsreiches, vielfach dämonisch-spukhaftes und meist tragisches Geschehen aus Geschichte, Sage oder Mythos. Mensch im Spiel übersinnlicher Mächte Dinggedicht unpersönliche, episch-objektive Beschreibung in Gedichtform; hinter der Oberfläche des Dinggedichts befindet sich in der Regel immer noch eine zweite wichtigere Aussageebene Elegie Gedichtform zum Ausdruck von Trauer und Liebe Lied einfache, strophische Gliederung, häufig allgemein gültiger Charakter, Mensch in seiner Wechselbeziehung zur Natur Romanze wunderbare Ereignisse oder Liebesgeschichten als kurze Verserzählung in gedrängter Form, unmittelbar gemüt- und phantasieeregende Form Sonett Gedichtform, 2 Quartette (2 Strophen à 4 Verse) und 2 Terzette, (2 Strophen à 3 Verse); äußerst strenge Form; Reimschema: abba abba cdc dcd Praktikum Deutsch Klasse 9a J. Müller 28.04.2006 Aufbau einer Interpretation I. Einleitung 1. Gedichttitel, Autor 2. Gedichtart (Sonett, Ballade .) II. Hauptteil Formale Aspekte 1. Strophen/Verse 2. Reimschema/Kadenzen Sprachliche Aspekte 1. Sprache Wortwahl und Stil (sachlich, distanziert, lyrisch, emotional .) 2. Wortarten hier v.a. Adjektive/Adverbien, Verben, Pronomina, Interjektionen 3. Tempus Präsens, Präteritum, Futur 4. Satzbau 5. Bilder 1. Belege nicht vergessen 2. Wirkung und Funktion der erkannten sprachlichen Mittel Inhaltliche Aspekte 1. Titel und Inhalt, Erwartung des Lesers und Erfüllung durch das Gedicht 2. inhaltliche Gliederung 3. lyrisches Ich 4. allgemeine/individuelle Erfahrung 5. vermittelte Stellung, Erfahrung, Sicht (z.B. Mensch/Natur/Umwelt .) 6. Assoziationen Die formalen, sprachlichen und inhaltlichen Aspekte können und dürfen im Aufsatz selber natürlich nicht so getrennt voneinander stehen, wie hier in der schematischen Übersicht. Alle drei Aspekte sind Bestandteile des Gedichtes. So wird man formalen und sprachlichen Elementen immer auch eine inhaltliche Zuordnung geben, wie man auf der anderen Seite die inhaltliche Aussage nicht von der formalen und sprachlichen Ausgestaltung trennen kann. III. Schluss 1. Wirkung insgesamt 2. Aussage zur Entstehungszeit und den Dichter (falls bekannt) 3. Relevanz heute (Naturgedicht, Dinggedicht, Gedankenlyrik, politisches Gedicht .) 4. Epoche (falls bekannt)