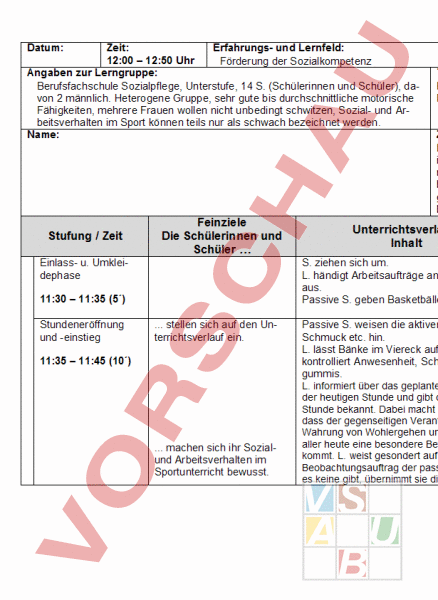Arbeitsblatt: Unterrichtsverlaufsskizze Spielentwicklung Rugby
Material-Details
Eigenständige Entwicklung einer Spielform mit dem Rugbyball aus dem Basketball
Bewegung / Sport
Spiel
11. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
27639
1924
5
24.10.2008
Autor/in
Mi Haase
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Datum: Zeit: Erfahrungs- und Lernfeld: 12:00 – 12:50 Uhr Förderung der Sozialkompetenz Angaben zur Lerngruppe: Berufsfachschule Sozialpflege, Unterstufe, 14 S. (Schülerinnen und Schüler), davon 2 männlich. Heterogene Gruppe, sehr gute bis durchschnittliche motorische Fähigkeiten, mehrere Frauen wollen nicht unbedingt schwitzen, Sozial- und Arbeitsverhalten im Sport können teils nur als schwach bezeichnet werden. Name: Stufung Zeit Feinziele Die Schülerinnen und Schüler Einlass- u. Umkleidephase 11:30 – 11:35 (5) Stundeneröffnung und -einstieg . stellen sich auf den Unterrichtsverlauf ein. 11:35 – 11:45 (10) . machen sich ihr Sozialund Arbeitsverhalten im Sportunterricht bewusst. Thema der Stunde: Eigenständige Entwicklung einer Spielform mit dem Rugbyball aus dem Grundspiel Basketball. Ziel(e) Kompetenzen der Stunde: Die S. entwickeln aus dem Grundspiel Basketball eine Spielform mit dem Rugbyball, indem sie die Basketballregeln auf ihre Tauglichkeit für das neue Spielgerät hin in mehreren Reflexionsphasen überprüfen und sinnvoll abwandeln. Dabei soll ihnen besonders ihre gegenseitige Verantwortung für Wohlergehen und Spielfreude der gesamten Gruppe innerhalb der Spielphasen deutlich werden (Förderung der sozialen Kompetenz). Unterrichtsverlauf Inhalt Raum Geräte Ordnungsrahmen Didaktisch – methodische Bemerkung S. ziehen sich um. L. händigt Arbeitsaufträge an passive S. aus. Passive S. geben Basketbälle heraus. Arbeitsaufträge für passive S., Basketbälle Die passiven S. werden sinnvoll in den Sportunterricht integriert. Passive S. weisen die aktiven S. auf Schmuck etc. hin. L. lässt Bänke im Viereck aufstellen und kontrolliert Anwesenheit, Schmuck, Kaugummis. L. informiert über das geplante Vorhaben in der heutigen Stunde und gibt das Ziel der Stunde bekannt. Dabei macht sie deutlich, dass der gegenseitigen Verantwortung zur Wahrung von Wohlergehen und Spielfreude aller heute eine besondere Bedeutung zukommt. L. weist gesondert auf den Beobachtungsauftrag der passiven S. hin, falls es keine gibt, übernimmt sie diesen selber. Bankaufstellung im Viereck, Hocker S., die sich schneller umziehen, können sich gleich bewegen und müssen nicht noch warten. S. können dem ersten Bewegungsdrang nachgehen. Anwesenheitsliste, Korb, Tape Bezüglich der Vorfälle der letzten Stunde erscheint es sinnvoll, das Arbeits- und Sozialverhalten zu thematisieren, um eine für alle angenehmere Lernatmosphäre zu schaffen. Phase der allgemeinen Erwärmung 11:45 – 11:55 (10) Erarbeitungsphase (Basketball) 11:55 – 12:05 (10) Erarbeitungsphase II (Rugbyball) 12:05 – 12:15 (10) . erwärmen ihre Muskulatur. . bereiten ihren Kreislauf auf die Belastung vor. . einigen sich auf ein Regelwerk. . führen die Spielform durch. . führen die zweite Spielform aus. . beobachten problematische Spielsituationen. 1. »Schlangenspiel Alle S. bilden eine Schlange und umfassen jeweils die Hüfte des Vordermanns. Der vorderste versucht, den hintersten zu erwischen. Variante: Schlange fängt Schlange und umgekehrt. 2. »Menschenslalom« Je halbe S.-Zahl bilden eine Einerkolonne hintereinander mit genügendem Abstand zum Vordermann. Die ganze Gruppe beginnt langsam zu joggen, der vorderste S. bestimmt den Laufweg. Der hinterste Spieler mit Ball dribbelt im Slalom um die Kolonne, bis er an der Spitze ist. Jetzt passt er den Basketball zum hintersten S., dieser bestimmt nun die Laufrichtung, Etc. Sportspiel Basketball a) Regeln von Lernenden festlegen lassen b) Basketball spielen Passive Lernende führen ihren Beobachtungsauftrag aus. Beginn des Unterrichtsbesuches Rugbyball wird anstatt des Basketballs eingesetzt S. erproben das Basketballspiel mit dem neuen Spielgerät Beobachtungsauftrag an alle: Gibt es Probleme/Schwierigkeiten beim Einsatz des neuen Spielgerätes? Wo liegen diese genau? 1 Schlange halbe Halle kann genutzt werden 2 Schlangen (je die halbe S.-Anzahl) 2 Kolonnen (jeweils die Hälfte der S.) 2 Basketbälle Sitzkreis Spiel 3:3 auf 2 Basketballfeldern 2 Basketbälle Körperkontakt für das spätere rugbyähnliche Spiel wird angebahnt. Dieser stellte in der ersten Unterrichtsstunde ein Problem dar (einige S. wollten sich und andere nicht anfassen (lassen)), weshalb eine Thematisierung vor dem eigentlichen Rugbyspiel angebracht erscheint. Basketballspezifische allgemeine Erwärmung, Ballgewöhnung Dieses dient der Rückbesinnung auf das Sportspiel Basketball und soll später die Findung von Regelalternativen erleichtern Kleine Mannschaften haben sich als günstiger in dieser Lerngruppe erwiesen, da besonders die schwächeren S. eher animiert werden, sich zu beteiligen. Spiel 3:3 auf 2 Basketballfeldern 2 Rugbybälle Lenkung der Konzentration der S. auf die Aufgabenstellung. Erarbeitungsphase III 12:15 – 12:25 (10) Erarbeitungsphase IV 12:25 – 12:35 (10) 1 kooperieren durch intensiven Austausch innerhalb der Klasse miteinander, um Regelalternativen zu finden und diskutieren diese. 1. Kognitive Phase a) Problemerkennung Dribbeln ist nicht mehr möglich. b) Problemlösung und 1. Regel Ball muss getragen werden (1. Regel aufschreiben) Unterrichtsgespräch (UG) im Halbkreis führen die Spielform mit abgewandelten Regeln durch. . beobachten weitere problematische Spielsituationen. kooperieren durch intensiven Austausch innerhalb der Klasse miteinander, um Regelalternativen zu finden und diskutieren diese. Übungsphase Erste Regel wird in das Spiel aufgenommen. Spiel 3:3 auf 2 Basketballfeldern 2 Rugbybälle 2. Kognitive Phase a) Problemerkennung Treffen der Basketballkörbe sehr schwierig b) Problemlösung Ball ablegen auf Turnermatten (weitere Lösungsvorschläge: werfen auf Handballtor, Brett des Basketballkorbes treffen etc.) 2. Regel: Ball ablegen Punkt (Versuch) Übungsphase Anwendung des neuen Elements. UG im Halbkreis 3. Kognitive Phase a) Problemerkennung: Der Ballträger läuft durch und kann nicht abgewehrt werden b) Problemlösung: 1 Ballträger wird „getoucht (weitere Lösungsvorschläge: Gegner festhalten, Schrittregel einführen etc.) 3. Regel Ballträger darf „getoucht werden (3-Schritte nach dem Touch). UG im Halbkreis führen die Spielform mit abgewandelten Regeln durch. . beobachten weitere problematische Spielsituationen. kooperieren durch intensiven Austausch innerhalb der Klasse miteinander, um Regelalternativen zu finden und diskutieren diese. Der Ballträger wird mit beiden Händen im Hüftbereich berührt Regelplakat, Pins, Stifte Regelplakat Spiel 3:3 auf 2 Basketballfeldern 2 Rugbybälle Regelplakat Die kognitiven Phasen sind nicht festgeschrieben, was bedeutet, dass die Vorschläge der S. so aufgegriffen werden, wie sie kommen. Es wird seitens der L. kein Vorgehen vorgegeben, somit ist der Verlauf der Regelfindung hier nur als eine Möglichkeit zu deuten. Die Anzahl der kognitiven Phasen richtet sich ebenfalls nach den Impulsen der S. L. wird ggf. durch ihre Frage, wie viele Regeln auf einmal umgesetzt werden sollen, auf die Problematik aufmerksam machen, dass zu viele Regeländerungen auf einmal zu ungünstiger Reflexionsmöglichkeit bezüglich ihrer Eignung führen könnten. Phase der Ergebnispräsentation führen die End-Spielform mit allen neuen Regeln durch. Anwendung aller neuen Elemente: Spielphase „Touch-Rugby 1. Ball muss getragen werden 2. Ball ablegen (Punkt/Versuch) 3. Ballträger darf „getoucht werden Ball darf in alle Richtungen gespielt werden Spiel 6:6 auf 1 Basketballfeld 1 Rugbyball reflektieren ihr Vorgehen bezüglich der Regelfindung und die Umsetzung im Spiel in Bezug auf das Stundenziel. . reflektieren ihr Sozialund Arbeitsverhalten, indem sie von passiven S. (bzw. L.) ein Feedback erhalten. Reflexion über den Ablauf der Stunde und die Umsetzung des Stundenzieles, ein neues Spiel zu entwickeln, an dem alle Freude haben. Passive S. geben Rückmeldung über ihren Beobachtungsauftrag. L. gibt Rückmeldung und erläutert ggf. rugbyähnliche Spielform. UG im Halbkreis Regelplakat L. gibt einen kurzen Ausblick auf die nächste Stunde, die (passiven) S. räumen die Geräte weg, sofern noch nicht geschehen und ziehen sich um. UG im Halbkreis L.: stellt die Frage, ob den S. Anwendungsalternativen für dieses Vorgehen (Problem in Gemeinschaft diskutieren und so lange Alternativen/Variationen vornehmen, bis alle mit dem Ergebnis zufrieden sind und leben können) denkbar wären. UG im Halbkreis 12:35 – 12:45 (10) Reflexionsphase 12:45 – 12:50 (5) Stundenabschluss (10) Didaktische Reserve . beurteilen das Vorgehen in der Stunde bezüglich dessen Transfermöglichkeit auf andere außersportliche Inhalte. Das Abschlussspiel soll mit größeren Mannschaften durchgeführt werden, um den S. einen Eindruck von diesem Mannschaftsspiel zu vermitteln und den Aspekt der „Übungsphase, den kleinere Mannschaften eher haben, auszuschalten. Zudem sollte der Abschluss der gemeinsamen Regelfindungsphase auch durch ein gemeinsames Spielerlebnis „gekrönt werden. S. bekommen eine Übersicht über die geplanten Inhalte. S. lernen verantwortungsvoll mit den Lehrmaterialien umzugehen. Aufgabenblatt für passive Schülerinnen und Schüler Name 1: Name 2: Name 3: Da ihr heute leider nicht aktiv am Unterricht Name 4: teilnehmen könnt, erhaltet ihr hiermit gesonderte Aufgaben für die heutige Stunde. Lest euch die Aufgaben gründlich durch. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an mich wenden. 1. Schreibt euren Namen in das Kästchen oben rechts. 2. Sorgt dafür, dass eure Mitschülerinnen und Mitschüler die Sicherheitsbestimmungen einhalten: • Uhren und jeglichen Schmuck ablegen, bzw. ihn mit Tape überkleben, wo er schlecht zu entfernen ist und • keine Kaugummis kauen. 3. Wenn eure Mitschülerinnen und Mitschüler in die Spielphasen gehen, ordnet euch jeweils einem Spielfeld zu. Beobachtet die beiden dort spielenden Mannschaften in ihrem Vorgehen. Beachtet dabei bitte gezielt, wie sich eure Mitschülerinnen und Mitschüler gegenüber ihren Mannschaftsmitgliedern verhalten: Sozialverhalten: Werden Schwächere mit einbezogen? Nehmen sich die „Guten auch zugunsten eines allgemeinen Spielvergnügens zurück? Unterstützen die „Guten die „Schwächeren? Werden Sicherheitsaspekte und Regeln eingehalten? Arbeitsverhalten: Versuchen die „Schwächeren sich nach ihren Möglichkeiten einzubringen oder klinken sie sich aus? Gibt es Situationen, in denen sich Einzelne den Aufgabenstellungen gegenüber verschließen, bzw. sich ihnen widersetzen? 4. Zum Ende der letzten Reflexionsphase gebt ihr euren Mitschülerinnen und Mitschülern eine kurze Rückmeldung bezüglich eures Beobachtungsauftrages. Achtet darauf, wie ihr die positive und konstruktive Kritik formuliert und beschränkt euch auf das Wesentliche. 5. Am Ende der Stunde räumt ihr die benutzten Geräte wieder zurück in den Geräteraum. Vielen Dank!