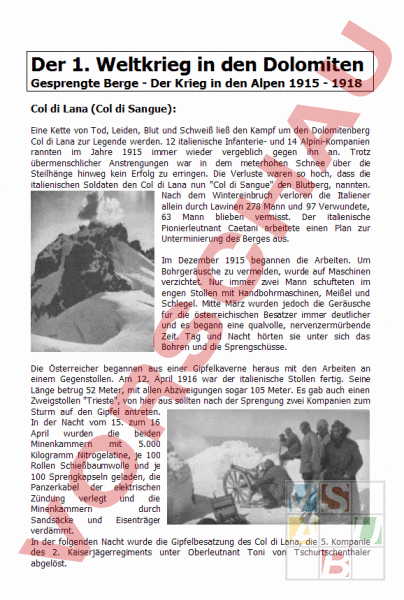Arbeitsblatt: 1. Weltkrieg in den Dolomiten
Material-Details
Arbeits- und Informationsmaterial zum Dokumentarfilm "Gesprengte Berge - Der Krieg in den Alpen 1915 - 1918.
Geschichte
Neuzeit
8. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
28070
2053
22
31.10.2008
Autor/in
Markus Fäh
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Der 1. Weltkrieg in den Dolomiten Gesprengte Berge Der Krieg in den Alpen 1915 1918 Col di Lana (Col di Sangue): Eine Kette von Tod, Leiden, Blut und Schweiß ließ den Kampf um den Dolomitenberg Col di Lana zur Legende werden. 12 italienische Infanterie- und 14 Alpini-Kompanien rannten im Jahre 1915 immer wieder vergeblich gegen ihn an. Trotz übermenschlicher Anstrengungen war in dem meterhohen Schnee über die Steilhänge hinweg kein Erfolg zu erringen. Die Verluste waren so hoch, dass die italienischen Soldaten den Col di Lana nun Col di Sangue den Blutberg, nannten. Nach dem Wintereinbruch verloren die Italiener allein durch Lawinen 278 Mann und 97 Verwundete, 63 Mann blieben vermisst. Der italienische Pionierleutnant Caetani arbeitete einen Plan zur Unterminierung des Berges aus. Im Dezember 1915 begannen die Arbeiten. Um Bohrgeräusche zu vermeiden, wurde auf Maschinen verzichtet. Nur immer zwei Mann schufteten im engen Stollen mit Handbohrmaschinen, Meißel und Schlegel. Mitte März wurden jedoch die Geräusche für die österreichischen Besatzer immer deutlicher und es begann eine qualvolle, nervenzermürbende Zeit. Tag und Nacht hörten sie unter sich das Bohren und die Sprengschüsse. Die Österreicher begannen aus einer Gipfelkaverne heraus mit den Arbeiten an einem Gegenstollen. Am 12. April 1916 war der italienische Stollen fertig. Seine Länge betrug 52 Meter, mit allen Abzweigungen sogar 105 Meter. Es gab auch einen Zweigstollen Trieste, von hier aus sollten nach der Sprengung zwei Kompanien zum Sturm auf den Gipfel antreten. In der Nacht vom 15. zum 16 April wurden die beiden Minenkammern mit 5.000 Kilogramm Nitrogelatine, je 100 Rollen Schießbaumwolle und je 100 Sprengkapseln geladen, die Panzerkabel der elektrischen Zündung verlegt und die Minenkammern durch Sandsäcke und Eisenträger verdämmt. In der folgenden Nacht wurde die Gipfelbesatzung des Col di Lana, die 5. Kompanie des 2. Kaiserjägerregiments unter Oberleutnant Toni von Tschurtschenthaler abgelöst. Seit dem Abend des 14. April waren keine Bohrgeräusche mehr zu hören. Das Laden einer Mine -so schätzten die Österreicher- würde gut 48 Stunden dauern. Jeden Augenblick -und die Kaiserjäger der 6. Kompanie wussten das- konnte unter ihnen der Fels beben, Feuer emporschlagen und sie alle verschlingen. Von der Division kam der Befehl: Der Col di Lana ist unter allen Umständen zu halten! Zehn Meter unter den Soldaten lagerte eine Riesenmenge von Sprengstoff. Von den italienisch besetzten Bergen spien seit drei Tagen ohne Pause 140 Geschütze Feuer und Verderben auf den kleinen Gipfel. Um 22.30 Uhr meldete ein Unteroffizier aus dem Kampfgraben durch Zuruf: Die Italiener kriechen vor! Die Telefonverbindung zwischen Col di Lana und Bataillonsstab war wieder zu Stande gekommen. Tschurtschenthaler meldete: Die Sache wird ernst, es bereitet sich etwas vor! Seine Soldaten hatten die Gräben besetzt. Auf einmal blendeten zahlreiche italienische Scheinwerfer auf. Der Oberleutnant ließ die Hälfte seiner Kompanie in die Kaverne zurückgehen. Zwei Züge blieben in der Stellung. Es war 23.30 Uhr, als der italienische Leutnant Caetani den Taster des Sprengapparates drückte. Da öffnete sich der Berg und Feuer schoss in den nachtschwarzen Himmel hinein; Tausende Tonnen Fels wirbelten durch die Luft, dazwischen Soldaten der Grabenbesatzung, zerfetzt. In der großen Kaverne flogen die Kaiserjäger durcheinander. Zur gleichen Zeit setzte italienisches Trommelfeuer wieder ein. Die italienischen Sturmtruppen waren aus dem Zweigstollen Trieste herausgestürzt. Die Posten des linken Flügels der Kompanie -von der Sprengung verschont geblieben- kämpften verzweifelt, bis sie überrannt wurden. Durch einen schmalen Schlitz zwischen den Felsbrocken, die die große Kaverne verschüttet hatten, schossen Alpinis mit Gewehren. Die Eingeschlossenen kapitulierten. Etwa 200 Mann waren der Sprengung, dem nachfolgenden Kampf und dem Artilleriefeuer zum Opfer gefallen. Der Rest der Kompanie ging in Gefangenschaft. Nur ein österreichischer Soldat war weder tot noch gefangen. Die Minensprengung hatte ihn hoch empor geworfen, dann war er in die Siefschlucht gestürzt in metertiefen Schnee. Schwer verletzt kroch er zwei Tage lang bis zu einer österreichischen Kampfstellung. Er konnte nichts berichten. Der Schock hatte ihm die Sprache geraubt. Das Ringen an der Tirolergrenze im Weltkriege dauerte Jahre, bei Tag und Nacht, im Sommer und Winter, in den Tälern und in den Regionen des ewigen Schnees und Eises, gegen einen mehrfach überlegenen und weitaus besser ausgerüsteten Gegen, unter Hunger, Kälte und Entbehrungen aller Art. Dazu kommen die außerordentlich gesteigerte Waffenwirkung mit ihrer Vernichtung, mit Tod und schrecklichen Verstümmelungen. So soll denn die Schilderung der Kämpfe um einen der heißest umstrittenen Berge der Tirolerfront, den Col di Lana, ein Ruhmesblatt der Geschichte der Tiroler Landesverteidigung beifügen. Sie bedeutet nur einen kleinen Abschnitt aus dem dreijährigen Ringen an den Grenzen Tirols, denn es gab dort noch viele andere Berge, um die schwer und blutig gerungen wurde, wie der Monte Piano, der Monte Pasubio usw. Der kleine Lagazuoi: Der kleine Lagazuoi befand sich westlich in österreichischer, östlich in italienischer Hand. So ist es klar, dass alles versucht wurde, um die Alpini zu vertreiben. Die Alpini brachen große Kavernen in den Fels und bauten zwei Felszacken auf dem Bande zu kleinen Sperren aus. Der eine Strebestein von den Österreichern genannt, stand dicht an der Wand. Er hatte gut die Höhe eines Stadthauses und wurde in mehreren Stockwerken ausgehöhlt, mit einem Gebirgsgeschütz und Maschinengewehr bestückt. Der andere, der tätowierte Stein, weiter hinausgerückt, war wohl etwas niedriger, flankierte jedoch die Vonbank-Stellung auf Tre Sassi (drei Felsen), die an Stelle einer veralteten und zerschossenen Sperre hier den Sattel verteidigte, zwischen Lagazuoi und dem fortartig vorspringenden Sasso di Stria, dem Hexenfels. Der Abschnittskommandant, Kaiserjäger-Hauptmann Eymuth entschloss sich zum Minenkampf und dieses umso schneller, als man hörte, dass der Feind einen Stollen vortrieb. Es gab bange Stunden, weil man immer wieder das Bohren italienischer Maschinen und die Sprengschüsse vernahm. Als die Unsicherheit wuchs, wer von beiden Gegnern zuerst die Himmelfahrt antreten würde, versuchte man es mit einer ersten kleinen Sprengung und hatte das Glück, dass die schon geladene Minenkammer der Italiener mit in die Luft flog. Die Österreicher entschlossen sich auf einen einzigen Stollen. Als dieser 93 Meter lange Stollen endlich fertig und die Minenkammer ausgesprengt war, ging man an das Laden. Jede einzelne der 1.003 Kisten Sprengmunition musste durch Bergführer herangeschleppt werden. 24.000 Kilo Sprengmunition wurden so in der Kammer verdämmt und zu aller Sicherheit gleich mit vier Zündungsleitungen verlegt. Weil man nun aus Beobachtungen wusste, dass die italienischen Kolonnen gegen 10.00 Uhr abends auf dem Wege waren, um ihre Felsbandstellung mit Munition und Verpflegung zu versorgen, so wurde diese Stunde zur Sprengung gewählt. Um punkt 10.00 Uhr Abends folgte die Zündung. Da stieg ein Brüllen auf, die Felsen barsten, hoben sich, flogen, splitterten, legten eine schwere Wunde bloß im Berg. Ein Hagel von Steinen prasselte nieder. Felsen kollerten als Rollbomben gegen die feindlichen Stellungen am Falzaregopass. Es war eine grausige Himmelfahrt. Sogar am Tage danach sind noch 30.000 Kubikmeter Gestein nachgestürzt. Ein Riss klaffte durch den Berg, fast 200 Meter hoch und 136 Meter breit. Zwischen Freund und Feind hatte ein Abgrund sich aufgetan. Des Gegners emsige Arbeit von anderthalb Jahren war in wenigen Sekunden weggelöscht, als wäre sie nie begonnen worden.