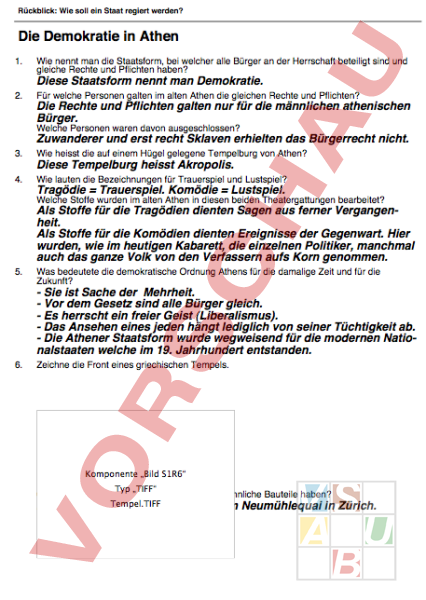Arbeitsblatt: Antworten Eule Aufklärung/Revolution
Material-Details
Antworten (ohne Bilder) zu Eulenfragen in DGzG 1 (Durch Geschichte zur Gegenwart Bd 1 )
Geschichte
Neuzeit
8. Schuljahr
22 Seiten
Statistik
28200
1143
13
03.11.2008
Autor/in
Andrea Berg
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Rückblick: Wie soll ein Staat regiert werden? Die Demokratie in Athen 1. Wie nennt man die Staatsform, bei welcher alle Bürger an der Herrschaft beteiligt sind und gleiche Rechte und Pflichten haben? Diese Staatsform nennt man Demokratie. 2. Für welche Personen galten im alten Athen die gleichen Rechte und Pflichten? Die Rechte und Pflichten galten nur für die männlichen athenischen Bürger. Welche Personen waren davon ausgeschlossen? Zuwanderer und erst recht Sklaven erhielten das Bürgerrecht nicht. 3. Wie heisst die auf einem Hügel gelegene Tempelburg von Athen? Diese Tempelburg heisst Akropolis. 4. Wie lauten die Bezeichnungen für Trauerspiel und Lustspiel? Tragödie Trauerspiel. Komödie Lustspiel. Welche Stoffe wurden im alten Athen in diesen beiden Theatergattungen bearbeitet? Als Stoffe für die Tragödien dienten Sagen aus ferner Vergangenheit. Als Stoffe für die Komödien dienten Ereignisse der Gegenwart. Hier wurden, wie im heutigen Kabarett, die einzelnen Politiker, manchmal auch das ganze Volk von den Verfassern aufs Korn genommen. 5. Was bedeutete die demokratische Ordnung Athens für die damalige Zeit und für die Zukunft? Sie ist Sache der Mehrheit. Vor dem Gesetz sind alle Bürger gleich. Es herrscht ein freier Geist (Liberalismus). Das Ansehen eines jeden hängt lediglich von seiner Tüchtigkeit ab. Die Athener Staatsform wurde wegweisend für die modernen Nationalstaaten welche im 19. Jahrhundert entstanden. 6. Zeichne die Front eines griechischen Tempels. Komponente „Bild S1R6 Typ „TIFF Gibt es an deinem Wohnort Gebäude, welche ähnliche Bauteile haben? Tempel.TIFF Front der kantonalen Verwaltung am Neumühlequai in Zürich. Seite 1 von 1 Ausblick: Von der Französischen Revolution zur heutigen Demokratie Die Entwicklung zur Demokratie 1. Wie kann das Volk, nach der Meinung der liberalen Politiker, seine Freiheitsrechte bewahren? Nur wenn das Volk die Politik bestimmt, kann es seine Freiheitsrechte bewahren. 2. Welche Rechte hat das Volk in der direkten Demokratie? In diesem System wählt das Volk nicht nur die Regierung. Es beschliesst auch über alle wichtigeren Fragen direkt. Jeder Bürger kann Vorschläge machen, über die das Volk dann abstimmt. Nur über die unwichtigeren und alltäglichen Dinge muss die Regierung das Volk nicht befragen. Wie kann es mitbestimmen? Es kann mitbestimmen, indem es Anträge an die Gemeindeversammlung stellt. 3. 4. 5. An wen überträgt das Volk seine Rechte in der indirekten Demokratie? In diesem System überträgt das Volk seine Mitbestimmungsrechte an die von ihm gewählten Volksvertreter. Weil sich jeder Bürger an der Wahl beteiligen kann, sollte die Volksvertretung die Meinung des ganzen Volkes widerspiegeln (repräsentieren). Welche Rechte hat das Volk in der halbdirekten Demokratie der Schweiz? In diesem System kann das Volk nicht nur seine Vertreter wählen, sondern auch zu wichtigen Angelegenheiten ja oder nein sagen. In einigen kleinen Kantonen wählt und beschliesst das Volk zum Teil nicht an der Urne, sondern in einer Volksversammlung, der Landsgemeinde. Welche Aufgaben haben die politischen Parteien? Damit gewählt werden kann, müssen Wahlvorschläge gemacht werden. Diese Aufgabe übernehmen die Parteien. Jede Partei hat ihre besonderen Vorstellungen, wie der Staat regiert werden sollte. Kennst du schweizerische Parteien und ihre Ziele? Freisinnig-demokratische Partei (FDP): Vertritt hauptsächlich die Interessen von Kapital und Wirtschaft. Sozialdemokratische Partei (SP): Vertritt hauptsächlich die Interessen der Arbeitnehmer. Christlichsoziale Volkspartei (CVP): Katholisch-bürgerlich orientiert. Evangelische Volkspartei (EVP): Evangelisch-bürgerlich orientiert. Schweizerische Volkspartei (SVP): Vertritt hauptsächlich die Interessen der Bauern und des Gewerbes. Landesring der Unabhängigen (LdU): Keiner Richtung verpflichtet, vertritt zunehmend grüne Interessen. Grüne Partei (GP): Vertritt hauptsächlich die Interessen der Umweltschützer. Seite 1 von 2 Ausblick: Von der Französischen Revolution zur heutigen Demokratie Die Entwicklung zur Demokratie Autopartei (AP): Vertritt hauptsächlich die Interessen der Autofahrer. Partei der Arbeit (PdA): Kommunisten. 6. Warum wohl hat man sich in der Schweiz weder für die direkte noch die indirekte Demokratie, sondern für einen Mittelweg entschieden? In der Schweiz fand man, die indirekte Demokratie biete dem Bürger zuwenig Mitbestimmungsmöglichkeiten. Man entwickelte daher für die grösseren Gemeinden und Städte, die Kantone und den Bund eine mittlere Lösung. 7. Zeichne das Schema der halbdirekten Demokratie der Schweiz (Volk, drei Gewalten, Wahlen, Abstimmungen). Regierung (Exekutive) Parlament (Volksvertretung, Legislative)Komponente „Bild S2R6 Gericht (Iudikative) Typ „TIFF Halbdirekte Demokratie.TIFF 8. Zähle alle Möglichkeiten auf, wie ein Schweizer Bürger oder eine Schweizer Bürgerin an der Politik in unserem Staat teilnehmen kann. Wählen, Stimmen, Mitarbeit in einer Partei, Mitarbeit in einer Behörde, Volksinitiative, Referendum. Seite 2 von 2 Kernthema 3: Revolution in Europa Europa unter Napoleon 1. 2. 3. Zähle einige Stationen aus dem Lebenslauf Napoleons bis zur Kaiserkrönung auf. 1769: Napoleon Bonaparte wird auf Korsika geboren. 1796: Napoleon wird mit 27 Jahren Frankreichs jüngster General. 1796/97: Siegreiche Feldzüge in Oberitalien November 1799: Napoleon stürzt das Direktorium und wird erster Konsul. 1794: Napoleon krönt sich selbst zum Kaiser. Welche Vorteile und welche Nachteile hatte Napoleons Herrschaft für Frankreich? Vorteile: Die besiegten Länder mussten riesige Zahlungen leisten, die Staatskasse füllte sich. Das wertlose Papiergeld wurde durch eine wertbeständige Silbermünze, den Franc, ersetzt. Der «Code civil» schuf gleiches Recht für alle. Napoleon vereinheitlichte Masse und Gewichte, wobei er überall das Dezimalsystem einführte. Nachteile: Der französische Bürger hatte in der Politik nichts mitzureden, Napoleon regierte allein. Dauernd führte Frankreich irgendwo Krieg, was viele Opfer forderte. Welche europäischen Länder konnte Napoleon besiegen und in seine Abhängigkeit bringen? Spanien, Italien, Schweiz, Teile Deutschlands und Österreichs 4. Welches Land konnte die französische Flotte besiegen und so die Eroberung durch Napoleon verhindern? Grossbritannien konnte die französische Flotte besiegen und so die Eroberung durch Napoleon verhindern. 5. Vor kurzer Zeit hatten sich die Franzosen von der Königsherrschaft befreit und eine Republik gegründet. Jetzt aber jubelten viele Franzosen Napoleon zu und begrüssten seine Alleinherrschaft. Versuche, dies zu erklären. Die Revolution hatte Frankreich ins Chaos gestürzt. Nach allen Kämpfen und Leiden erhofften sich die Menschen von einem Monarchen eine geordnete Staatsführung. Seite 1 von 2 Kernthema 3: Revolution in Europa Europa unter Napoleon Europa 1812.TIFF Typ „TIFF Trage auf einer Europakarte den Herrschaftsbereich Napoleons ein. Komponente „Bild S2R7 6. Seite 2 von 2 Ausblick: Von der Französischen Revolution zur heutigen Demokratie Die Gleichberechtigung der Frau 1. Welche Einstellung hatte man bis ins 19. Jahrhundert zu den Aufgaben der Frauen in der Gesellschaft? Die Frau sollte sich zu Hause um das Wohl der Familie kümmern. Dazu war keine besondere Ausbildung nötig. Es war selbstverständlich, dass eine Frau heiratete und von Ihrem Mann versorgt und beschützt wurde. 2. Weshalb war es in der Schweiz viel schwieriger, das Stimm- und Wahlrecht für Frauen einzuführen, als in anderen Ländern? In der Schweiz mussten nicht nur das Parlament, sondern auch der männliche Volksteil ja zum Frauenstimmrecht sagen. Er war nur schwer dazu zu bewegen. 3. Welches waren die Argumente der Befürworter des Frauenstimmrechtes, und wie argumentierten die Gegner? Befürworter: Die Frauen sind reifer geworden, sind aus dem häuslichen Leben ins Erwerbsleben hinausgetreten. Als moderne Menschen sind sie mit Politik und Kultur verknüpft. Der Ausschluss der Frauen von den politischen Rechten entspricht nicht den heutigen sozialen Gegebenheiten. Der heutige Staat braucht die Mitarbeit der Frauen. Mann und Frau müssen gemeinsam an der Demokratie weiterbauen. Gegner: Eine Verdoppelung der Dummen und Gescheiten an der Urne bringt nichts. Die Schweizer Frauen gehören auch ohne Stimmrecht zu den bestgestellten der Welt. Sie geniesst gesetzliche Vorteile, die der Mann nicht hat. Die intellektuellen Frauen vertreten nicht die einfache Schweizerin. 4. Welche Rechtsunterschiede zwischen Männern und Frauen bestanden ausser dem fehlenden Stimmrecht? In der Ehe galt lange der Mann als Familienoberhaupt. Oft erhielten Frauen auch für gleiche Arbeit weniger Lohn. 5. Gegner des Frauenstimmrechtes sagen immer wieder, dass die Frauen mehrheitlich gar nicht an Politik interessiert seien und deshalb auch keine Beteiligung daran wünschten. Äussere deine Meinung dazu. Frauen sind sehr wohl an der Politik interessiert. Was sie an der aktiven Beteiligung hinderte und noch hindert ist ein überholtes, weil einschränkendes, Frauenbild in der Gesellschaft und in der Erziehung. Seite 1 von 2 Ausblick: Von der Französischen Revolution zur heutigen Demokratie Die Gleichberechtigung der Frau 6. In allen Parlamenten und Regierungen der Welt sind die Frauen, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil, stark untervertreten. Welche Gründe hat dies? Dies liegt einerseits ganz klar an der jetzt noch bestehenden Rollenverteilung in der Familie: Der Mann steht meist im Erwerbsleben, geht seiner Karriere nach, während sich die Frau der Erziehung der Kinder widmet. Selten tritt der Mann an die Stelle der Frau, bleibt zu Hause und besorgt den Haushalt. Anderseits fehlen auch heute noch vor allem in ländlichen Kreisen die Anerkennung der Fähigkeiten der Frauen durch die Männer, sowie das Selbstvertrauen der Frauen in sich selbst. Kann und soll das geändert werden? Ein Umdenken kann leider nur langsam erfolgen, wobei die Schule einen wichtigen Beitrag leisten kann, indem sie nur schon äusserlich die gleiche Lektionentafel für Mädchen wie für Knaben einführt, innerlich aber klar für die Gleichberechtigung Stellung nimmt und entsprechendes Denken fördert. Allerdings ist auch entschiedenes Engagement vonseiten der Frauen gefragt. Die Frauen bringen durch ihre Mitarbeit in der Politik und im Wirtschaftsleben andere, neue Ideen und Denkweisen ein, von denen beide Welten nur profitieren können. 7. Ist die völlige Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in der Schweiz schon durchgeführt worden? Trotz Art. 4, Abs. 2 bestehen nach wie vor Rechtsunterschiede. Wo liegen die Grenzen? Von Gesetzes wegen brächten keine Grenzen zu bestehen, das zeigt schon der Verfassungsartikel. Es gibt sie jedoch rein von der unterschiedlichen Veranlagung her. So werden es wohl immer mehrheitlich Männer sein, die körperlich sehr anstrengende Arbeit verrichten und die Kinder werden von den Frauen zur Welt gebracht. Welche Rechtsunterschiede bestehen heute noch? Rechtsunterschiede bestehen heute noch, so zum Beispiel bezüglich Bezahlung in verschiedenen Berufszweigen. Auch werden ausserehelich geborene Kinder nach wie vor nach dem Vater benannt. Allerdings gibt es auch gesetzliche Bestimmungen, welche die Frau bevorteilen, zB. Befreiung von Militär- und Feuerwehrpflicht, Befreiung von Militärpflichtersatzzahlungen, früheres Rentenalter. Seite 2 von 2 Ausblick: Von der Französischen Revolution zur heutigen Demokratie Der Kampf um die Freiheitsrechte 1. Wofür setzten sich die Liberalen im letzten Jahrhundert ein? Die Liberalen kämpften für die Verwirklichung der Freiheitsrechte für jeden Bürger (vergleiche Seite 163 und 172, Quellentext 31) die Verwirklichung der Gewaltentrennung (vergleiche Seite 163 und 164) die Mitbestimmung des Volkes in der Politik durch die Einführung des Wahlrechts (vergleiche Seite 173). 2. Die meisten Verfassungen der europäischen Länder am Anfang des 20. Jahrhunderts waren «liberal». Erkläre diesen Ausdruck. Sie nannten sich «Liberale» («Freiheitsfreunde»; von lateinisch «libertas»: die Freiheit). 3. Welche Organisationen sind heute bemüht, die Freiheitsrechte des Menschen zu schützen? Die Mitglieder der Vereinten Nationen (UNO) unterzeichneten die «Erklärung der Menschenrechte». Die westeuropäischen Staaten, darunter die Schweiz, gingen einen Schritt weiter. Sie schlossen die «Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten» ab (1950; Beitritt der Schweiz 1972). In Strassburg wurde eine «Europäische Kommission» eingerichtet. 4. Wohin kann sich heute ein Europäer wenden, wenn er glaubt, seine Freiheitsrechte seien von den Behörden seines Staates verletzt worden? Er kann sich an die europäische Menschenrechtskommission in Strassburg wenden. 5. Zähle die wichtigsten Freiheitsrechte auf, und schreibe die wichtigsten Einschränkungen derselben dazu. Kennst du weitere Einschränkungen? Freiheitsrecht Einschränkung Pressefreiheit nissen Recht auf Eigentum Persönliche Freiheit Glaubensfreiheit Rechtsgleichheit Vereinsfreiheit gen 6. Aufruf zu Straftaten, Verletzung von Geheimübergeordnetes Staatsinteresse Straftaten Ausübung von Bürgerpflichten (Militärdienst) Straftaten, Bürgerrechte (Ausländer) Kriminelle oder staatsgefährdende Vereinigun- Gibt es auch für dich Freiheitsrechte, welche durch Gesetze geschützt sind? Im Prinzip gelten im Rahmen des Möglichen Jugendliche sind noch unmündig) die gleichen Rechte. Die UNICEF hat noch weitergehende Rechte für die Kinder definiert, die von den UNO Mitgliedern respektiert werden. Wohin kannst du dich wenden, wenn du glaubst, deine Freiheitsrechte seien verletzt worden? Das ist abhängig von der Verletzung; zB. Eltern, Lehrer, Schulpflege, Pfarrer, Fürsorgebehörde, Jugendsekretariat. Seite 1 von 1 Kernthema 3: Revolution in Europa Napoleons Ende 1. 2. 3. 4. 5. Warum griff Napoleon Russland an? Als der russische Kaiser merkte, welche Schäden ihm der Unterbruch des Handels mit Grossbritannien ( Kontinentalsperre) brachte, hielt er sich nicht mehr daran. Daher wollte Napoleon den Zaren bestrafen und ihn zur Einhaltung der Sperre zwingen. Was geschah in Moskau? Napoleon besetzte im September 1812 Moskau. Zahlreiche Brände, vermutlich von den Russen selbst gelegt, zerstörten aber weitgehend die überwiegend Aus Holzhäusern gebaute Stadt. Der Winter nahte, und die Hauptmacht der Armee hatte nun keine Unterkunft mehr. Was geschah an der Beresina? Die Schweizer Soldaten mussten die nachdrängenden Russen aufhalten, um den Übergang über den Fluss zu ermöglichen. Sie selbst durften sich erst als letzte zurückziehen. Was geschah mit Napoleon nach seiner Niederlage im April 1814? Napoleon musste nach seiner Niederlage auf den Thron verzichten und erhielt dafür als kleines Fürstentum die Insel Elba. Damit fand er sich nicht ab. 1815 kehrte er heimlich nach Frankreich zurück. Was geschah in den «Hundert Tagen»? Nochmals war er Kaiser. sofort marschierten die Armeen seiner Gegner in Frankreich ein und besiegten ihn bei Waterloo endgültig. Welches Schicksal erlitt Napoleon danach? Nun wurde Napoleon auf der Insel St. Helena im südlichen Atlantik bis zu seinem Tod 1821 gefangengehalten. 6. 7. Welche Aufgabe hatte der Wiener Kongress? Hier sollte nach den vielen Kriegen eine dauerhafter Freidensordnung geschaffen werden. Revolutionen sollten für alle Zeiten verhindert werden. Viele Franzosen verehren Napoleon noch heute. Wie beurteilst du ihn? Napoleons war ohne Zweifel ein grosser General mit einer ungeheuren Ausstrahlung. Er besass die Gabe, die Massen für sich begeistern zu können. Der Wiederaufschwung der Wirtschaft und die Einführung des Code civil sind herausragende Errungenschaften. Er versuchte jedoch die Macht Frankreichs durch Kriege auszudehnen und zu sichern, was über Jahre hinweg von Europa einen hohen Blutzoll forderte. Seite 1 von 1 Kernthema 3: Revolution in Europa Europa unter Napoleon 1. Wie nützte Napoleon den Streit unter den Direktoren im Jahre 1799 aus? Er stürzte die Regierung. Was löste er auf? Er löste das Parlament auf. 2. Wie wurde Frankreich nun regiert? Napoleon regierte fortan das Land. Welchen Titel trug Napoleon? Er trug den Titel Erster Konsul. 3. Wie reagierte das Volk auf die Machtergreifung Napoleons? Das Volk leistete keinen Widerstand. Lässt sich das begründen? Man war froh, dass nun wieder eine feste Ordnung geschaffen wurde. 4. In welchen Rang erhob sich Napoleon fünf Jahre später? Napoleon erhob sich zum Kaiser (Empéreur). Welche Absicht verfolgte er damit? Er hoffte, die Herrschaft in seiner Familie zu verankern. 5. Mit welchen Staaten führte Frankreich weiterhin Krieg? Mit Grossbritannien, Russland und Österreich führte Frankreich weiterhin Krieg. Warum? Sie fanden sich nicht damit ab, dass Frankreich so mächtig geworden war. 6. Weshalb hatte Napoleon ein Interesse daran, weiterhin Kriege zu führen? Er war auf Erfolge angewiesen, wenn er an der Macht bleiben wollte. 7. Welche Erfolge und welche Misserfolge hatte Napoleon? Er besiegte Österreich. Preussen und Russland. Deutschland, Italien und Spanien wurden von ihm abhängig. Hingegen verlor er seine Flotte bei der Schlacht von Trafalgar gegen Grossbritannien. 8. Welche Folgen hatte die Vernichtung der französischen Flotte? Napoleon hatte nun kein Mittel mehr, Grossbritannien direkt anzugreifen. 9. Womit bezahlte Napoleon die Staatsschulden? Er bezahlte die Schulden mit den riesigen Zahlungen der besiegten Länder. 10. Welche neue Geldwährung führte Napoleon ein? Napoleon führte den Franc ein. 11. Wie heisst das von Napoleon neu eingeführte Gesetzbuch? Das von Napoleon neu eingeführte Gesetzbuch heisst Code civil oder Code Napoléon Welcher Grundsatz wurde darin verwirklicht? Darin wurde der Grundsatz der Chancengleichheit verwirklicht. 12. Welche Massnahme führte Napoleon bei den Massen und Gewichten ein? Napoleon vereinheitlichte die Masse und führte das Dezimalsystem ein. Seite 1 von 1 Kernthema 3 Revolution in Europa Die Revolution erreicht die Schweiz 1. 2. 3. Warum waren die französischen Armeen erfolgreich? Weil in Frankreich nun die allgemeine Wehrpflicht galt, hatte dieses ebenso viele Soldaten wie all seine Gegner zusammen. Verluste konnten leicht durch neue Aufgebote ersetzt werden. Daher riskierten die französischen Generäle in den Schlachten mehr als ihre Gegner, welche mit teuren Berufssoldaten kämpften. Die Laufbahn in der französischen Armee hing nur noch von den Fähigkeiten, nicht von der adeligen Herkunft ab. Begabte Soldaten und Unteroffiziere stiegen in kurzer Zeit zum General auf. Daher hatten die französischen Armeen die besseren Führer. Die französischen Armeen ernährten sich ausschliesslich aus den besetzten Ländern. Sie brauchten daher weniger Nachschub und konnten viel schneller vorrücken. Warum wollten die Franzosen die Schweiz in Besitz nehmen? 1797 schloss Frankreich mit seinen Gegnern einen Frieden, der allerdings nicht lange währen sollte. Durch diesen wurde die Schweiz zu einem wichtigen Verbindungsland zwischen Frankreich und dem eroberten Oberitalien. Zudem hatten die grösseren schweizerischen Orte wie Bern und Zürich gefüllte Staatskassen. Schliesslich hatte die Schweiz nach der Meinung der französischen Revolutionäre eine falsche und überholte Ordnung. Aus all diesen Gründen beschloss die französische Regierung, die Schweiz in ihre Abhängigkeit zu bringen und ihr eine Staatsordnung zu geben, die der französischen ähnlich war. Erkläre die Begriffe «13 Orte», «Zugewandte Orte», «Gemeine Herrschaften». 13 Orte: Dies waren miteinander durch die Bundesbriefe verbündet. Ihre Gesandten trafen sich regelmässig an der Tagsatzung. Zugewandte Orte: Diese waren nur locker und oft nur mit einem Teil der dreizehn Orte verbündet. Gemeine Herrschaften: Diese befanden sich im Besitz von mehreren der dreizehn Orte. Die Bewohner waren Untertanen und wurden durch Landvögte regiert. Seite 1 von 2 Kernthema 3 Revolution in Europa Die Revolution erreicht die Schweiz 4. 5. Wie wirkte sich der französische Einmarsch für die Schweiz aus? Die Franzosen plünderten die Schweiz aus. Zuerst wurde die Berner Staatskasse mit zehn Millionen Pfund nach Paris entführt. Anschliessend wurde der Staatsbesitz von Bern, Zürich, Luzern, Freiburg und Solothurn (total ungefähr 23 Millionen Pfund) zum französischen Eigentum erklärt. Schliesslich hatten noch die begüterten Familien aus diesen Städten 15 Millionen Pfund zu zahlen. Die Franzosen diktierten den Schweizern die neue Ordnung, ohne sie zu fragen. Die Eidgenossenschaft sollte ein einheitlicher Staat werden, in welchem die Kantone nur noch eine geringe Bedeutung hatten. Warum konnten die Franzosen die Schweiz so leicht erobern? Es gelang Frankreich, in der Landschaft möglichst viele Untertanen zum Aufstand gegen ihre Herren zu bringen. Zu spät versuchten die städtischen Regierungen, die Landschaft durch Zugeständnisse auf ihre Seite zu ziehen. Kann man daraus für die heutige Zeit Lehren ziehen? Unterdrückte oder Benachteiligte Untertanen werden ihrer Obrigkeit im Bedrohungsfall nicht loyal zur Seite stehen, schliesslich hat sie von deren Herrschaft keinen Vorteil, kann aber im Falle eines Sturzes profitieren. 6. Manche Leute hofften, mit Hilfe der Franzosen könnten die Zustände in der Schweiz verbessert werden. Wurden ihre Hoffnungen erfüllt? Die Hoffnungen wurden nur teilweise erfüllt. Inwiefern? Zwar war nun die Vorherrschaft der dreizehn Orte gebrochen, doch die Hauptbelastung durch die Besetzung der Schweiz hatte die Bevölkerung zu tragen, die wegen den Abgaben an die fremden Soldaten grosse Not litt. Seite 2 von 2 Kernthema 2: Revolution in Frankreich Die Revolution in der Krise (1792-1795) 1. Zähle Gründe auf weshalb die Französische Revolution ab 1792 in eine Krise geriet. Ab 1792 geriet die Französische Revolution in eine Krise. Dies hatte mehrere Gründe: Der König: Ludwig XVI. fand sich mit dem Verlust seiner alten Stellung nicht ab. Er hoffte auf einen Umsturz oder ein Eingreifen der andern europäischen Herrscher zu seinen Gunsten. Schon 1790 hatte er versucht, aus Paris nach Ostfrankreich zu königstreuen Truppen zu entweichen. Er war aber unterwegs entdeckt und nach Paris zurückgebracht worden. Nun war das Volk misstrauisch gegen ihn. Der Krieg: Die Nationalversammlung wollte nicht nur die Franzosen, sondern auch die andern Völker Europas vom Absolutismus befreien. Daher erklärte sie 1792 den Herrschern von Österreich und Preussen den Krieg. Weil diese bald Unterstützung von Spanien, Grossbritannien und später Russland erhielten, hatte Frankreich fast ganz Europa zum Gegner. Für Frankreich verlief der Krieg zuerst sehr ungünstig. Ein grosser Teil der adeligen Offiziere hatte das Heer verlassen und stand jetzt auf der Gegenseite. Im französischen Heer herrschte wenig Ordnung. Die gegnerischen Armeen drangen in Nordfrankreich ein. Die wirtschaftliche Lage: Wegen des Krieges stiegen die Staatsausgaben stark an. Die Verschuldung des Staates nahm daher zu statt ab. Um die Schulden zu bezahlen, druckte der Staat Papiergeld. Nun gab es viel Geld, aber wenig zu kaufen. Die Bauern waren misstrauisch, verkauften gar kein Getreide oder nur gegen Silbergeld. Daher wurde das Getreide immer teurer und immer knapper. 2. 3. 4. Was geschah beim Sturm auf den Tuilerienpalast? Der König floh mit seiner Familie in den Sitzungssaal der Nationalversammlung. Seine Leibwache, die Schweizer Garde, wurde niedergemetzelt. Welches Schicksal erlitt die Königsfamilie? Der König und die Königin wurden wegen Hochverrats verurteilt und hingerichtet. Der zehnjährige Kronprinz starb in Gefangenschaft. Erkläre den Ausdruck «Republik». Der Begriff stammt vom lateinischen «res publica» Gemeinwesen. In einer Republik ist das Volk Träger der Staatsgewalt. Seite 1 von 2 Kernthema 2: Revolution in Frankreich Die Revolution in der Krise (1792-1795) 5. Brachte die Französische Revolution Fortschritte? Als Fortschritte sind die Gewaltentrennung, die Verfassung und die Gleichberechtigung der Bürger zu nennen. Doch das Ziel, Frankreich eine neue, dauerhafte Ordnung zu geben, wurde nicht erreicht. Wer profitierte vor allem von der Revolution? Die wohlhabenden Bürger: Sie hatten jetzt die angestrebten Freiheiten und konnten sich politisch betätigen. Die Bauern: Sie zahlten wesentlich weniger Abgaben und besassen zum Teil mehr Land als früher. Sind Revolutionen überhaupt sinnvoll? Sinnvoller ist sicher die Evolution, dh. die langsame und kontrollierte Veränderung bestehender Zustände. Revolutionen arten meist in Abrechnungen mit den politischen Gegnern aus, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Jedoch lassen sich totalitäre Regierungen in der Regel nicht auf Veränderungen ein, sodass als letzte Lösung nur noch der Staatsstreich bleibt. 6. Zeichne schematisch den Staatsaufbau Frankreichs nach der Verfassung von 1795. Komponente „Bild S2R6 Typ „TIFF Direktorium.TIFF Welches sind die Hauptunterschiede zu 1791? An die Stelle des Königs trat das fünfköpfige Direktorium, welches die Regierung führte. Das Parlament war nun in zwei Kammern geteilt, welche sich gegenseitig kontrollieren sollten. Seite 2 von 2 Kernthema 3: Revolution in Europa Eine Revolution in Zürich? 1. 2. Welche wirtschaftlichen Vorrechte hatten die Stadtbürger gegenüber der Landbevölkerung? Manche Handwerksberufe durften nur von den Stadtbürgern ausgeübt werden. Nur die städtischen Kaufleute durften Baumwolle und Seide einführen und die gewobenen Stoffe bleichen, bedrucken und verkaufen. Nenne die wichtigsten Forderungen im «Stäfner Memorial». Sicherheit gegen Despotismus ( Willkürherrschaft) und drückende Abgaben ( zu hohe Steuern), Gleichheit vor dem Gesetz, Erwerbsfreiheit, ungehinderter Gebrauch seiner Fähigkeiten. Warum nannten die Verfasser die regierenden Herren in Zürich «Väter des Vaterlandes»? Sie wollten ihnen damit ihren Respekt vor der stadtzürcherischen Obrigkeit erweisen. Es ging auch darum zu zeigen, dass sie lediglich Gleichberechtigung, nicht aber das Abstreifen der städtischen Herrschaft anstrebten. 3. 4. 5. 6. Wie reagierte die Zürcher Regierung auf das «Stäfner Memorial»? Der Zürcher Rat zitierte die Verfasser und verhaftete sie. Sie wurden verbannt, mussten eine Busse bezahlen oder wurden ermahnt. Welche Folgen hatte die Haltung der Zürcher Regierung? Die Landschaft gab sich nicht zufrieden und forderte aufgrund alter Urkunden ihre Rechte und wollte mit der Stadt verhandeln. Diese war aber dazu nicht bereit, sondern griff zur Gewalt. Stäfa wurde überfallen und die Anführer zu hohen Gefängnisstrafen oder Bussen verurteilt. Nenne Gründe, welche die Zürcher Regierung zu ihrem Vorgehen veranlassten. Die städtischen Räte fürchteten um ihre Vorherrschaft auf politischem Gebiet, und die Kaufleute, sowie die Handwerker wollten ihre wirtschaftlichen Vorteile nicht verlieren. Letzten Endes ging es wie immer um Macht und Geld. Würdest du persönlich für die Zürcher Regierung oder für die Landbevölkerung Partei ergreifen? Begründe deine Haltung. Persönlich würde ich mich hinter die Landbevölkerung stellen. Einerseits ist eine solche Rechtsungleichheit nicht zu rechtfertigen, anderseits könnte auch der städtische Handel und Gewerbe von der Konkurrenz auf dem Land profitieren, sich verbessern. Aus gemeinsamen Anstrengungen entstände eine Synergieeffekt. Seite 1 von 1 Kernthema 3: Revolution in Europa Die Schweiz unter Napoleon 1. 2. Wie wurde die Schweiz zur Zeit der «Helvetischen Republik» regiert? Die Schweiz wurde nach französischem Vorbild von einem Direktorium mit fünf Mitgliedern regiert. Diese setzten in den Kantonen Statthalter ein. Die Kantone verloren jede Selbständigkeit. Wer eröffnete nach dem Aufstand der Nidwaldner gegen die Franzosen in Stans ein Waisenhaus? Heinrich Pestalozzi eröffnete nach dem Aufstand der Nidwaldner gegen die Franzosen in Stans ein Waisenhaus. 3. Wie hiess die Verfassung, welche Napoleon für die Schweiz schuf? Die Verfassung, welche Napoleon für die Schweiz schuf, hiess «Mediationsverfassung». Worin bestand der Hauptunterschied zur Verfassung der Helvetischen Republik? Die Eidgenossenschaft bestand nun aus 19 selbständigen, gleichberechtigten Kamtonen. 4. Welche der heutigen Kantone gehörten zur Zeit der von Napoleon geschaffenen Verfassung nicht zur Schweiz? Jura, Basel-Stadt, Appenzell Innerrhoden, Genf, Wallis, Neuenburg 5. Überlege, welche Folgen wohl die Verpflichtung der Eidgenossenschaft hatte, Napoleon Truppen zur Verfügung zu stellen. Dadurch wurde die Eidgenossenschaft wenn auch gegen ihren Willen zur Verbündeten Napoleons, musste sich eventuell gegen alte Freunde stellen. Truppen zu stellen zieht immer auch hohe Kosten nach, zudem waren die Folgen zu tragen. Seite 1 von 1 Kernthema 1: Aufklärung Vernunft, Verstand, Mündigkeit 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wie lange dauert es noch, bis du mündig bist? Die Mündigkeit erreicht man in der Schweiz zur Zeit mit 18 Jahren, es dauert also noch rund fünf Jahre. Bedeutet Mündigkeit für Kant dasselbe wie für das Schweizerische Zivilgesetzbuch? Für Kant ist Unmündigkeit das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung durch jemand andern zu bedienen. Für das Schweizerische Zivilgesetzbuch ist Unmündigkeit, wenn man das achtzehnte Altersjahr noch nicht erreicht hat. Erkläre den Begriff «Aufklärung». «Aufklärung» ist der Ausgang des Menschen aus seiner Unmündigkeit, dh. wenn er seinen Verstand selbständig und ohne Anleitung gebraucht. Warum ist es nach der Meinung der Aufklärer sinnvoll, die Natur zu erforschen? Der Mensch sollte über die Welt und über sich selbst Klarheit erhalten. Durch Erkennen und Anwenden der Naturgesetze können die Menschen ihre eigene Lage verbessern. Erkläre, wie die Pockenimpfung erfunden wurde. Der englische Landarzt Edward Jenner erkannte, dass Menschen, die jemals an Kuhpocken erkrankt waren, nachher gegen Menschenpocken immun waren. Er infizierte einen Knaben mit Kuhpocken und steckte ihn dann nach der Heilung auch mit Menschenpocken an. Trotz der Ansteckung blieb der Knabe gesund. Welchen Nutzen hat die Erforschung des Aufbaus und der Funktionsweise des menschlichen Körpers? Durch die Erforschung des Aufbaus und der Funktionsweise des menschlichen Körpers, sowie durch die Verbesserung der Hygiene wurde das durchschnittliche Lebensalter wesentlich erhöht. 7. Was geschieht bei der Verbrennung? Bei der Verbrennung verbindet sich ein Stoff mit Sauerstoff. Wer hat dies entdeckt? Dieses Phänomen entdeckte Antoine Lavoisier. Seite 1 von 2 Kernthema 1: Aufklärung Vernunft, Verstand, Mündigkeit 8. 9. Welche Erfindung hat Benjamin Franklin gemacht? Benjamin Franklin hat den Blitzableiter erfunden. Vergleiche die Lebenseinstellung von Andreas Gryphius und Isaak Iselin. Andreas Gryphius hat eine negative Lebenseinstellung (Alles wird untergehen, Sorgen), Isaak Iselin hingegen eine positive Der Besitz der Glückseligkeit ist kein Unmöglichkeit.). 10. Warum stieg das Alter, das die Menschen im Durchschnitt erreichten, zwischen 1600 und 1800? Durch die Verbesserung der Hygiene und die Fortschritte in der Medizin wurde das durchschnittliche Lebensalter wesentlich erhöht. Welches Durchschnittsalter erreichen die Menschen heute: a: bei uns 75 Jahre (Stand 1981) b: in den Entwicklungsländern? je nach Entwicklungsstand ca. 20 bis 40 Jahre Seite 2 von 2 Kernthema 1: Aufklärung Eine vernünftige Staatsordnung 1. Was versteht man in der Geschichte unter «Aufklärung»? Mit «Aufklärung» ist in der Geschichte die Epoche gemeint, in welcher die Menschen an ihre Vernunft zu glauben begannen und sie auch einsetzten, indem sie sich über die Natur und auch den Aufbau des Staates Gedanken machten. 2. Welches sind nach der Meinung der Aufklärer die Grundrechte der Menschen? Freiheit, Selbstbestimmungsrecht, Recht auf Eigentum, Gleichheit 3. Wozu brauchen die Menschen Staaten? Der Staat sollte als «Diener und Beauftragter des Volkes» in unparteiischer Weise über die Einhaltung der Rechte wachen. 4. Welche Gewalten unterscheiden die Aufklärer im Staat? Die Aufklärer unterschieden im Staat die gesetzgebende (Legislative), die vollziehende ( Exekutive) und die richterliche Gewalt ( Judikative). Welche Aufgaben haben diese Gewalten? Die gesetzgebende Gewalt erlässt Gesetz oder schafft sie ab. Die vollziehende Gewalt sorgt für Sicherheit, Friede und Verteidigung. Die richterliche Gewalt bestraft Verbrecher und schlichtet Streitigkeiten. 5. Warum forderten die Aufklärer «Gewaltentrennung»? Wenn die Ausübung der gesetzgebenden und der vollziehenden Gewalt einer einzigen Person oder Behörde zusteht, ist zu befürchten, dass diese solche Gesetze erlässt, die ihr beim Regieren alle Macht geben. 6. Vergleiche die Ansichten von Montesquieu und Rousseau über die Wahl von Volksvertretern und die Rechte des Volkes. Montesquieu hielt es für unmöglich, das ganze Volk an der Regierung teilhaben zu lassen, da dies in einem grösseren Staat zu umständlich wäre. Zudem wären Volksvertreter eher befähigt einen Staat zu lenken. Die vollziehende Macht sollte in den Händen eines Königs liegen. Rousseau hingegen war der Ansicht, der wahre Volkswille lasse sich nicht vertreten. Alle Gesetze müssten demnach vom Volk direkt abgesegnet werden. 7. Wie wirkten sich die Gedanken der Aufklärer für die absolute Monarchie aus? Ihre Schriften wurden eifrig gelesen. Überall bildeten sich Gesellschaften, in welchen man regelmässig politische Fragen diskutierte. Besonders in Frankreich wuchs die Kritik an der absoluten Monarchie. Warum? Die Aufklärer erkannten, dass die Monarchie eigentlich nur sich selbst diente, vom Volk aber finanziert wurde. Durch eine andere Staatsform war es möglich, für alle Menschen ein besseres Leben zu erreichen. Seite 1 von 1 Kernthema 2: Revolution in Frankreich Warum eine Revolution? 1. 2. Wie hiessen die drei Stände in Frankreich vor der Revolution? 1. Geistlichkeit 2. Adel 3. Dritter Stand Worüber stritten sich die Vertreter der drei Stände in der vom König einberufenen Versammlung? Sie stritten sich über das Abstimmungsverfahren. Der Adel und die hohe Geistlichkeit wollten ihre Vorrechte wahren und ihren Einfluss verstärken. Daher schlugen sie vor, dass bei allen Fragen jeder Stand für sich abstimmen und dann eine Stimme abgeben solle. Sie hofften, so den Dritten Stand jeweils 2:1 überstimmen zu können. 3. 4. Wie reagierte der Dritte Stand, als der König für die anderen Stände Partei ergriff? Die Vertreter des Dritten Standes hielten sich nicht an den Befehl des Königs. Im Ballhaus von Versailles erklärten sie sich zur Nationalversammlung. Wie hiess der französische König, welcher zu dieser Zeit regierte? König Ludwig XVI. Beschreibe seinen Charakter. Er war guten Willens und milde, aber unentschlossen und energielos. 5. 6. 7. Welche Aufgabe gab sich die «Nationalversammlung» selbst? Sie gab sich selbst die Aufgabe, für Frankreich eine neue Ordnung nach den Grundsätzen der Aufklärung zu schaffen. Erkläre den Ausdruck «Verfassung». Eine Verfassung ist das Grundgesetz eines Staates, das in schriftlicher Form die grundsätzlichen Rechte und Pflichten der Bürger festhält. Welche wichtigen Punkte sollten in einer Verfassung enthalten sein? Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Gleichberechtigung aller, Regierungsform, Pflichten des Bürgers Seite 1 von 1 Kernthema 2: Revolution in Frankreich Warum eine Revolution? Partnerarbeit 1. 2. 3. Wie hiessen die Nachfolger Ludwigs XIV., und wie regierten sie? (Vgl. Bild 3, S.168.) Die Nachfolger Ludwigs XIV. hiessen Ludwig XV. und Ludwig XVI. Beide regierten absolutistisch. In welche drei Stände war die Bevölkerung seit dem Mittelalter eingeteilt? Die Bevölkerung war seit dem Mittelalter eingeteilt in den 1. Stand Geistlichkeit, den 2. Stand Adel und den Dritten Stand alle übrigen Einwohner Frankreichs eingeteilt. Welche dieser Stände besassen Vorrechte, welche Leistungen hatten sie früher dafür erbringen müssen, und was leisteten sie jetzt noch? Geistlichkeit und Adel hatten viele Vorrechte. Früher war es die Aufgabe des Adels gewesen, das Volk zu beschützen und das Heer zu stellen. Die Geistlichkeit vollbrachte Leistungen im Schul- und Armenwesen. Jetzt leistete der Adel nichts mehr, denn das Heer bestand längst aus vom König bezahlten Söldnern. Die Kirche erbrachte zwar immer noch ihre Leistungen, zu viele Geistliche lebten jedoch in Luxus und Müssiggang. 4. Wie glichen der König und sein Finanzminister die Differenz zwischen Staatsausgaben und Staatseinnahmen (Defizit) aus? Sie liehen bei den Banken Geld aus und machten so Schulden. 5. Wie wollte König Ludwig XVI. zu mehr Staatseinnahmen gelangen? Der König wollte in Zukunft auch vom Adel Steuern verlangen. Welchen Erfolg hatte er? Der Adel war damit nicht einverstanden. Da der König im Heer und in der Verwaltung auf die Adligen angewiesen war, fiel es ihm schwer, seinen Willen durchzusetzen. 6. 7. Wen rief der König zusammen, um das Finanzproblem zu lösen? Der König entschied sich, Vertreter aus allen drei Ständen, die «Generalstände», einzuberufen. Wie wurden die Vertreter in die Ständeversammlung gewählt? Die Bürger wählten aufgeteilt nach Ständen in den Distrikten Wahlmänner, diese wiederum wählten einen Vertreter in die Ständeversammlung. Seite 1 von 3 Kernthema 2: Revolution in Frankreich Warum eine Revolution? Partnerarbeit 8. Wie setzte sich die Ständeversammlung zusammen, und aus welcher Bevölkerungsschicht stammten die Vertreter des Dritten Standes? Adel und Geistlichkeit stellten je etwa 300 Vertreter, der Dritte Stand 600. Die Vertreter des Dritten Standes waren zur Hauptsache wohlhabende Bürger und Juristen. 9. Wie wollten Adel und Geistlichkeit in der Versammlung abstimmen? Sie schlugen vor, dass bei allen Fragen jeder Stand für sich abstimmen und dann eine Stimme abgeben solle. Welches Ziel verfolgten sie damit? Lies dazu Quelle 23, S.166f. (Vgl. Bild S.166.) Sie hofften, so den Dritten Stand jeweils 2:1 überstimmen zu können. 10. Wie reagierte der Dritte Stand auf diese Forderungen der anderen beiden Stände? Lies dazu Quelle 24 und 25, S.167. Der Dritte Stand war gegen diese Forderungen. Er verlangte als zahlenmässig stärkster Stand Gleichberechtigung und wollte nach Köpfen, nicht nach Ständen abstimmen. 11. Welche Absichten hatten die wohlhabenden Bürger des Dritten Standes? Sie wollten nicht nur die Steuern für die Adligen einführen, sondern auch die Gelegenheit nützen, die Vorrechte der ersten zwei Stände abzuschaffen und den Staat umzugestalten. Woher hatten sie die Ideen? Unter den wohlhabenden Bürgern hatten sich die Ideen der Aufklärung durchgesetzt. 12. Wie wurden die einfachen Bürger von Paris genannt? Man nannte sie «Sansculotten». Erkläre diesen Ausdruck. (Vgl. dazu Bild 2, S.167.) Man nannte sie «Sansculotten», weil sie statt Kniehosen und Kniestrümpfen, wie es in den besseren Kreisen üblich war, lange, offene Hosen trugen. 13. Wie war die Lage dieser einfachen Bürger im Jahre 1789? Lies dazu Quelle 26, S.167f. Ihr Einkommen war sehr gering; zwei Drittel davon brauchten sie für Nahrungsmittel, allein die Hälfte für das tägliche Brot, von dem es immer zuwenig gab. Was erwarteten sie deshalb von der Neugestaltung des Staates? Sie erwarteten von der Neugestaltung des Staates vor allem die Beseitigung ihrer Not. 14. Welches waren die Hoffnungen der Bauern? Lies dazu Quelle 27, S.169. (Vgl. Bild 1, Seite 2 von 3 Kernthema 2: Revolution in Frankreich Warum eine Revolution? Partnerarbeit S.168.) Für die Bauern war die Senkung der Steuern und Abgaben am wichtigsten. 15. Auf wessen Seite stellte sich Ludwig XVI.? Er stellte sich auf die Seite der Geistlichkeit und des Adels. Was befahl er den Vertretern der Stände? (Vgl. Bild 2, S.168.) Er befahl den Vertretern der Stände, nach Ständen getrennt zu diskutieren und dabei nur das Steuerproblem zu behandeln. 16. Wie reagierten die Vertreter des Dritten Standes auf die Parteinahme des Königs? (Vgl. Bild 4, S.169.) Die Vertreter des Dritten Standes hielten sich nicht an den Befehl des Königs. Im Ballhaus von Versailles erklärten sie sich zur Nationalversammlung. 17. Welche Aufgabe gaben sich die Vertreter des Dritten Standes? Sie gab sich selbst die Aufgabe, für Frankreich eine neue Ordnung nach den Grundsätzen der Aufklärung zu schaffen. Wie sollte die neue Ordnung festgehalten werden? Sie sollte schriftlich, in einer Verfassung, festgehalten werden. 18. Wer sollte nun die Macht im Staate besitzen? Der König sollte nicht alle, aber einen Teil seiner Macht verlieren. In Zukunft sollte er zusammen mit der Nationalversammlung regieren. 19. Wer schloss sich von den anderen Ständen der «(Nationalversammlung» an? Viele ärmere Geistliche aus dem Ersten und einige fortschrittliche Adlige aus dem Zweiten schlossen sich der Nationalversammlung an. 20. Was hatte damit in Frankreich begonnen? Damit hatte in Frankreich die Revolution begonnen. Seite 3 von 3 Kernthema 2: Revolution in Frankreich Der Weg zu einer Verfassung (1789-1791) 1. Mit welchem Ereignis begann der Volksaufstand gegen den König? Der Volksaufstand gegen den König begann mit dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789. Welche Auswirkungen hatte dieses Ereignis? Der König verzichtete nun endgültig darauf, mit seinem Heer in die Entwicklung einzugreifen. Die Nationalversammlung spürte das Volk hinter sich und ging nun daran, eine fortschrittliche, aufgeklärte Ordnung für Frankreich auszuarbeiten. Gleichzeitig begann sie, immer mehr an Stelle des Königs die Regierung auszuüben. 2. Wohin mussten König und Nationalversammlung im Herbst 1789 umziehen? König und Nationalversammlung mussten im Herbst 1789 nach Paris umziehen. Warum? Das Volk, allen voran die Sansculotten, wollten so den König und die Nationalversammlung kontrollieren und unter ihren Einfluss bringen. 3. 4. In welcher Lage befand sich der König nun? Der König stand nun unter dem Druck der Sansculottes. Welche Massnahmen traf die Nationalversammlung, um die Wünsche der Bauern und Bürger zu befriedigen? Sie schaffte die Vorrechte des Adels und der Kirche ab. Der Grundbesitz der Kirche wurde verstaatlicht und später verkauft. 5. Beurteile das Verhalten des Königs. Der König war unentschlossen und wollte es mit keiner Seite verderben. Hätte er die Revolution verhindern können? Wäre er eine starke Führerpersönlichkeit gewesen, und hätte er auch diplomatisches Geschick gehabt, wäre es vielleicht möglich gewesen, die Revolution zu verhindern. 6. Wie bezeichnet man diese Staatsform? Diese Staatsform heisst konstitutionelle Monarchie (Königsherrschaft mit Parlament aufgrund einer Verfassung). Vergleiche die Verfassung von 1791 mit den Staatstheorien der Aufklärer. Die Gewaltentrennung war 1791 vollzogen, ebenso konnte das Volk seine Vertreter wählen. Die Freiheitsrechte waren in der Verfassung festgehalten. Somit waren die wichtigsten Ideen der Aufklärer verwirklicht. Seite 1 von 1 Rückblick: Wie soll ein Staat regiert werden? Widerstand gegen den König? 1. 2. 3. Wie entstanden die heutigen Staaten Belgien und Niederlande (Holland)? Belgien und die Niederlande mussten ihre Unabhängigkeit in einem jahrzehntelangen Krieg vom spanischen König erkämpfen. Erkläre den Ausdruck Parlament. Das Parlament ist die Volksvertretung. Es besteht meist aus zwei Kammern. Aus welchen zwei Teilen setzte sich das englische (später britische) Parlament zusammen? In England heissen die beiden Kammern Ober -und Unterhaus, in der Schweiz National- und Ständerat. Wer gehörte diesen beiden Teilen an? Im englischen Oberhaus sassen die Vertreter des Adels, sowie der Kirche. Im Unterhaus waren der niedere Adel, die gut gestellten Bürger und die Bauern vertreten. 4. 5. Wie wurde in Grossbritannien die Arbeit zwischen König und Parlament aufgeteilt? Ober- und Unterhaus beschlossen Gesetze und legen Steuern fest. Der König und seine Minister führten aus, was das Parlament beschlossen hatte. Vergleiche die Staatsform im alten Athen mit derjenigen in Grossbritannien im 18.Jahrhundert. In Athen waren alle männlichen erwachsenen Bürger an der Volksversammlung beteiligt, in Grossbritannien nicht. In Athen konnte ein niemand zum Alleinherrscher werden. Die eigentliche Regierung wurde ebenfalls vom Volk bestimmt. In Athen zählte allein die Tüchtigkeit, in Grossbritannien ebenfalls der Rang und die Stellung. 6. Welches ist der Hauptunterschied zwischen der Monarchie in Grossbritannien damals und heute? Die heutige Königin ist nur noch auf dem Papier Herrscherin über Grossbritannien. Die eigentliche Macht liegt beim Premierminister. Nenne einige weitere, heute noch bestehende Monarchien und die Namen der Monarchen. Königin Elisabeth II. von Grossbritannien König Juan Carlos von Spanien Königin Beatrix von Niederlande Welche Funktion haben diese Könige? Die Königsfamilie hat hauptsächlich noch Repräsentationsaufgaben wahrzunehmen. Seite 1 von 1 Rückblick: Wie soll ein Staat regiert werden? Die Demokratie in Athen Partnerarbeit 1. Weshalb gründeten die Griechen keinen Staat nach dem Vorbild der Ägypter? Weil Griechenland durch die Berge und das Meer so stark unterteilt war, konnte während sehr langer Zeit niemand die Herrschaft über ganz Griechenland erringen. Die einzelnen Landschaften Griechenlands waren selbständig. Ihre Bewohner mussten und wollten ihre Staatsordnung selbst bestimmen. 2. Beschreibe in Stichworten die Gemeinschaft, welche die Bewohner der Halbinsel Attika schufen. Um ca. 800 v. Chr. Vereinigung zur Polis ( Gemeinschaft, Stadt). Burg ( Akropolis) im Zentrum als Zufluchtsort. Entwicklung einer Stadt um die Burg Gleichstellung aller Einwohner der Landschaft Attika. 3. Welche Herrschaftsform (Staatsform) führten die Athener um 500 v.Chr. ein? Um 500 v.Chr. führten die Athener die Herrschaft aller Bürger, die Demokratie (demos: das Volk; kratos: die Herrschaft), ein. Was bedeutete dies für die Bürger? Alle Bürger sollten die gleichen Rechte haben. Jeder musste auch Militärdienst leisten. 4. Welche Aufgaben hatte die Volksversammlung in Athen? Jedes Gesetz, jeder Vertrag, jede Kriegserklärung und jeder Friedensschluss brauchte die Zustimmung der Mehrheit der Volksversammlung. Die Volksversammlung wählte auch die Kriegsführer, die zehn Strategen. Sie konnte auch Bürger, die verdächtigt wurden, nach der Alleinherrschaft zu streben, für zehn Jahre aus dem Land verbannen. 5. Wie wurde der «Rat der 500» gebildet? Die einzelnen Dörfer oder Stadtquartiere Athens wurden in zehn Phylen zusammengefasst. Jede Phyle wählte aus ihren Bürgern 50 Ratsmitglieder. Welche Aufgaben hatte er? Der Rat der 500 arbeitete Vorschläge für die Volksversammlung aus und sorgte für die Durchführung der Beschlüsse. 6. Lies Quellentext 1, S.152 ff. Welche Bedeutung hat nach Perikles die demokratische Staatsform? Sie ist einzigartig und mustergültig. Sie ist Sache der Mehrheit. Vor dem Gesetz sind alle Bürger gleich. Es herrscht ein freier Geist (Liberalismus). Das Ansehen eines jeden hängt lediglich von seiner Tüchtigkeit ab. Worin unterscheidet sie sich von anderen Ordnungen? Sie ist Sache der Mehrheit und nicht von wenigen. Das Ansehen eines jeden hängt nur von seiner Tüchtigkeit ab. Seite 1 von 2 Rückblick: Wie soll ein Staat regiert werden? Die Demokratie in Athen Partnerarbeit 7. Beschreibe in Stichworten das «Panathenäenfest». Zu Beginn fünftägige Wettkämpfe in Laufen, Ringen, Boxen, Weitsprung, Diskuswerfen, Reiten, aber auch im Vortragen von Gedichten. Am sechsten Tag Umzug zur Akropolis. Schmücken des Athenestandbildes mit einem goldbestickten Gewand. Schlachten zahlreicher Opfertiere, Verteilung des Fleisches ans Volk. Festessen bis am nächsten Morgen. Suche die angeführten Orte auf den Bildern S.153. Akropolis: Propyläen: Parthenon: 8. Bild 1 und 2 Nummer 1 Nummer 5 Erkläre die Ausdrücke «Tragödie» und «Komödie» (Lexikon!) und beschreibe, welche Stoffe die Athener für diese beiden Gattungen des Theaters verwendeten. Tragödie Trauerspiel. Als Stoffe für die Tragödien dienten Sagen aus ferner Vergangenheit. Komödien Lustspiel. Als Stoffe für die Komödien dienten Ereignisse der Gegenwart. Hier wurden, wie im heutigen Kabarett, die einzelnen Politiker, manchmal auch das ganze Volk von den Verfassern aufs Korn genommen. 9. Lies Quellentext 2, S.155 (verteilte Rollen). Wie beurteilt der Sklave die Politiker? Er meint sie seien gemein, pöbelhaft, frech, von niederem Charakter und ohne Erziehung. Die Politiker sind nicht vornehm, sondern gehören zu den allereinfachsten Leuten. Sie brauchen nicht qualifiziert zu sein, weder rechnen noch lesen zu können. Die Politiker hofieren dem Volk und schmieren ihm Honig ums Maul. Mit welcher Absicht hat wohl Aristophanes diese Komödie geschrieben? Er will wohl einerseits die Leute zum Lachen bringen, indem er die schlechten Seiten der Politiker übertreibt, anderseits steckt in seinem Spott sicher auch eine Portion Wahrheit und damit Kritik an den Herrschenden. 10. Für wen allein galten die Rechte und Pflichten in der Demokratie Athens? Die Rechte und Pflichten galten nur für die männlichen athenischen Bürger. Wer war davon ausgeschlossen? Zuwanderer und erst recht Sklaven erhielten das Bürgerrecht nicht. Berechne in Prozenten den Anteil der vollberechtigten Bürger an der Gesamtbevölkerung (S.155). Vollbürger: 12.9% Niedergelassene: 16.1% Deren Frauen und Kinder: 38.7% Sklaven: 32.3% Seite 2 von 2