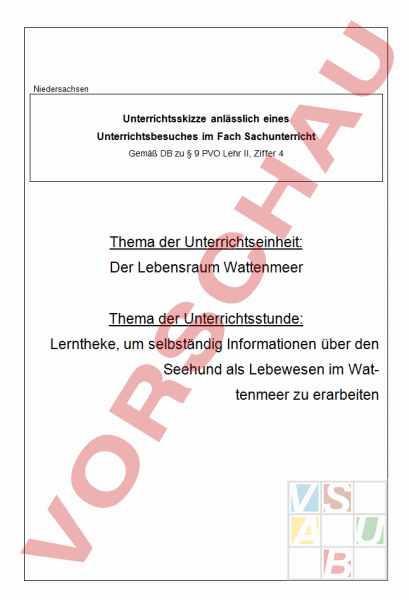Arbeitsblatt: Lerntheke zum Seehund /Wattenmeer
Material-Details
Ein ausführlicher Unterrichtsentwurf zum Wattenmeer /Seehund mit differenzierten Arbeitsstationen und Material.
Biologie
Tiere
4. Schuljahr
19 Seiten
Statistik
32228
1410
18
08.01.2009
Autor/in
kaef (Spitzname)
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Niedersachsen Unterrichtsskizze anlässlich eines Unterrichtsbesuches im Fach Sachunterricht Gemäß DB zu § 9 PVO Lehr II, Ziffer 4 Thema der Unterrichtseinheit: Der Lebensraum Wattenmeer Thema der Unterrichtsstunde: Lerntheke, um selbständig Informationen über den Seehund als Lebewesen im Wattenmeer zu erarbeiten 1. Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit 1. Stunde: Einstieg in die Unterrichtseinheit – Schüler 1erstellen eine individuelle Mind-Map zum Thema: Das Wattenmeer. 2. Stunde: Das Gebiet des Nationalparks Wattenmeer – Kartenarbeit unter besonderer Betrachtung der Einzigartigkeit des Wattenmeeres 3. Stunde: Die Naturschutzzonen – Schüler erarbeiten sich mit Hilfe von Texten die Bedeutung und unterschiedlichen Regeln für den Aufenthalt innerhalb der Schutzzonen im Nationalpark Wattenmeer. 4. Stunde: Was ist das Watt? –Schüler erfahren grundlegende Informationen zum Watt (Entstehung), indem sie einen Text lesen und sich gegenseitig Fragen stellen. 5. Stunde: Einstimmung auf die Exkursion Schüler werden auf die Exkursion eingestimmt und motiviert, indem sie die Geschichte von Lükko und seinen Freunden vorgelesen bekommen, sowie den Klassenraum gestalten. Klassenfahrt auf die Insel „Juist und Wattwanderung 6. Stunde: Erlebnisbericht der Klassenfahrt Schüler berichten über ihre Erlebnisse von der Klassenfahrt. 7.-9- Stunde: Das Wattmodell Schüler vertiefen ihre Erfahrungen, indem sie ein Wattenmeermodell aus Gips herstellen. 10. Stunde: Steckbriefe schreiben Schüler stellen verschiedene Steckbriefe von Tieren (des Lebensraumes Wattenmeer, jedoch keine Säugetiere) im Rahmen einer Stationsarbeit her. 11. Stunde: Lerntheke um selbständig Informationen über den Seehund als Lebewesen im Wattenmeer zu erarbeiten. 12. Stunde: Wiederholung und Vertiefung Schüler wiederholen und vertiefen ihre Kenntnisse zum Wattenmeer an Stationen. 13. Stunde: Klassenarbeit zur Unterrichtseinheit „Das Wattenmeer 2. 2.1. Kompetenzen Endkompetenz der Unterrichtseinheit Die Schüler sollen das Wattenmeer mit seiner einzigartigen Tierwelt kennen lernen. Sie sollen das Wattenmeer in seiner Gesamtheit als Lebensraum und ökologisches System erfahren. Im direkten Erleben des Wattenmeeres sollen die Schüler sich mit dem Naturtypus vertraut machen und eine lokale Identität entwickeln. 2.2. Endkompetenz der Unterrichtsstunde Die Schüler sollen selbstständig und handlungsorientiert Informationen über den Seehund als Lebewesen des Wattenmeeres sammeln, sich insbesondere über seinen Jahreszyklus und seine Stellung in der Nahrungskette informieren. 1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwende ich jeweils die männliche Form für Schüler und Schülerinnen. 0 2.3. Teilkompetenzen der Unterrichtsstunde Die Schüler sollen • (TK 1): sollen für das Thema der Stunde sensibilisiert und fasziniert werden, indem sie über ihre auditive Wahrnehmung die Stimmen der Seehunde hören und über die visuelle Wahrnehmung Beobachtungen am realen Tier machen. • (TK 2): das Präparat genau beobachten und mit zutreffenden Begriffen beschreiben können. Differenzierte Teilkompetenzen der einzelnen Arbeitsaufträge der Lerntheke: • (TK 3): .sollen Merkmale des Tieres in einem Steckbrief beschreiben können, indem sie beobachten und ihre Beobachtungen differenziert verschriftlichen. (1)2 • (TK 4): eine exemplarische Abfolge einer Nahrungskette kennen lernen und beschreiben können, indem sie differenziert einen Text lesen, einen Lückentext ausfüllen, Puzzleteile richtig aneinanderlegen,. (2) • (TK 5): differenziert die Stellung des Seehundes in der Nahrungskette und seinen Bedarf an Nahrung erkennen, indem sie das Puzzle der Nahrungspyramide legen und Beobachtungen festhalten. (3) • (TK 6): exemplarisch den Jahreszyklus des Seehundes kennen lernen, indem sie das Schaubild vervollständigen und differenziert Daten berechnen. (4) • (TK 7): anhand einer Bildreihenfolge den Grund für das Vorkommen der Heuler durch Menschstörungen erfahren, indem sie die Bilder in die richtige Reihenfolge legen und das Lösungswort im Heft notieren. (5) • (TK 8): sich differenziert Kenntnisse zur Fortbewegung des Seehundes erarbeiten und ihre Kenntnisse über Lebewesen des Wattenmeeres prüfen, indem sie die Zusatzstationen bearbeiten (Zusatzangebote). • (TK 9): ihren Lernzuwachs verbal beschreiben und ihn mit Hilfe des Schaubildes der Nahrungspyramide darstellen. • (TK 10): die Problemstellung („Was passiert, wenn Öl ins Wasser des Wattenmeers gelangt?) anhand der Nahrungspyramide analysieren und mögliche Folgen beschreiben können. 2.4. Übergeordnete Teilkompetenzen Die Schüler sollen • (ÜTK 1) Informationstexte möglichst selbstständig sinnerfassend lesen können. • (ÜTK 2) selbstständig zu einem Thema an einer Lerntheke arbeiten können. • (ÜTK 3) ihre Arbeitsergebnisse genau verschriftlichen können (Arbeitsheft). 2 Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Nummern der Arbeitsaufträge. 1 3. Klassensituation 3.1. Rahmenbedingungen Die Lerngruppe setzt sich aus 25 Schülern zusammen, davon 16 Jungen und 9 Mädchen. 3.2. Arbeits- und Sozialverhalten Das Arbeitsverhalten in dieser Klasse ist im Allgemeinen befriedigend. xxxxx 3.3. Lernvoraussetzungen Die Schüler konnten auf ihrer Klassenfahrt und Wattwanderung den Lebensraum Wattenmeer mit seiner Tier- und Pflanzenwelt ganzheitlich erfahren. Im Voraus wurden die Schüler auf die Klassenfahrt eingestimmt und nicht mit Informationen überfrachtet. Die Schüler kennen individuell unterschiedliche Lebewesen (Silbermöwe, Plankton, Strandkrabbe, Sandpierwurm, Herzmuschel, Sandklaffmuschel,), da sie unterschiedliche Informationen von der Wattwanderung verinnerlicht haben und individuelle Steckbriefe zu verschiedenen Tieren geschrieben haben. Auf diese Lernvoraussetzungen können die Schüler beim Schreiben des Steckbriefes, bei der Erarbeitung der Nahrungskette und Pyramide zurückgreifen. Für die weitere Bearbeitung der Arbeitsaufträge müssen die Schüler auf ihre Kenntnisse zum Aufbau des Kalenderjahres, zum Umgang mit dem Maßband und auf ihre Fähigkeiten der Addition im Hunderterraum zurückgreifen. Das selbstständige Beschaffen von Informationen mit Hilfe des Computers ist den Schülern bekannt. Die Organisation der Differenzierung mit den Eintrittskarten und Lerntheke ist ebenfalls eingeführt. 3.4. Leistungsstand Der Leistungsstand der Klasse ist im Allgemeinen unterschiedlich. In der Tabelle unter 3.5 wird deutlich, welche Schüler ich als leistungsstark und leistungsschwach bewerte. Dabei ist nicht nur die Leistungsfähigkeit der Schüler im fachlichen Bereich, sondern auch ihre Fähigkeit selbstständige Arbeitsweisen anzuwenden, gemeint. 3.5. Individuelle Voraussetzungen Informationstexte Selbstständiges Bearbeiten sinnerfassend lesen der Arbeitsaufträge der Lerntheke o o o Fachliche Kenntnisse zum Lebensraum Wattenmeer anwenden o o 2 o o o - o o o kann gut o o kann eingeschränkt o kann mit Hilfe - 4. Sachanalyse Der Seehund ist ein typisches Säugetier des Wattenmeeres. Sein „wissenschaftlicher Name lautet „Phoca vitulina; lateinisch, wörtlich übersetzt: Seekalb, so wurde der Seehund früher auch in Deutschland genannt (Heers, S. 10). Er wird 120 cm bis180 cm lang und 55 kg bis 130 kg schwer, das Weibchen bleibt meist kleiner als das Männchen. Seehunde werden bis zu 40 Jahre alt. Sein Aussehen beschreibt Heers folgendermaßen: „Spindelförmiger Körper, kurze Haare, grau gefleckter Pelz, je zwei Vorder- und Hinterflossen, große Augen, Ohrlöcher (Ohrmuscheln fehlen), kräftiges Gebiss, lange Barthaare (Heers, S. 10). Ihre Jungen bringen die Seehunde von Mitte Juni bis Juli auf einer Sandbank zur Welt. Sie müssen aufgrund der Tide den Geburtszeitpunkt genau abpassen. Bei der nächsten Flut müssen die Jungen bereits im Wasser schwimmen. Von Mitte Juni bis Mitte August sammeln sich die Muttertiere und ihre Jungen zum Säugen auf den Sandbänken. Nach fünf bis sechs Wochen Betreuung durch die Mutter werden die jungen Seehunde von ihr verstoßen. Für die Seehunde beginnt wieder die Paarungszeit von Ende Juli bis Anfang August, damit im nächsten Jahr nach einer embryonalen Entwicklungszeit von 8 Monaten wieder ein Junges geboren wird. Da die Geburt und die Befruchtung nur zwei Monate auseinander liegen, ruht das befruchtete Ei nach der Zellteilung. Somit hat die Natur das Problem gelöst, dass sich die Geburt jährlich um zwei Monate nach vorne schiebt. (vgl.: Heers, S.27 34) Während der Säugezeit sind die jungen Seehunde besonders durch Störungen gefährdet, da sich ihr Nabel bei häufiger Flucht über den Sand ins Wasser aufscheuern und entzünden kann. Ist die Störung stark, zum Beispiel durch stürmisches Wetter, durch Störungen von Menschen kann das Jungtier von seiner Mutter getrennt werden und muss verhungern. Die getrennten Jungtiere suchen rufend nach ihren Müttern. In den Fällen, wo die Mutter nicht wieder zu ihrem Jungtier zurück findet, werden solche „Heuler in besondere Seehund-Aufzuchtsstationen gebracht und bis zum Herbst gepflegt. Wichtig ist, dass man den „Heuler in Ruhe lässt, wenn man ihn findet. Oft kehrt die Mutter zu ihrem Jungen zurück, nicht aber wenn Menschen in der Nähe sind. (vgl.: RUZ Ökowerk Emden, S. 46) 3 Ein Seehund frisst täglich 2-5 kg Fisch (Schollen). Nahrungskette: „Die Planktonpflanzen und –tiere, Garnelen, Fische und Seehunde bilden zusammen eine Kette von einzelnen Gliedern (ebda. S.38). Fehlt ein Glied wird die Kette an dieser Stelle gestoppt, folgende Tiere können dann nicht mehr leben. Die Kieselalgen (pflanzliches Plankton) sind die Träger dieses Ökosystems. Viele mikroskopisch kleinen Tiere (tierisches Plankton) leben von den Kieselalgen. Die kleinen Planktontierchen werden von größeren Tieren (Garnelen, größere Würmer, Muscheln und Fische) gefressen. Diese dienen größeren Fischen, wie der Scholle oder Vögeln als Nahrung. Die Scholle wird vom Seehund gefressen. Anhand der Nahrungspyramide wird deutlich, wie viele Planktonpflanzen und –tiere für die Ernährung eines Seehundes notwendig sind (Seehund frisst ca. 30 Schollen, eine Scholle frisst ca. 25 kleine Fische, 1 kleiner Fisch frisst 25 Garnelen, eine Garnele frisst 100 Planktontiere, ein Planktontier frisst 1000 Kieselalgen) (vgl.: ebda., S. 39). Deutlich wird aber auch, dass im Falle einer Giftverbreitung im Wattenmeer der Seehund aufgrund seiner hohen Stellung in der Nahrungspyramide am meisten Giftteilchen frisst und somit zu den empfindlichsten Tieren im Wattenmeer gehört. „Der Seehund ist einer der besten Botschafter für saubere intakte Meere und Küsten (Heers, 1999, S. 80). 5. Didaktische Analyse 5.1. Curriculare Vorgaben Die Rahmenrichtlinien schreiben verbindlich vor, Landschaftsformen der näheren Umgebung im Unterricht zu behandeln. Das Thema „Der Lebensraum Wattenmeer lässt sich nicht nur dem Lernfeld „Mensch und heimatlicher Lebensraum zuordnen, sondern auch dem Lernfeld „Mensch und Natur (vgl.: Rahmenrichtlinien). In Anlehnung an das Kerncurriculum für das Fach Sachunterricht lässt sich diese Unterrichtseinheit und Unterrichtsstunde unter der fachlichen Perspektive „Raum zuordnen. Die Schüler sollen Kenntnisse und Fähigkeiten über „Typische Landschaftsformen (z.B.: Küste,) in der eigenen Region (vgl. Kerncurriculum Sachunterricht) und zur „Erkundung, Beschreibung und Dokumentation von naturgegebenen Merkmalen eines ausgewählten Raumes (Entstehung, Oberfläche, Gewässer, Boden, Pflanzen und Tiere) (vgl.: ebda) erwerben. In der heutigen Unterrichtsstunde sollen die Schüler insbesondere den Jahreszyklus des Seehundes exemplarisch auch für andere Lebewesen kennen lernen, die „Abhängigkeiten der Lebewesen zueinander und Lebensgemeinschaften im Wattenmeer mit Hilfe der Nahrungskette beschreiben und ihr Umweltbewusstsein entwickeln (vgl.: Kerncurriculum). 5.2. Fach- und Schülerrelevanz Durch das ganzheitliche Erfahren des Lebensraumes Wattenmeer während der Klassenfahrt und durch die anschließende Nachbereitung mit Hilfe von zum Teil selbst gesammelter bzw. selbst angefertigter Dinge, Modelle und Bildern soll die Bereitschaft und Fähigkeit zum entdeckenden Lernen gefördert werden. Für die Kinder besteht eine fließende Grenze zwischen Schule, erlebnisorientiertem Unterricht und Freizeit. Die Schüler dieser Klasse haben z.B. bei der Klassenfahrt vielfältige Erfahrungen und Erkundungen gemacht. Leider war es ihnen nicht möglich die „beliebten Seehun- 4 de mit eigenen Augen zu beobachten, kennen zu lernen und Informationen zu sammeln. Der Seehund als exemplarisches Lebewesen für das Erwerben der oben genannten Kenntnisse und Fähigkeiten motiviert die Schüler intrinsisch. Einzelne Schüler haben bereits Beobachtungen oder Informationen zu den Seehunden im Familienurlaub oder aus der Zeitung während ihres „Zischprojekts gesammelt. Dies, aber auch die unterschiedlichen Fähigkeiten zum selbstständigen Lernen sind Grund dafür, die Schüler differenziert Informationen zum Seehund erarbeiten zu lassen. An der differenzierten Lerntheke können die Schüler in dieser Unterrichtsstunde ihre Erfahrungen zum Seehund ausweiten, Freude am Wiedererkennen und Entdecken erfahren, aber auch neue Informationen handlungsorientiert und mit vielen Sinnen sammeln. Das Sammeln von Informationen zum Seehund bietet Ansätze, die Ökologie und die Schutzbedürftigkeit eines Lebensraumes kennen zu lernen. 5.3. Didaktische Reduktion Aufgrund der Informationsfülle zum Seehund habe ich in dieser Unterrichtsstunde einen Schwerpunkt auf die möglichen Beobachtungen am Tier selbst, auf den Jahreszyklus des Seehundes sowie seiner Stellung in der Nahrungskette und Nahrungspyramide gelegt. Die Erarbeitung des Jahreszyklus des Seehundes habe ich auf die Paarungszeit, die Geburtszeit, die Säugezeit und die gesamt Tragzeit mit Ruhephase reduziert, weil sich die Schüler so das Schaubild einfacher erschließen können. Die Tiere in der Nahrungskette auf dem Puzzle sowie dem Arbeitsblatt sind aufeinander abgestimmt. Ich habe mich z.B. für die Fische entschieden und gegen die Vögel, da den Schülern die Fische als Wurm- oder Muschelfresser unbekannter sind, sie aber für den Seehund eine wichtige Nahrungsquelle bieten. Dabei habe ich keine Unterscheidung zwischen den kleinen Fischen (Kabeljau, Hering) und großen Fischen (Scholle) vorgenommen, um die Übersicht des Schaubildes zu erhalten. Auch tierisches und pflanzliches Plankton habe ich zusammengefasst. 5.4. Auswahl der Aufgaben Bei der Auswahl der Arbeitsaufträge habe ich mich für die Aufgabenformate entschieden, die eine ganzheitliche, fächerübergreifende und handlungsorientierte Erarbeitung von Informationen zum exemplarisch gewählten Lebewesen bieten. Das Schreiben eines Steckbriefes unterstützt die ganzheitliche Wahrnehmung des Tieres insbesondere seiner typischen Eigenschaften (z.B.: Fell, Flossen, Stimme,). Die Wahl, zwischen Nahrungskette und Nahrungspyramide zu trennen, soll den Schülern zum einen helfen das Prinzip der Nahrungskette zu verstehen und zum anderen die Stellung des Seehundes im Lebensraum Wattenmeer und die Folgen bei einer Umweltverschmutzung zu analysieren. 6. Methodische Analyse Für den Einstieg in die Unterrichtsstunde habe ich mich für ein auditives Medium entschieden. Das Hören der Stimmen eines rufenden und schnaufenden Seehundes sowie eines Seehundes im Rudel soll die Aufmerksamkeit der Schüler wecken und sie für das Thema der Stunde motivieren. Durch die visuellen Beobachtungen und später auch durch das Fühlen am Präparat werden weitere Sinne 5 der Schüler angesprochen. Das ganzheitliche Prinzip schließt eine am entdeckenden und handlungsorientierten Lernen ausgerichtete Unterrichtsorganisation mit ein. Die Methode der Verrätselung in der Hinführung soll die Konzentration der Schüler zusätzlich fördern. Ein alternativer Impuls wäre eine Geschichte von einem Seehund, der seine Welt erkunden möchte, gewesen. Jedoch fällt es einigen Schülern schwer, die Geschichte aufmerksam zu verfolgen. Die Sozialform des Sitzkreises gewährt allen Schülern eine gute Sicht auf das Präparat, die Konzentration aller Schüler auf das Unterrichtsgeschehen sowie eine Kommunikation fördernde Atmosphäre. Zur visuellen Unterstützung der Vermittlung des Arbeitsauftrages befindet sich dieser für die Schüler ständig präsent auf einem Plakat an der Tafel. Um Unklarheiten bei der Bearbeitung zu vermeiden, wiederholt ein Schüler den Arbeitsauftrag mit möglichst eigenen Worten. Eventuell lasse ich einen Schüler beispielhaft den Arbeitsauftrag durchführen. Für die Erarbeitungen verschiedener Informationen zum Seehund habe ich mich für die Lerntheke als Methode entschieden. Die Schüler können sich selbstständig und nach ihrem jeweiligen Leistungsstand (siehe individuelle Lernvoraussetzungen) differenziert über den Seehund informieren. Vielfältige Themenbereiche wie Entwicklung, Ernährung etc. des Seehundes können gleichzeitig thematisiert werden. Um den Schülern eine freie Wahl der Abfolge der Stationen zu ermöglichen und gleichzeitig auch Engpässe bezüglich der Stationsaufgaben (vgl. Klassengröße) zu vermeiden, holen sich die Schüler die Arbeitsmaterialien an einer Lerntheke und wandern nicht von Station zu Station. Zudem bietet die Lerntheke einen Vorteil bezüglich der Differenzierung, da die unterschiedlichen Lerntheken klar und übersichtlich getrennt sind. Während der Arbeitsphase dürfen die Schüler sich gegenseitig helfen, damit die Kommunikation, Selbständigkeit und Hilfsbereitschaft zwischen den Schülern gefördert wird. Die Arbeitsblätter leiten die Schüler zum selbstständigen Ausfüllen an. Mit dem vorbereiteten Seehundheft (die zusammengehefteten Arbeitsblätter) haben die Schüler einen Überblick über die erledigten Arbeitsaufträge. Sie unterstützen die Sicherung der Ergebnisse und fordern die Schüler zu einer strukturierten selbstständigen Arbeitsweise auf. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, die Schüler hätten die Aufgaben nur mündlich oder schriftlich mit Folienstiften auf Karteikarten bearbeitet. Da die Schüler jedoch neue Erkenntnisse und Fähigkeiten erwerben, sollen sie diese individuell schriftlich sichern. Um mir als Lehrerin einen genauen Überblick über die Leistungen zu verschaffen und allen Schülern eine angemessene Rückmeldung zu geben, sammle ich die Arbeitergebnisse zur Korrektur am Ende der Stunde ein. Einige Lernangebote, z.B. die Bilderfolge „Von der Geburt zum Heuler erfordern eine direkte Selbstkontrolle, die ich durch das Legen von Lösungswörtern anbiete. So bleiben mögliche Fehler nicht unbemerkt und die Schüler lernen gleichzeitig, ihre Ergebnisse selbstständig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren. In der Reflexionsphase sollen die Schüler ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten vorstellen. Als visueller Impuls unterstützt der Aufbau der Nahrungspyramide die Äußerungen der Schüler. 6 7. Stundenverlaufsplanung Uhr- Phase zeit Lernziel 10.10 Einstieg und Hinführung TK 1-2 Sozialform Medien Material • Begrüßung der Klasse und des Besuchs • S. hören Stimmen von der CD und sollen erraten, welches Tier es sein könnte. • S. flüstern ihre Vermutungen den Sitznachbarn ins Ohr. Stuhlkreis L.-SchülerGespräch CD, Papier • Ein S. schaut sich das Präparat unter dem Tuch an und beschreibt seinen Mitschülern einige Eigenschaften des Tieres. • erraten, welches Tier unter dem Tuch sein könnte. • S. verbalisieren ihre Beobachtungen am Präparat. • L. vermittelt den Schülern den Arbeitsauftrag, insbesondere das Verfahren mit der Lerntheke. • S. wiederholen den Arbeitsauftrag 10 10.20 Erarbeitung 23 Unterrichtssituation TK 3 8 TK ÜTK 1-3 10.43 Reflexion TK 9-10 13 Präparat Tuch Arbeitsauftrag Plakat • S. holen sich ihre Eintrittskarten (in 3 Gruppen nacheinander), ihre Arbeitshefte und ausgewählte Arbeitsaufträge von einer der zwei differenzierten Lerntheken3. • S. bearbeiten selbstständig ihre Arbeitsaufträge (siehe Anhang). • L. beobachtet die S., gibt Hilfestellungen und Unterstützung. • Zusatzangebote an der Zusatz – Lerntheke, als quantitative Differenzierung. EA (Helfer zugelassen) • S. tragen vor, was sie heute über Seehunde gelernt haben. • Falls nötig gibt der Lehrer Impuls zur Nahrungspyramide:( z.B.: „Wer hat die Nahrungspyramide bearbeitet? Welche Bedeutung hat der Seehund in der Pyramide?) • L. konfrontiert die S. mit dem Problem: Unfall in der Nordsee, ein Öltanker ist gekentert. Stuhlkreis L-S- Gespräch Modell der Nahrungspyramide (siehe Arbeitsauftrag 3) Differenzierte Arbeitshefte und Arbeitsaufträge mit Materialien (siehe Anhang) 4 3 Erläuterungen zu diesem Prinzip siehe Methodische Analyse. Rote Lerntheke: 12 Seehundhefte, 5 Arbeitsaufträge mit Material (in dreifacher Ausführung); blaue Lerntheke: 13 Seehundhefte, 5 Arbeitsaufträge mit Material (in dreifacher Ausführung); Zusatzstation: 3 Zusatzaufträge in (zweifacher Ausführung) 4 7 8. Literaturverzeichnis • Der niedersächsische Kultusminister (Hrsg.): Rahmenrichtlinien für die Grundschule. Ma- thematik. Hannover: Schroedel Schulbuchverlag, 1984. • Der niedersächsische Kultusminister (Hrsg.): Kerncurriculum für die Grundschule Schul- jahrgänge 1 – 4. Sachunterricht. Anhörfassung Januar 2006. • Stock, Zucchi, Bergmann Hinrichs: Watt. Lebensraum zwischen Land und Meer. Heide: Verlag Boyens Co., 1995. • Heers, Karl-Eberhard: Seehunde. Heide: Verlag Boyens Co., 1999. • Aktionskonferenz Nordsee e.V. (Hrsg.): Was ist los mit der Nordsee? Bremen: AKN, 2000. • Aktionskonferenz Nordsee e.V. (Hrsg.): Wattenmeer und Nordsee. Göttingen Lichtenau: AOL-Verlag und Verlag die Werkstatt, 1992. • Regionales Umweltzentrum Ököwerk Emden (Hrsg.): Informationsordner für Lehrkräfte (Die Wattenmeerkiste I). Emden: Regionales Umweltzentrum, 2002. 9. Anhang Sitzplan Arbeitsaufträge der Lerntheke 1 rot Der Seehund-Steckbrief 1. Fülle den Steckbrief des Seehundes aus! Gehe mit deinem Seehund-Heft zum Präparat und fülle die Merkmale aus! 1 blau Der Seehund-Steckbrief 1. Fülle den Steckbrief des Seehundes aus! 8 Gehe mit deinem Seehund-Heft zum Präparat und fülle die Merkmale aus! 2 Die Nahrungskette rot 1. Lege das Puzzle der Nahrungskette zusammen! 2. Löse den Lückentext mit Hilfe des Puzzles! 2 blau Die Nahrungskette 1. Lege das Puzzle der Nahrungskette! 2. Trage die richtigen Pfeile auf dem Arbeitsblatt ein! 3 rot Puzzle Nahrungspyramide 1. Puzzle die Pyramide zusammen! 2. Welches Tier ist an der Spitze? Was bedeutet das für dieses Tier? Schreibe deine Vermutung in dein Heft! 3 Puzzle Nahrungspyramide blau 1. Puzzle die Pyramide zusammen! 9 2. Schreibe in dein Seehund-Heft, wie die Tiere der einzelnen Stufen heißen! 4 Das Seehundjahr rot 1. Lies dir den Text aufmerksam durch! 2. Beschrifte den Jahreszyklus! 3. Wie viele Tage (ungefähr) im Jahr kannst du Seehundmütter sehen, die ihre Jungen säugen? 4. Wie oft bekommt ein Seehund in einem Jahr Junge? Schreibe es in dein Heft! 10 4 Das Seehundjahr blau 1. Schau dir den Verlauf des Seehundjahres an! 2. Male die Balken im Jahreskreis mit der richtigen Farbe an! 5 Von der Geburt zum Heuler! rot 1. Lege die Bilderkarten in die richtige Reihenfolge! 2. Lies zuerst alle Sätze durch und lege sie zu den passenden Bildern! 3. Die Buchstaben auf den Bildern ergeben ein Lösungswort, schreibe es in dein Seehund-Heft! 5 Von der Geburt zum Heuler blau 1. Lege die Bildkarten in die richtige Reihenfolge! 2. Schreibe das Lösungswort in dein Seehund–Heft! Z1 Seehund Fortbewegung 1. Gehe in den Computerraum und schaue dir die Bewegungen des Seehundes an! 2. Öffne Seite www.heino-juist.de! Klicke auf Wat(t) sehen, unter Video-Clips findest du den Seehund! 3. Beschreibe die Bewegung in deinem Heft! 11 Z2 Wattdomino Lege alle Dominosteine so hin, dass keins übrig bleibt! Du kannst es alleine probieren oder mit einem Partner. Z3 Wattenmeer-Memory Spiele das Wattenmeer-Memory alleine oder mit einem Partner. II Arbeitsblätter aus dem Seehundheft Arbeitsauftrag 1 blau: Steckbrief: Name des Tieres: Größe: Lebensraum: Merkmale: Das ist mir noch aufgefallen: Bild: 12 Arbeitsauftrag 1 rot: Steckbrief Name des Tieres: Größe: Lebensraum: Nahrung: Merkmale: Das ist mir noch aufgefallen: (Bild siehe oben) Arbeitsauftrag 2 rot: Lückentext Nahrungskette Dass eine Kuh Gras frisst, weiß jeder. Dies ist ein ganz einfaches Beispiel für etwas, das in der Ökologie als „Nahrungskette bezeichnet wird. Wie die Glieder einer Kette sind Tiere von anderen Tierarten oder Pflanzen abhängig, um sich ernähren zu können. In unserem Beispiel hat die Kette nur zwei Glieder: Gras – Kuh. Doch oft sind viel länger. Nehmen wir als Beispiel den Seehund. Der Seehund frisst, Fische fressen_,fressen Kleinkrebse, fressen Algen. Dieses Beispiel hat fünf_. Wenn eines der Glieder fehlt, funktioniert die ganzenicht mehr, wie bei einer Halskette, die zerrissen ist. 13 Arbeitsauftrag 2 blau: Die Nahrungskette im Wattenmeer 1. Benenne die Lebewesen! 2. Zeichne den Pfeil - wer frisst wen? Nahrungspyramide als Puzzle geschnitten: Arbeitsauftrag rot: 1. Welches Tier ist an der Spitze? 2. Was bedeutet das für dieses Tier? 14 Arbeitsauftrag 3 blau: Arbeitsauftrag 4 rot: Informationstext: Das Seehundjahr Seehunde sind die einzigen Säugetiere, die ständig im Wattenmeer leben. Im Juni oder Juli bringen sie ihre Jungen zur Welt. Nach der Geburt saugen die Jungen 4-6 Wochen bei ihrer Mutter. Da die Jungen bei der saugen, gehört der Seehund zu den Säugetieren. Ihre Paarungszeit beginnt Ende Juli und geht bis September. Danach dauert es ungefähr noch 10 Monate bis wieder ein Junges geboren wird. Diese Zeit nennen wir Tragzeit. 1. Beschrifte den Jahreszyklus! (siehe unten ohne Legende) 2. Wie viele Tage (ungefähr) im Jahr kannst du Seehundmütter sehen, die ihre Jungen säugen? 3. Wie oft bekommt ein Seehund in einem Jahr Junge? Arbeitsauftrag 4 blau: 15 Geburtszeit (blau) von Ende Juni bis Ende Juli Säugezeit (gelb) von Ende Juni bis Ende August Paarungszeit (grün) Von Ende Juli bis Anfang September Tragzeit (rot) Von Mitte September bis Ende Juli Arbeitsauftrag 5 rot: Von der Geburt zum Heuler EU 16 Stuhlkreis Im Frühsommer also zu Beginn der Sommerferien kommen die kleinen Seehunde zur Welt. Eine Seehundkuh kann im Jahr ein Baby bekommen. Es wird auf der Sandbank geboren. Die Jungen können nur auf der Sandbank bei der Mutter Milch saugen. Da sie bei der Mutter Milch saugen, gehören die Seehunde zu den Säugetieren. Bei stürmischem Wetter oder bei Störungen durch Menschen, können die Jungen von ihren Müttern getrennt werden. Wird der Heuler gefunden, kann er in die Seehund-Aufzucht-Station gebracht werden. Lösungswort von Aufgabe 5: Arbeitsauftrag 5 blau: Bilder siehe oben Lösungswort von Aufgabe 5: 17