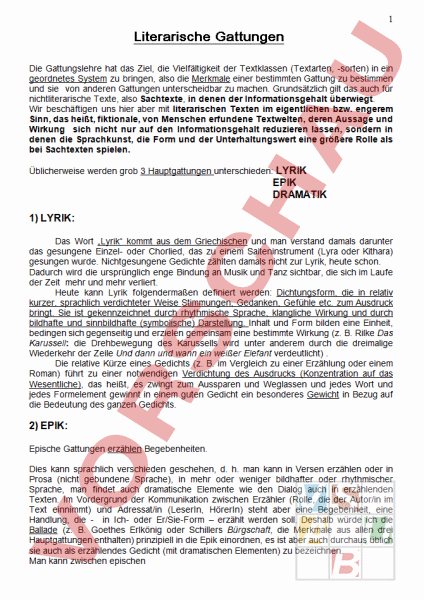Arbeitsblatt: Literarische Gattungen
Material-Details
Die Grundformen Lyrik, Epik und Dramatik werden erklärt.
Deutsch
Leseförderung / Literatur
9. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
32279
2730
58
09.01.2009
Autor/in
Martina Frick
Land: Österreich
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
1 Literarische Gattungen Die Gattungslehre hat das Ziel, die Vielfältigkeit der Textklassen (Textarten, -sorten) in ein geordnetes System zu bringen, also die Merkmale einer bestimmten Gattung zu bestimmen und sie von anderen Gattungen unterscheidbar zu machen. Grundsätzlich gilt das auch für nichtliterarische Texte, also Sachtexte, in denen der Informationsgehalt überwiegt. Wir beschäftigen uns hier aber mit literarischen Texten im eigentlichen bzw. engerem Sinn, das heißt, fiktionale, von Menschen erfundene Textwelten, deren Aussage und Wirkung sich nicht nur auf den Informationsgehalt reduzieren lassen, sondern in denen die Sprachkunst, die Form und der Unterhaltungswert eine größere Rolle als bei Sachtexten spielen. Üblicherweise werden grob 3 Hauptgattungen unterschieden: LYRIK EPIK DRAMATIK 1) LYRIK: Das Wort „Lyrik kommt aus dem Griechischen und man verstand damals darunter das gesungene Einzel- oder Chorlied, das zu einem Saiteninstrument (Lyra oder Kithara) gesungen wurde. Nichtgesungene Gedichte zählten damals nicht zur Lyrik, heute schon. Dadurch wird die ursprünglich enge Bindung an Musik und Tanz sichtbar, die sich im Laufe der Zeit mehr und mehr verliert. Heute kann Lyrik folgendermaßen definiert werden: Dichtungsform, die in relativ kurzer, sprachlich verdichteter Weise Stimmungen, Gedanken, Gefühle etc. zum Ausdruck bringt. Sie ist gekennzeichnet durch rhythmische Sprache, klangliche Wirkung und durch bildhafte und sinnbildhafte (symbolische) Darstellung. Inhalt und Form bilden eine Einheit, bedingen sich gegenseitig und erzielen gemeinsam eine bestimmte Wirkung (z. B. Rilke Das Karussell: die Drehbewegung des Karussells wird unter anderem durch die dreimalige Wiederkehr der Zeile Und dann und wann ein weißer Elefant verdeutlicht) Die relative Kürze eines Gedichts (z. B. im Vergleich zu einer Erzählung oder einem Roman) führt zu einer notwendigen Verdichtung des Ausdrucks (Konzentration auf das Wesentliche), das heißt, es zwingt zum Aussparen und Weglassen und jedes Wort und jedes Formelement gewinnt in einem guten Gedicht ein besonderes Gewicht in Bezug auf die Bedeutung des ganzen Gedichts. 2) EPIK: Epische Gattungen erzählen Begebenheiten. Dies kann sprachlich verschieden geschehen, d. h. man kann in Versen erzählen oder in Prosa (nicht gebundene Sprache), in mehr oder weniger bildhafter oder rhythmischer Sprache, man findet auch dramatische Elemente wie den Dialog auch in erzählenden Texten. Im Vordergrund der Kommunikation zwischen Erzähler (Rolle, die der Autor/in im Text einnimmt) und Adressat/in (LeserIn, HörerIn) steht aber eine Begebenheit, eine Handlung, die in Ich- oder Er/Sie-Form – erzählt werden soll. Deshalb würde ich die Ballade (z. B. Goethes Erlkönig oder Schillers Bürgschaft, die Merkmale aus allen drei Hauptgattungen enthalten) prinzipiell in die Epik einordnen, es ist aber auch durchaus üblich sie auch als erzählendes Gedicht (mit dramatischen Elementen) zu bezeichnen. Man kann zwischen epischen 2 Kleinformen (Fabel, Gleichnis/Parabel, Märchen, Sage, Legende, Kurzgeschichte, Kalendergeschichte, Erzählung, Novelle, Ballade .) und Großformen (Epos, Roman) unterscheiden. Diese unterscheiden sich wiederum untereinander durch Umfang, Inhalt, (Bau)form und Sprache. Kleinformen konzentrieren sich auf einen Handlungsstrang, während die Handlung in den Großformen oft sehr umfangreich und mehrsträngig erzählt wird. Epos und Roman unterscheiden sich wie folgt: Das Epos existierte geschichtlich bereits früher als der Roman, außerdem wird es in Versen erzählt und inhaltlich geht es um Götter und Helden, Kampf und Untergang von Reichen und Kulturen. Sie wurden ursprünglich auch mündlich vorgetragen. Beispiele dafür wären die aus der griechischen Antike stammenden Epen von Homer (Ilias, Odyssee, ca. 800 v. Chr.) oder im Mittelalter Heldenepen wie das Nibelungenlied (um 1200), höfische Epen wie Wolfram von Eschenbachs Parzival (um 1200), Gottfried von Straßburgs Tristan und Isolt (Tristan und Isolde), Hartmann von Aues Erec oder Iwein, die sagenhafte und historische Helden oder die höfisch-ritterliche Welt in einer oft sehr vielsträngigen Handlung darstellen. Aber auch bis ins 19. und 20. Jahrhundert wird die Form des Epos von Autoren wie Klopstock (Messias, 1748), Goethe (Hermann und Dorothea, 1797), Conrad Ferdinand Meyer (Huttens letzte Tage) oder Gerhart Hauptmann (Till Eulenspiegel, 1927) vereinzelt wiederbelebt. An sich löst jedoch geschichtlich der Roman das Epos ab und ist heute die vorherrschende literarische Form. Im Gegensatz zum Epos, das mehr die Geschichte oder die Werte einer Gemeinschaft, einer ganzen Gesellschaft beispielhaft darstellen will, rückt der Roman ca. ab dem 16. Jahrhundert, besonders aber in der bürgerlichen Aufklärung den Einzelnen, das sogenannte Individuum und dessen Erlebnisse mehr in den Vordergrund Berühmte frühe Romane der europäischen Literatur: Matteo Alemán Guzmán de Alfarache oder Pícaro genannt (daher der Ausdruck Pikaroroman, was soviel heißt wie Schelmenroman), 1559 Ritterromane: Garci Ordoñez de Montalvo Amadis de Gaula, 1492, begründete die Gattung des sogenannten Amadisromans. Miguel de Cervantes Don Quichote (1605), der bereits komische und parodistische Elemente enthält. Abenteuerromane: Grimmelshausen Simplizissimus, 1669 ff. Daniel Defoe Robinson Crusoe, 1719 (im Anschluss daran entstehen viele sog. Robinsonaden) etc. Bürgerliche Hauptfiguren prägen ab dem 18. Jahrhundert den Roman: Prägende Vorbilder: Christoph Martin Wieland: Agathon (Bildungs- oder Entwicklungsroman) Johann Wolfgang Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre. - -) Wilhelm Meisters Wanderjahre. (- -) 3 Bis heute entwickelte sich der Roman, der sich besonders ab dem 19. Jahrhundert in vielen Spielarten entfaltet hat – wenn auch in wiederum geänderter Form und Thematik – zur vorherrschenden Gattung auf dem Markt. 3. DRAMATIK: Jedes Drama ist dazu bestimmt, unmittelbar dargestellt, vor den Augen des Publikums aufgeführt zu werden (auch wenn man es unter Umständen nur liest). Die Handlung, das Geschehen wird optisch, akustisch, sprachlich und gestisch vermittelt. Die Figuren werden nicht (wie in der Epik von einem Erzähler) beschrieben, sondern charakterisieren sich selbst durch ihr unmittelbares Autreten und Handeln sowie durch den Inhalt und die Art ihrer Sprache. Als sprachliche Kommunikation kommt hauptsächlich der Dialog (Gespräch zwischen zweien oder mehreren, aber auch der Monolog (Selbstgespräch) zum Einsatz. Was beim Roman die Kapitel (Abschnitte) sind, nennt man in einem Drama Akte (die jeweils aus mehreren Szenen Auftritten bestehen). Mit der Zeit wird dieser strenge, geschlossener Aufbau (meist 3 oder 5 Akte) zugunsten offenerer Formen aufgegeben, die oft keine Akteinteilung mehr enthalten, sondern oft nur Szenen(bilder) aneinander reihen. Auch die Vorherrschaft der äußeren Handlung, der Aktion entwickelt sich im modernen Drama oft zugunsten der Konversation oder einer inneren Handlung. In einem traditionell aufgebauten Drama haben die Akte folgende Funktion: 1. Akt: Exposition (Vorstellen der Figuren und der Ausgangssituation, -konflikt) 2. Akt: steigende Handlung; ein Ereignis, das den Konflikt in eine bestimmte Richtung beschleunigt oder sich entfalten lässt, tritt ein. 3. Akt: Höhepunkt der Handlung und Spannung; Wendepunkt, der der Handlung den Weg in eine Lösung (Komödie) oder in die Katastrophe (Tragödie) weist. 4. Akt: fallende Handlung mit Ereignis, das den Ausgang (gut oder schlecht) verzögert ( retardierendes Moment). Der Zuschauer kann noch einmal hoffen, dass der Konflikt sich löst oder das gute Ende wird durch ein Hindernis verzögert. 5. Akt: Lösung des Konflikts (Komödie) in der Tragödie: Tod des Helden; Im Schauspiel überlebt der Held, ist aber oft (seelisch) zerbrochen. Bertolt Brecht begründet dann im 20. Jahrhundert ein Drama mit epischen (erzählenden) Elementen, das er episches Theater nennt. Dies macht wiederum die Veränderung der Hauptgattungen im Laufe der Geschichte deutlich sowie die Notwendigkeit sichtbar, die Begriffe für eine bestimmte Zeit oder Epoche konkret und neu zu bestimmen. Was jeweils konkret unter diesen Begriffen verstanden wird, hat sich im Laufe der (Literatur)geschichte verändert, doch können Lyrik, Epik und Dramatik als drei grundsätzlich mögliche Ausdrucksformen von literarischer Darstellung gelten. 4 LYRIK Um über Gedichte und deren Wirkung sprechen zu können, sie interpretieren zu können, brauchen wir bestimmte Fachausdrücke, die uns dabei helfen. Siehe dazu ergänzend auch das Kapitel „Lyrik in unserem Sprachbuch Sprachräume, Band 1. Strophen und Verse: Gedichtteile, die sich auch optisch durch Leerräume von anderen Passagen abgrenzen lassen, nennt man Strophen (wiederum: Bezug zur Liedform). Die Zeilen einer Strophe heißen Verse. Strophen können regelmäßig gebaut sein, d. h. die Anzahl der Verse ist in allen Strophen gleich (z. B. 3 vierzeilige Strophen), oder sie weisen einen unregelmäßigen Aufbau auf, d. h. unterschiedliche Versanzahl in jeder Strophe. Aus der Kombination solcher Merkmale können sich bestimmte Gedichtformen ableiten. Z. B. besteht ein Sonett aus zwei vierzeiligen Strophen und zwei Dreizeilern (zusammen mit anderen typischen Merkmalen). Vers: Versfuß/Metrum Bezogen auf die deutsche Sprache versteht man darunter eine bestimmte Kombination von betonten und unbetonten Silben (Hebungen und Senkungen). Die am häufigsten verwendeten Metren (Versfüße) sind: a) zweisilbige: steigend: der Jambus: x (unbetonte/betonte Silbe – letztere auch mit Akzent darstellbar) Bsp.: Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde! (Goethe) fallend: der Trochäus: x betont/unbetont) Bsp.: Sah ein Knab ein Röslein stehn (.) – Goethe Heidenröslein b) dreisilbige: steigend: der Anapäst: x (unbetont/unbetont/betont) Bsp.: Wenn die Grasblü-te stäubt von der winzi-gen Spindel (Elisabeth Langgässer: Panische Stunde) fallend: der Daktylus: x (betont/unbetont/unbetont) – „Walzertakt Herz, nun so alt und noch immer nicht klug (.) (Fr. Rückert: Herbslieder II – Herbsthauch) Am Versbeginn und –ende herrscht relative Freiheit (d. h. das Metrum muss nicht vollständig sein). Oft gibt es so etwas wie einen Auftakt am Anfang. Je nachdem, wie viele Hebungen in einer Verszeile vorkommen, spricht man z. B. von einem sechshebigen Jambus, d. h., dass sich der Jambus als Versmaß in einer Zeile sechsmal wiederholt bzw. dass 6 Hebungen vorhanden sind. Bsp.: Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein: (.) Andreas Gryphius Je nachdem, ob die Verszeile auf eine betonte oder unbetonte Silbe endet, sprechen wir von männlichem (stumpfem) oder weiblichem (klingendem) Versausgang. Bei Gryphius handelt es sich in jeder Zeile um einen sechshebigen Jambus, jedoch endet der erste Vers mit einer unbetonten Silbe (Erden), also weiblich, der zweite Vers mit einer betonten Silbe, also männlich. Hierbei handelt es sich um eine Art „mathematischer Betrachtung der Verszeile, d. h. nicht, dass ein exaktes Betonen von Hebungen sinnvolles und rhythmisches Lesen erlaubt, sondern führt eher ins Leiern. Dieses hängt auch vom Wort- und Satzsinn ab. Das Versmaß und dessen Abfolge erlaubt uns, das Gerippe eines Gedichts, seine Grundstruktur zu erkennen. 5 Rhythmus Zusammenhang zwischen Sinn und Satz Von besonderer Bedeutung für den Rhythmus eines Gedichts ist das Enjambement oder der Zeilensprung. Davon spricht man, wenn der Satz (Grammatik!) nicht mit dem Versende zusammenfällt, sondern wenn er darüber hinausgeht. Im folgenden Beispiel handelt es sich um einen Satz, der sich über 4 Verse zieht. Bsp.: Einer wird den Ball aus der Hand der furchtbar Spielenden nehmen. Nelly Sachs Einer wird den Ball Reime (Gleichklang von Vokalen und Konsonanten von dem Vokal der letzten betonten Silbe an) Grundsätzlich kann man die Reime nach ihrer Stellung im Vers unterscheiden: 1) Anfangsreim (Alliteration, Stabreim) 2) Binnenreim 3) Endreim ad) 1) Anfangsreim: Reim am Versbeginn; die ersten Wörter in zwei Zeilen reimen; Bsp.: Herz, prich! rich! sich! scherz, smerz, hier dringt . (.) Oswald von Wolkenstein Bsp.: Ein Laub, das grunt und falbt geschwind. Ein Staub, den leicht vertreibt der Wind (.) ad) 2) Binnenreim: Reimbindung zweier Wörter innerhalb einer Verszeile Bsp.: Brunnen-Mund, du gebender, du Mund, der unerschöpflich Eines, Reines spricht (.) aus: Rilke, Sonette an Orpheus ad) 3) Endreim: Gleichklang zweier oder mehrerer Verse von letzter Hebung an; seit Mitte des 18. Jahrhunderts gilt diese Form als Reim im eigentlichen Sinn, so wie wir auch heute das Wort verstehen würden. Je nachdem, ob sich der Reim auf eine Hebung beschränkt oder ob er sich auf die der letzten Hebung folgende Senkung ausdehnt, sprechen wir – wie bereits erwähnt – von stumpfen oder klingenden Reimen. Die wichtigsten (End)reimarten sind: aabb Paarreim abab Kreuzreim abba umarmender Reim abcabc verschränkter Reim (erweiterter Kreuzreim) aabccb Schweifreim ababcbcb Kettenreim Bsp.: b a Steig mit Eifer in die Lüfte Fliege, fliege kleiner Drache Schwing dich, kleine blaue Sache Über unsre Häusergrüfte umarmender Reim 6 Bsp.: a b Steig mit Eifer in die Lüfte Über unsre Häusergrüfte Fliege, fliege kleiner Drache Schwing dich, kleine blaue Sache Paarreim Bsp.: b b Steig mit Eifer in die Lüfte Fliege, fliege kleiner Drache Über unsre Häusergrüfte Schwing dich, kleine blaue Sache umarmender Reim Außerdem unterscheidet man reine und unreine Reime: unreiner Reim: annähernder Gleichklang von Reimsilben z. B. grüßen – sprießen; Geläute – begleite; reiner Reim: vollständiger Gleichklang der Reimsilben z. B.: Maus – Haus; Seite – Weite, Wüste – Büste; Klänge und Klangfolgen: Neben dem Reim bewirken auch die bewusste Verwendung bestimmter Vokale und Konsonanten eine bestimmte Klangwirkung eines Gedichts: Bsp.: Georg Britting Fröhlicher Regen Wie der Regen tropft, Regen tropft, an die Scheiben klopft! Jeder Strauch ist nass bezopft. Wie der Regen springt! In den Blättern singt! Eine Silberuhr! Durch das Gras hin läuft, Wie eine Schneckenspur, Ein Streifen weiß beträuft. äu/ei Das stürmische Wasser schießt in die Regentonne, Dass die überfließt, Und in breitem Schwall Auf dem Weg bekiest Stürz Fall um Fall. (s und sch-Laut) (.) Übungsbeispiele: Bestimme das Versmaß der folgenden Ausschnitte: entfernt versinkt ein Boot im Meer Liedanfänge (Jambus oder Trochäus?) die Lerche zwitschert in der Luft Im Walde ist schon heller Tag . verlegen hüpft ein Floh vom Tisch Wir fahren übers weite Meer . der Maulwurf hört sie nicht, er schläft Alle Vöglein sind schon da . (.) Horch, was kommt von draußen rein . Gedichte werden auch häufig in besonderem Maße von Bildhaftigkeit in der Sprache (Bilder, Metaphern, Vergleiche, Chiffren), Wiederholung als Stilmittel oder auch anderen rhetorischen Mitteln geprägt. 7