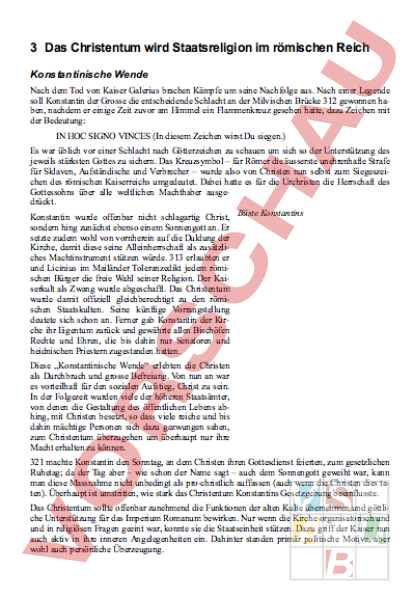Arbeitsblatt: Frühes Christentum 3
Material-Details
Das frühe Christentum 3/3: Staatsreligion im Röm. Reich. Informationen zum Thema, Leseauftrag.
Geschichte
Altertum
9. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
32503
850
9
12.01.2009
Autor/in
Hurtado Daniel
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
3 Das Christentum wird Staatsreligion im römischen Reich Konstantinische Wende Nach dem Tod von Kaiser Galerius brachen Kämpfe um seine Nachfolge aus. Nach einer Legende soll Konstantin der Grosse die entscheidende Schlacht an der Milvischen Brücke 312 gewonnen haben, nachdem er einige Zeit zuvor am Himmel ein Flammenkreuz gesehen hatte, dazu Zeichen mit der Bedeutung: IN HOC SIGNO VINCES (In diesem Zeichen wirst Du siegen.) Es war üblich vor einer Schlacht nach Götterzeichen zu schauen um sich so der Unterstützung des jeweils stärksten Gottes zu sichern. Das Kreuzsymbol – für Römer die äusserste unehrenhafte Strafe für Sklaven, Aufständische und Verbrecher – wurde also von Christen nun selbst zum Siegeszeichen des römischen Kaiserreichs umgedeutet. Dabei hatte es für die Urchristen die Herrschaft des Gottessohns über alle weltlichen Machthaber ausgedrückt. Konstantin wurde offenbar nicht schlagartig Christ, Büste Konstantins sondern hing zunächst ebenso einem Sonnengott an. Er setzte zudem wohl von vornherein auf die Duldung der Kirche, damit diese seine Alleinherrschaft als zusätzliches Machtinstrument stützen würde. 313 erlaubten er und Licinius im Mailänder Toleranzedikt jedem römischen Bürger die freie Wahl seiner Religion. Der Kaiserkult als Zwang wurde abgeschafft. Das Christentum wurde damit offiziell gleichberechtigt zu den römischen Staatskulten. Seine künftige Vorrangstellung deutete sich schon an. Ferner gab Konstantin der Kirche ihr Eigentum zurück und gewährte allen Bischöfen Rechte und Ehren, die bis dahin nur Senatoren und heidnischen Priestern zugestanden hatten. Diese „Konstantinische Wende erlebten die Christen als Durchbruch und grosse Befreiung. Von nun an war es vorteilhaft für den sozialen Aufstieg, Christ zu sein. In der Folgezeit wurden viele der höheren Staatsämter, von denen die Gestaltung des öffentlichen Lebens abhing, mit Christen besetzt, so dass viele reiche und bis dahin mächtige Personen sich dazu gezwungen sahen, zum Christentum überzugehen um überhaupt nur ihre Macht erhalten zu können. 321 machte Konstantin den Sonntag, an dem Christen ihren Gottesdienst feierten, zum gesetzlichen Ruhetag; da der Tag aber – wie schon der Name sagt – auch dem Sonnengott geweiht war, kann man diese Massnahme nicht unbedingt als pro-christlich auffassen (auch wenn die Christen dies taten). Überhaupt ist umstritten, wie stark das Christentum Konstantins Gesetzgebung beeinflusste. Das Christentum sollte offenbar zunehmend die Funktionen der alten Kulte übernehmen und göttliche Unterstützung für das Imperium Romanum bewirken. Nur wenn die Kirche organisatorisch und und in religiösen Fragen geeint war, konnte sie die Staatseinheit stützen. Dazu griff der Kaiser nun auch aktiv in ihre inneren Angelegenheiten ein. Dahinter standen primär politische Motive, aber wohl auch persönliche Überzeugung. Entwicklung zur Staatsreligion Konstantin wurde nach seinem Tod 337 unter die Staatsgötter aufgenommen und kann daher kaum als „Christ im engeren Sinne, sondern eher als „Anhänger des Christengottes bezeichnet werden, auch wenn er sich auf dem Sterbebett noch taufen liess. Er hatte seine Söhne christlich erziehen lassen: Unter diesen führte besonders Constantius II. (337-361) eine entschlossene Christianisierungspolitik durch. Noch mehr als das Römische Reich sich an die Christen anpasste, begann die Kirche, sich seinen politischen Interessen anzupassen. Das christliche Kreuzsymbol wurde nun auf Heeresstandarten und Staatsmünzen sichtbar. Bischöfe zogen mit in die Schlacht und segneten die gleichen Waffen, mit denen Christen früher ermordet wurden. Damit waren alte Grundsätze wie „Wer das Schwert ergreift, soll durch das Schwert umkommen urplötzlich aus dem Wertekontext der Christen verschwunden, nun da sie die vorherrschende Macht geworden waren und selbst über die Waffengewalt verfügten. Nicht wenige erlagen den Verlockungen, die die neu gewonnene Macht mit sich brachte. Immer mehr Kirchen wurden gebaut; die Gottesdienste darin wurden zu prunkvollen Zeremonien, was wiederum dem früheren Grundsatz widersprach, man könne nicht dem christlichen Gott und dem Mammon zugleich dienen. Manch ein Christ kritisierte diese Veränderungen, doch waren sie nicht aufzuhalten. Die römischen Staatstempel dagegen zerfielen; dies war nun staatlich gewollt. Konstantin hatte bereits sehr vereinzelt Massnahmen gegen „heidnische Kulte verfügt; unter Constantius II. kam es bereits zu Stürmen auf heidnische Tempel. Aus den früher Verfolgten wurden Verfolger. Unter Kaiser Julian Apostata (361–363) kam es kurzzeitig zu einem Versuch der Wiederbelebung nichtchristlicher Kulte. Das Verbot aller nichtchristlichen Kulte unter Theodosius I. machte dann 380 bzw. 391 der früher vorherrschenden Religionsfreiheit ein Ende. Der alte römische Staatskult konnte sich unter dem Druck der christlichen Verfolger nur noch bis ins 6., teils sogar bis ins 7. Jahrhundert im oströmischen Reich halten. Es geriet immer mehr in die Defensive, verlor Anhänger und büsste zunehmend an innerer Kraft ein.