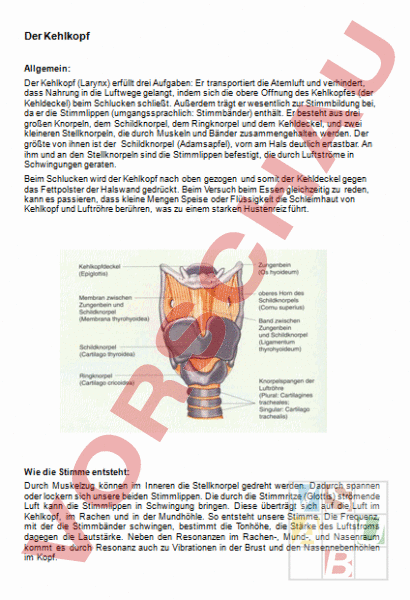Arbeitsblatt: Kehlkopf
Material-Details
Aufgaben und Anatomie des Kehlkopfes
Stimmbildung
Absenkung des Kehlkopfes
Biologie
Anatomie / Physiologie
9. Schuljahr
6 Seiten
Statistik
33333
1529
14
23.01.2009
Autor/in
Christine Baumgartner
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Der Kehlkopf Allgemein: Der Kehlkopf (Larynx) erfüllt drei Aufgaben: Er transportiert die Atemluft und verhindert, dass Nahrung in die Luftwege gelangt, indem sich die obere Öffnung des Kehlkopfes (der Kehldeckel) beim Schlucken schließt. Außerdem trägt er wesentlich zur Stimmbildung bei, da er die Stimmlippen (umgangssprachlich: Stimmbänder) enthält. Er besteht aus drei großen Knorpeln, dem Schildknorpel, dem Ringknorpel und dem Kehldeckel, und zwei kleineren Stellknorpeln, die durch Muskeln und Bänder zusammengehalten werden. Der größte von ihnen ist der Schildknorpel (Adamsapfel), vorn am Hals deutlich ertastbar. An ihm und an den Stellknorpeln sind die Stimmlippen befestigt, die durch Luftströme in Schwingungen geraten. Beim Schlucken wird der Kehlkopf nach oben gezogen und somit der Kehldeckel gegen das Fettpolster der Halswand gedrückt. Beim Versuch beim Essen gleichzeitig zu reden, kann es passieren, dass kleine Mengen Speise oder Flüssigkeit die Schleimhaut von Kehlkopf und Luftröhre berühren, was zu einem starken Hustenreiz führt. Wie die Stimme entsteht: Durch Muskelzug können im Inneren die Stellknorpel gedreht werden. Dadurch spannen oder lockern sich unsere beiden Stimmlippen. Die durch die Stimmritze (Glottis) strömende Luft kann die Stimmlippen in Schwingung bringen. Diese überträgt sich auf die Luft im Kehlkopf, im Rachen und in der Mundhöhle. So entsteht unsere Stimme. Die Frequenz, mit der die Stimmbänder schwingen, bestimmt die Tonhöhe, die Stärke des Luftstroms dagegen die Lautstärke. Neben den Resonanzen im Rachen-, Mund-, und Nasenraum kommt es durch Resonanz auch zu Vibrationen in der Brust und den Nasennebenhöhlen im Kopf. Respirationsstellung: Bei jedem Atemzug öffnen sich die Stimmlippen, und die Stimmritze wird sichtbar. Die Stellknorpel werden so gedreht, dass die Stimmlippen sich am hinteren Teil voneinander entfernen. (Siehe Grafik) Die Phonationsstellung: Beim Sprechen oder Singen bewegen sich die Stimmlippen aufeinander zu, bis die Stimmritze fast geschlossen ist. In dieser Position sind die Stimmlippen gespannt, und die aus der Lunge strömende Luft bläst gegen sie. Der Effekt: Die Stimmlippen geraten in Schwingung, wobei sie sich in kurzer Folge öffnen und schließen. Wie hoch oder tief dieser Laut ist, hängt von der Spannung der Stimmbänder ab, und von der Lage des Kehlkopfes, den wir mittles bestimmter Muskeln höher oder tiefer stellen können. Wenn die Stimmlippen wachsen, länger und dicker werden, ändert sich der Ton der Stimme. Genau das passiert in der Pubertät. Die Stimme von Jungen sinkt um etwa eine Oktave, die von Mädchen um eine Terz. Dass wir willentlich mit hoher oder tiefer Stimme sprechen können, verdanken wir den inneren Muskeln in unserem Kehlkopf. Bei tiefen Tönen sind die Stimmlippen zum Beispiel lang und wenig gespannt, bei hohen hingegen kurz und gespannt. Die Absenkung des Kehlkopfes: Wenn man die Lage des Kehlkopfes beim Affen und beim Menschen vergleicht stellt man fest, dass er beim Menschen abgesunken ist, und er tiefer im Hals liegt als beim Affen. Durch das Absinken des Kehlkopfes ist im Schlund mehr Raum entstanden was ein breiteres Spektrum von Lauten und bessere Artikulationsmöglichkeiten ermöglicht. Diese Absenkung war eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung unserer heutigen Sprache. Aus der Wölbung des Schädels schloss man, der Kehlkopf habe bei den Neandertalern höher gelegen, und der gesamte Stimmapparat sei affenähnlicher gewesen, so dass sie nicht das ganze menschliche Lautspektrum hervorbringen konnten. Lernkontolle Der Kehlkopf: 1.a) Was sind die Aufgaben des Kehlkopfes? b) Was würde deiner Meinung nach passieren, wenn dein Kehldeckel, währendem du ein Schluck Kaffee trinkst, seine Dienste verweigern würde? . 2.Welche Faktoren beeinflussen die Höhe resp. die Tiefe unserer Stimme? . 3.Was ist der Grund warum ein Schimpanse nie ein Kindervers aufsagen, oder aber „Frère Jacques für uns singen? 4.Warum entsteht nicht jedes Mal ein Ton, wenn wir ein- oder ausatmen? Die Luft strömt ja genau gleich an den Stimmlippen vorbei? . Lösungen Lernkontrolle Der Kehlkopf 1.a) Der Kehlkopf transportiert Luft verschliesst die Luftröhre gegen die Speiseröhre während des Schluckaktes und trägt zur Stimmbildung bei. b) Der Kaffee würde in die Luftröhre gelangen, was unweigerlich zu einem starken Hustenreiz führen würde, um das Getränk wieder nach draussen zu befördern. K1: Daten und Fakten können direkt aus dem Text entnommen werden 2. Die Länge, Dicke und Spannung der Stimmlippen, sowie die Lage des Kehlkopfes bestimmen die Höhe und Tiefe unserer Stimme. K2: Ein Sachverhalt in eigenen Worten erklären. 3. Die Schimpansen haben eine andere Lage des Kehlkopfes als der Mensch. Ihr Kehlkopf liegt wesentlich höher im Hals, und schränkt sie somit ein, in Bezug auf Artikulation und Lautäusserungen. Sie haben nicht so vielfältige Möglichkeiten wie wir, Laute hervorzubringen. 3: Kenntnisse auf konkrete, neue Situationen übertragen. 4. Die Stimmlippen müssen schwingen damit ein Ton ertönt. Bei der Atemstellung sind die Stimmlippen weit geöffnet und die Luft strömt an ihnen vorbei, ohne dass sie die Lippen in Schwingung versetzt. Bei der Lautbildung sind die Stimmlippen fast geschlossen und beginnen zu vibrieren. 5: Ableitung abstrakter Beziehungen Der Kehlkopf Einleitung Der Kehlkopf ist ein knorpeliges Gebilde, das die Luftröhre von der Speiseröhre beim Schlucken trennen kann. Er trägt wesentlich zur Stimmbildung bei, da er die Stimmlippen enthält. Persönlicher Lektionsverlauf In den folgenden 45 Minuten wirst du dich mit deinem Thema näher beschäftigen. Dazu wirst du den Text „ Der Kehlkopf durchlesen und dir die Zusammenhänge zu diesem Thema erarbeiten. Wenn du Fragen hast zu deinem Text, kannst du deine Klassenkameraden mit dem gleichen Thema in der Expertenrunde fragen. Am Schluss machst du dir ein paar Notizen, was du deinen anderen Mitschülern weitergeben willst über dein Thema. Detaillierter Ablauf: Zeit (Min) Auftrag Material 12 Übersicht erarbeiten: Lies den Text zur Theorie „ Der Kehlkopf, mach dir eine kurze Zusammenfassung zu den wichtigsten Punkten. Schau dir das Modell an und versuche es auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Text: Der Kehlkopf Modell: Kehlkopf 5 Selbstversuch: Lege deine Finger an deinen Kehlkopf und versuche einen Ton in einer mittleren Lage zu summen oder singen. Versuche nun den Ton höher oder tiefer zu summen. Beobachte was mit dem Kehlkopf geschieht. 8 Lernkontrolle: Beantworte schriftlich die Fragen auf dem Blatt. 10 Expertenrunde: Setze dich mit den andern Schüler, die dasselbe Unterthema haben wie du zusammen, und diskutiert noch allfällige Fragen mit ihnen. 10 Präsentationsvorbereitung: Überlege dir wir du dein Thema den anderen näher bringen möchtest. Das Vorstellen deines Themas, sollte nicht länger als 5 gehen. Ideen dazu findest du in der MiniDidaktik Arbeitsblatt: Lernkontrolle Mini-Didaktik Poster zum selber gestalten, Modell, Wandtafel, Folie Lernziel Ziel dieser Lektion ist, dass du die Funktion und den Bau des Kehlkopfes kennst, und das Prinzip der Lautbildung verstanden hast. Du kannst erklären, warum der Affe und der Mensch nicht dieselbe Sprache sprechen.