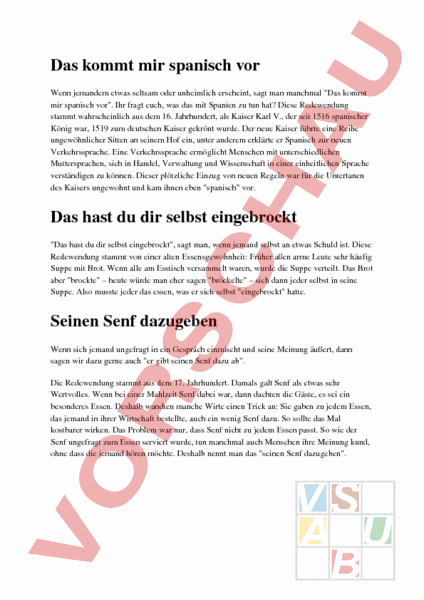Arbeitsblatt: Redensarten 1
Material-Details
Redensarten und ihre Erklärung
Deutsch
Anderes Thema
6. Schuljahr
8 Seiten
Statistik
36773
1220
24
16.03.2009
Autor/in
Beat Weber
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Das kommt mir spanisch vor Wenn jemandem etwas seltsam oder unheimlich erscheint, sagt man manchmal Das kommt mir spanisch vor. Ihr fragt euch, was das mit Spanien zu tun hat? Diese Redewendung stammt wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert, als Kaiser Karl V., der seit 1516 spanischer König war, 1519 zum deutschen Kaiser gekrönt wurde. Der neue Kaiser führte eine Reihe ungewöhnlicher Sitten an seinem Hof ein, unter anderem erklärte er Spanisch zur neuen Verkehrssprache. Eine Verkehrssprache ermöglicht Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen, sich in Handel, Verwaltung und Wissenschaft in einer einheitlichen Sprache verständigen zu können. Dieser plötzliche Einzug von neuen Regeln war für die Untertanen des Kaisers ungewohnt und kam ihnen eben spanisch vor. Das hast du dir selbst eingebrockt Das hast du dir selbst eingebrockt, sagt man, wenn jemand selbst an etwas Schuld ist. Diese Redewendung stammt von einer alten Essensgewohnheit: Früher aßen arme Leute sehr häufig Suppe mit Brot. Wenn alle am Esstisch versammelt waren, wurde die Suppe verteilt. Das Brot aber brockte – heute würde man eher sagen bröckelte – sich dann jeder selbst in seine Suppe. Also musste jeder das essen, was er sich selbst eingebrockt hatte. Seinen Senf dazugeben Wenn sich jemand ungefragt in ein Gespräch einmischt und seine Meinung äußert, dann sagen wir dazu gerne auch er gibt seinen Senf dazu ab. Die Redewendung stammt aus dem 17. Jahrhundert. Damals galt Senf als etwas sehr Wertvolles. Wenn bei einer Mahlzeit Senf dabei war, dann dachten die Gäste, es sei ein besonderes Essen. Deshalb wandten manche Wirte einen Trick an: Sie gaben zu jedem Essen, das jemand in ihrer Wirtschaft bestellte, auch ein wenig Senf dazu. So sollte das Mal kostbarer wirken. Das Problem war nur, dass Senf nicht zu jedem Essen passt. So wie der Senf ungefragt zum Essen serviert wurde, tun manchmal auch Menschen ihre Meinung kund, ohne dass die jemand hören möchte. Deshalb nennt man das seinen Senf dazugeben. Jemandem ist eine Laus über die Leber gelaufen Was ist dir denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Das fragt man jemanden, der schlechte Laune hat. Aber wie sollte denn die Laus überhaupt an seine Leber kommen und wieso hat seine Leber etwas mit seiner Laune zu tun? Früher dachten die Menschen, dass die Leber der Sitz der Gefühle ist. Deshalb sagte man Es ist ihm etwas über die Leber gelaufen, wenn jemand nicht gut drauf war. Später wurde aus etwas die Laus, die über die Leber läuft. Zum einen, weil sich so eine Alliteration ergibt: Das bedeutet, dass Wörter mit dem gleichen Buchstaben beginnen, also Laus und Leber. Zum anderen hat man die Laus gewählt, weil es ein winziges, unscheinbares Tier ist. Die Redewendung wird nämlich dann benutzt, wenn man glaubt, dass der andere nur wegen einer Nichtigkeit mies drauf ist. Kalte Füße bekommen Wenn sich jemand etwas vorgenommen hat und es dann doch nicht umsetzt, weil ihm nicht wohl bei der Sache ist, dann spricht man davon, dass er kalte Füße bekommt. Aber was hat ein Rückzieher mit kalten Füßen zu tun? Diese Redewendung kommt aus der Welt des Glücksspiels. Weil das Kartenspielen um Geld früher verboten war, zogen sich die Glücksspieler in düstere Keller zurück. Dort war es meist auch ziemlich kalt. Hatte nun einer der Spieler schlechte Karten und wollte aus dem Spiel aussteigen, dann nutzte er die Kälte im Keller als Ausrede: Ich habe so kalte Füße, ich gehe jetzt lieber. Und so wurde der Ausdruck Kalte Füße bekommen im Laufe der Zeit zu einer Redensart, wenn man sich aus einer unangenehmen Situation davon stehlen wollte. Im Stich lassen Lässt man jemanden im Stich, dann heißt das, man ist nicht für ihn da oder man lässt ihn mit seinen Problemen alleine. Aber warum nennt man das ganz selbstverständlich im Stich lassen. Was denn für ein Stich? Die Antwort finden wir im Mittelalter, denn aus dieser Zeit stammt diese Redewendung. Sie enstand bei den damaligen Ritterturnieren. Fiel ein Ritter während eines Turniers vom Pferd, dann konnte er alleine nicht mehr aufstehen. Seine Rüstung war viel zu schwer dafür. Eigentlich musste ihm dann sein Knappe wieder auf das Pferd hieven. War der aber zu faul, dann ließ er seinen Herrn im Stich und zwar im Stich des gegnerischen Ritters. Die Ritter kämpften mit Lanzen gegeneinander, jeder versuchte mit seiner Lanze, den Gegener zu stechen. Der gefallene Ritter konnte also leicht vom Gegner erstochen werden. Das nannte man damals im Stich. Schwedische Gardinen Sitzt jemand im Gefängnis, dann sagt man manchmal auch, er sitzt hinter schwedischen Gardinen. Aber was haben denn nun schwedische Gardinen mit Gefängnis zu tun? Ganz einfach: Der schwedische Stahl galt früher als besonders stabil. Deshalb wurden die Gitter vor den Gefängnisfenstern oft aus schwedischem Stahl gefertigt. Und so kam es, dass es hieß: der Gefangene sitzt hinter schwedischen Gardinen. Alles in Butter Die Momente, in denen einmal alles in Butter ist, wünscht sich doch jeder. Dann ist alles in Ordnung und keine Probleme sind in Sicht. In der Regel freut sich aber keiner, wenn er sich Butter zum Beispiel auf die Kleidung schmiert – woher stammt also diese Redewendung? Wie viele andere kommt auch diese Redewendung aus dem Mittelalter. Damals wurden teure Gläser aus Italien über die Alpen nach Deutschland transportiert. Blöderweise gingen die meisten davon – bei all dem Gewackel – schnell zu Bruch. Ein gewitzter Händler hatte schließlich den rettenden Einfall: Er legte die Gläser in Fässer und goss dann heiße, flüssige Butter darüber. Als die Butter abgekühlt und fest geworden war, waren damit auch die Gläser fixiert. Jetzt konnte ihnen das Gerumpel auf dem Wagen nichts mehr anhaben. Selbst wenn eines der Fässer von der Kutsche fiel, blieben die Gläser heil. Und so war eben alles in Butter! Das Handtuch werfen Bei manch einem Vokabeltest wollten bestimmt schon viele von euch das Handtuch werfen. Aber welches Handtuch eigentlich? Und was hat ein hingeworfenes Handtuch mit Aufgeben zu tun? Ganz einfach: die Redewendung kommt aus dem Boxsport. Damit nichts Ernstes passiert, wenn ein Boxer seinem Gegner entschieden unterlegen ist, gibt es ein Zeichen, dass signalisiert, dass der Boxer kapituliert. Und das ist na? Genau! Natürlich das hingeworfene Handtuch. Kurz bevor der Boxer k.o. geht, sollte sein Trainer das Handtuch werfen. In den 20er Jahren hat sich dieses Sprichwort für das Aufgeben im Sport durchgesetzt. Heute verwendet man es in fast allen Lebensbereichen. Sich mit fremden Federn schmücken Dass jemand sich mit fremden Federn schmückt, sagt man immer dann, wenn jemand die Verdienste von jemand anderem für seine eigenen ausgibt. Dazu gibt es eine Fabel von dem römischen Dichter Phaedrus. Eine Krähe sah auf dem Boden lauter herrliche Pfauenfedern liegen. Sie überlegte nicht lange und beschloss, ihr eigenes fades Gefieder ein bisschen aufzuhübschen. Sie steckte die schönen Pfauenfedern einfach zwischen ihr eigenes Gefieder. Stolz auf ihre neue Federpracht, begab sie sich mitten in eine Gruppe von Pfauen, um sie an der neu gewonnen Eleganz Anteil haben zu lassen. Aber ach, die fanden das so gar nicht lustig und stürzten sich auf die Krähe und rupften ihr nicht nur die fremden, sondern auch noch ziemlich viele eigene Federn aus. Als die rachsüchtigen Pfaue von der Krähe abließen, stand die Krähe gerupft und wesentlich armseliger als zuvor da. Und die Moral von der Geschicht: Mit fremden Federn schmückt man sich nicht. Jemandem einen Denkzettel verpassen „Erwin hat wieder heimlich deine Schokolade gegessen. „Na warte, dem verpass ich einen Denkzettel! Oha – da hat Erwin wohl nichts Gutes zu erwarten. Denn als Denkzettel bezeichnet man meist eine Strafe, die den Betroffenen zum Nachdenken bringen soll. Manchmal ist aber auch eine Lehre gemeint, die jemand aus einer unangenehmen Erfahrungen ziehen soll. Jemandem einen Denkzettel geben ist wieder mal eine Redewendung, die sich aus dem späten Mittelalter bis zu uns gerettet hat. Damals gab es auch schon so etwas wie gerichtliche Vorladungen, die so genannten „Gedenkzettel. Darauf war schriftlich der Termin vermerkt. Später bekamen dann Schüler an Klosterschulen einen „Schandzettel um den Hals gehängt, wenn sie etwas falsch gemacht hatten. Dieser „Denkzettel musste zum Teil mehrere Tage mit herumgetragen werden. So wurde man zum Gespött der Leute und hoffentlich von zukünftigen Fehltritten abgehalten. Jemandem einen Denkzettel verpassen „Erwin hat wieder heimlich deine Schokolade gegessen. „Na warte, dem verpass ich einen Denkzettel! Oha – da hat Erwin wohl nichts Gutes zu erwarten. Denn als Denkzettel bezeichnet man meist eine Strafe, die den Betroffenen zum Nachdenken bringen soll. Manchmal ist aber auch eine Lehre gemeint, die jemand aus einer unangenehmen Erfahrungen ziehen soll. Jemandem einen Denkzettel geben ist wieder mal eine Redewendung, die sich aus dem späten Mittelalter bis zu uns gerettet hat. Damals gab es auch schon so etwas wie gerichtliche Vorladungen, die so genannten „Gedenkzettel. Darauf war schriftlich der Termin vermerkt. Später bekamen dann Schüler an Klosterschulen einen „Schandzettel um den Hals gehängt, wenn sie etwas falsch gemacht hatten. Dieser „Denkzettel musste zum Teil mehrere Tage mit herumgetragen werden. So wurde man zum Gespött der Leute und hoffentlich von zukünftigen Fehltritten abgehalten. Sich auf den Schlips getreten fühlen Bernd hat heute wieder eine Laune. Ist ihm wohl jemand auf den Schlips getreten? Natürlich ist nicht wirklich jemand Bernd auf den Schlips getreten – wäre ja auch schwierig hin zu kommen. Mit Schlips ist nicht die Krawatte gemeint, sondern die Rockschöße, die Slips, wie sie im Niederdeutschen auch heißen. Rockschöße waren so längliche Zipfel an der Rückseite von Herrenjacken. Sie sind heute nicht mehr besonders in Mode. Vielleicht, weil man so leicht auf sie treten kann, wenn sie zu lange sind. Das ist natürlich ärgerlich, weil dann der Schlips dreckig wird. Und da lässt sich auch der Bogen zu der Redewendung auf den Schlips getreten ziehen. Denn jemand, der verärgert oder beleidigt ist, dem wurde auf den Schlips getreten. Man könnte auch sagen, ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen, aber das ist eine andere Geschichte. Alles für die Katz Gerade hab ich hier frisch geputzt! Jetzt lauft ihr einmal mit den schmutzigen Gummistiefeln drüber und alles war für die Katz! So oder so ähnlich habt ihr sicher schon mal einen Spruch von eurer Mama gehört. Unwillkürlich fragt man sich, was hat denn ein niedliches kleines Flauschekätzchen damit zu tun, wenn eine Arbeit umsonst verrichtet wurde? Umsonst – das ist das Stichwort für eine kleine Geschichte von Burkard Waldis, einem Fabelerzähler. Sie heißt Der Schmied und die Katze. Es war einmal ein Schmied, der hat ganz gute Arbeit geleistet und ließ sich von seinen Kunden immer das dafür bezahlen, was denen die Arbeit wert gewesen war. Die Kunden wiederum fanden das ganz praktisch, sie wollten nämlich eigentlich am liebsten gar nichts bezahlen. Also sagten sie einfach immer nur danke, wenn sie beim Schmied waren. Der blieb unbezahlt und wurde zunehmend griesgrämig, weil er immer umsonst arbeiten musste. Er nahm eine dicke alte Katze und band sie in seiner Werkstatt an. Und jedes Mal, wenn ihn ein Kunde mit einem Danke abspeiste, sagte er zur Katze: Katz, das gebe ich dir. Das Dumme für die Katze war, dass sie von den leeren Worten nicht leben konnte und deswegen verhungern musste. Seitdem heißt es, wenn eine Arbeit umsonst war: Das war alles für die Katz. Sich wie gerädert fühlen Sich müde, zerschlagen fühlen. Das Rädern meinte im Mittelalter eine grausame Art der Todesstrafe. Dabei wurde der Verbrecher auf einer Unterlage (manchmal ein Rad!) festgebunden. Dann wurden ihm (an den Füßen beginnend) die Gliedmaßen zerschlagen – meist mit einem großen Rad oder auch einem Hammer. Mitunter wurde der so Gepeinigte dann mit dem Rad auf einem Pfahl zur Schau gestellt. Nicht selten dauerte der Todeskampf dann noch mehrere Tage. Wer heute sagt: Ich fühle mich wie gerädert, übertreibt also ziemlich Wo drückt denn der Schuh? Meine Liebe, Sie sehen so traurig aus. Sagen sie mir, wo drückt der Schuh? – Diese Frage stammt nicht etwa von einem Schuhverkäufer, sondern von einem sorgenvollen Mitmenschen, der sich anbietet, die Sorgen der verehrten Dame anzuhören. Drückende Schuhe gleichsetzen mit Sorgen und Kummer? Wie geht denn das? So absonderlich ist der Vergleich gar nicht, wenn man daran denkt, wie es ist, neue Schuhe zu tragen. Sie sehen toll aus, sie glänzen und doch, gibt es da diese eine Stelle hinten an der Ferse, die sicher auf der zarten Haut eine Blase produzieren wird. Schon die alten Römer hatten dafür einen passenden Spruch parat, der übersetzt heißt: Niemand außer mir weiß, wo mich der Schuh drückt. Dieser Vergleich wird direkt auf die Sorgen übertragen. Nur ich weiß, welche Schuhstelle, äh, Sorge mich drückt. Gegen den Strich gehen Ich möchte gar nicht, dass mein Lehrer mich vor der ganzen Klasse lobt. Das geht mir gegen den Strich. Habt ihr eine Katze? Dann wisst ihr sicher auch, dass die Schmusetiger es gar nicht mögen, wenn man sie in der falschen Richtung streichelt. Zum Beispiel vom Schwanz zum Kopf. Denn dabei stellen sich die Haare struppig auf und müssen erst mal wieder glattgeleckt werden. Gegen den Strich nennt man das auch. Im übertragenen Sinn geht auch uns Menschen all das gegen den Strich, was uns nervt, aber nicht wirklich schlimm ist. Etwas ausbaden müssen „Du hast schon wieder deine Hausaufgaben nicht gemacht? Dann muss du das auch selbst ausbaden. Etwas „ausbaden müssen wir immer dann, wenn unser Verhalten unangenehme Folgen für uns hat. Oder wenn wir für etwas verantwortlich gemacht werden, was eigentlich jemand anders verbockt hat. Diese Redewendung geht auf einen alten Brauch zurück, der bis vor kürzer Zeit noch regelmäßig Anwendung fand: Die Menschen teilten sich das Badewasser. In Familien zum Beispiel dürfte als erstes der Vater, als Familienoberhaupt, ins saubere Wasser. Dann kamen, je nach Rangordnung, die anderen an die Reihe. Kennt ihr den braunen Rand, der manchmal nach dem Baden am Rand der Badewanne klebt? Dann stellt euch mal vor, wie braun der Rand wäre, nachdem viele andere Leute vor euch gebadet haben! Nicht sehr angenehm, die Vorstellung. Anschließend musste der Letzte auch noch das Wasser ausschütten und das Bad reinigen. Er hatte es also schlecht getroffen. Und genau darum geht es auch bei der Redewendung: Das Badewasser der anderen muss „ausgebadet und die schlechten Konsequenzen ertragen werden. Bahnhof verstehen Also, ich verstehe nur noch Bahnhof. – Man versteht Bahnhof, wenn man nichts mehr versteht. Werden zum Beispiel die mathematischen Gleichungen zu kompliziert, dann versteht die ganze Klasse: Bahnhof. Aber woher kommt der Ausdruck eigentlich? Entstanden ist die Redewendung im Ersten Weltkrieg. Die Soldaten waren oft an einem Punkt angelangt, wo sie nur noch nach Hause wollten. Das Kriegstreiben war ihnen zu viel und sie träumten davon, endlich in den Zug zu steigen und nach Hause zu fahren. Für Befehle waren sie taub geworden; sie verstanden nur noch Bahnhof. Einen Stein im Brett haben Kathrin hat mir ein Stück Kuchen mitgebracht, erzählt Erwin seinem Freund. Bei der hast du wohl einen Stein im Brett, meint der dazu. Damit meint der Freund aber nicht ein Kieselsteinchen, welches in einem geheimnisvollen Brett seinen Platz findet und Kathrin immer daran erinnert, Erwin einen Kuchen mitzubringen. Vielmehr will Erwins Freund ausdrücken, dass Kathrin Erwin wohl gerne mag. Diese Redensart ist schon ziemlich alt und lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Damals spielten die Leute gerne ein bestimmtes Brettspiel namens Wurfzabel. Bei dem ging es darum, seine Steine besonders gut auf dem Brett zu platzieren. Es ähnelt unserem heutigen Backgammon. Wenn man bei Wurfzabel zwei Felder nebeneinander mit seinen Steinen besetzt hatte, erhöht man seine Gewinnchancen. Man hatte einen guten Stein im Brett. Daraus hat sich das heutige einen Stein im Brett haben entwickelt. Ein guter Freund, der einem zur Seite steht (wie ein Stein dem anderen), hat bei uns einen Stein im Brett. Den Faden verlieren Und dann wollte ich – . äh, ich hab den Faden verloren. Das passiert uns wohl allen mal: Wir sind dabei, etwas zu erzählen, ein Gedanke schießt quer oder ein Gesprächspartner redet dazwischen, und schon haben wir vergessen, was wir sagen wollten. Man hat den Faden verloren und weiß nicht mehr weiter. Zum Ursprung dieser Redensart gibt es eine sehr hübsche Geschichte aus der griechischen Sagenwelt. Sie handelt von Monstern und der Liebe und geht in der Kurzform so: Ariadne, die Tochter vom König Minos auf Kreta, war in Theseus verliebt. Dessen Herz schlug auch für die Holde. Allein der Vater hatte eine fiese Aufgabe für jeden, der Heiratspläne mit seiner Tochter schmieden wollte. Der Freier musste in ein finsteres Labyrinth steigen und dort das Stierkopfmonster Minotaurus töten. Viele hatten sich daran schon versucht, waren aber bedauerlicherweise entweder dem Monster oder dem Labyrinth zum Opfer gefallen. Aber die schlaue Ariadne gab Theseus ein rotes Wollknäuel. Das konnte der Held auf seinem Weg ins Labyrinth abrollen und nach getaner Metzgerarbeit wieder nach draußen verfolgen. Theseus hat den Faden also nicht verloren, konnte also seine Geliebte für sich gewinnen. Allerdings nur für kurze Zeit Aber das ist eine andere Geschichte. Der springende Punkt Na komm, eine Vier in Mathe ist doch nicht so schlimm! An sich nicht, aber ich kriege jetzt wegen der Vier weniger Taschengeld – das ist der springende Punkt. Lustige Vorstellung: ein Punkt, der hüpft und springt – und was soll an dem so toll sein? Denn wir bezeichnen mit dem springenden Punkt in der Umgangssprache etwas, was wirklich wichtig ist. Damit weiß gleich jeder, was gemeint ist: das Wesentliche des Gesagten nämlich, auf den Punkt gebracht – den springenden Punkt eben. Die Herkunft dieser Redensart hat tatsächlich mit etwas Lebendigem zu tun. Mit einem Hühnerei nämlich, oder genauer: dem Küken, das im Ei heranreift. Schon Aristoteles, ein griechischer Philosoph, hat darin einen springenden Punkt erkannt. Wenn sich auf dem Eidotter langsam das kleine Vögelchen entwickelt, so kann man sein noch viel kleineres Herz schlagen sehen. Der sieht aus wie ein springender Punkt. Auch der Arzt sieht auf dem Ultraschallbild bei Babys das Herz als sich bewegenden Punkt. Und damit wird auch klar, weshalb die Redensart ihre Berechtigung hat, denn was gibt es Wichtigeres als das Herz? Einen Ohrwurm haben Ich werde diese Melodie einfach nicht wieder los. Das ist ein richtiger Ohrwurm! Ein Ohrwurm ist eigentlich ein Tier, ein Insekt nämlich. Und das heißt so, weil die Menschen glaubten und teilweise immer noch glauben , dass es uns im Schlaf ins Ohr kriecht. Das tut der Ohrwurm natürlich nicht wirklich. Die Tiere sind für Menschen vollkommen harmlos. Trotzdem nennen wir im übertragenen Sinn auch ein Musikstück oder eine Melodie einen Ohrwurm. Nämlich dann, wenn uns die Musik einfach nicht aus dem Sinn geht und wir die Töne ständig vor uns hinsummen müssen. Eigentlich keine schöne Vorstellung, dass die Musik wie ein Insekt im Gehörgang sitzt. Aber das tut sich ja auch nicht. Wenn wir gerade nicht summen oder singen, dann stellen wir uns die Musik nur vor. Tja, und wo ist die Musik dann? Sicher nicht im Ohr .