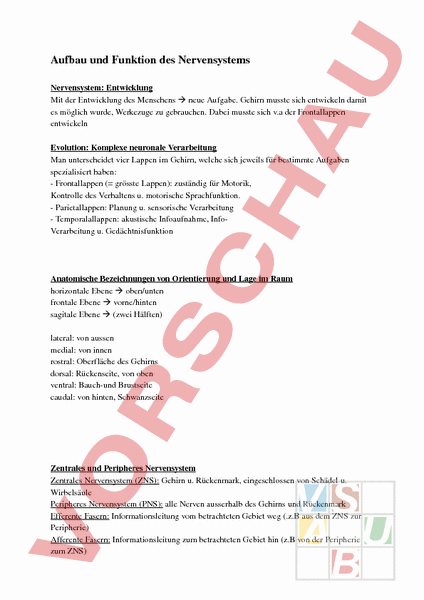Arbeitsblatt: nervensystem
Material-Details
Aufbau und funktion des NS
Biologie
Neurobiologie
klassenübergreifend
20 Seiten
Statistik
37940
1645
10
02.04.2009
Autor/in
romina Gregorini
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Aufbau und Funktion des Nervensystems Nervensystem: Entwicklung Mit der Entwicklung des Menschens neue Aufgabe. Gehirn musste sich entwickeln damit es möglich wurde, Werkezuge zu gebrauchen. Dabei musste sich v.a der Frontallappen entwickeln Evolution: Komplexe neuronale Verarbeitung Man unterscheidet vier Lappen im Gehirn, welche sich jeweils für bestimmte Aufgaben spezialisiert haben: Frontallappen ( grösste Lappen): zuständig für Motorik, Kontrolle des Verhaltens u. motorische Sprachfunktion. Parietallappen: Planung u. sensorische Verarbeitung Temporalallappen: akustische Infoaufnahme, Info Verarbeitung u. Gedächtnisfunktion Anatomische Bezeichnungen von Orientierung und Lage im Raum horizontale Ebene oben/unten frontale Ebene vorne/hinten sagitale Ebene (zwei Hälften) lateral: von aussen medial: von innen rostral: Oberfläche des Gehirns dorsal: Rückenseite, von oben ventral: Bauchund Brustseite caudal: von hinten, Schwanzseite Zentrales und Peripheres Nervensystem Zentrales Nervensystem (ZNS): Gehirn u. Rückenmark, eingeschlossen von Schädel u. Wirbelsäule Peripheres Nervensystem (PNS): alle Nerven ausserhalb des Gehirns und Rückenmark Efferente Fasern: Informationsleitung vom betrachteten Gebiet weg (.z.B aus dem ZNS zur Peripherie) Afferente Fasern: Informationsleitung zum betrachteten Gebiet hin (z.B von der Peripherie zum ZNS) Neuroanatomie: Grobe Gliederung Grosshirn: besteht aus den vier oben genannten Lappen Zwischenhirn: enthält Zentren für die Riech, Seh und Hörbahn, die Oberflächensensibilität und die seelische Empfindung. Hirnstamm: Mittelhirn (visuelle Verarbeitung) Pons (Brücke), viele Hirnnerven, verlängertes Mark Kleinhirn (Feinmotorik) Rückenmark: Medulla Spinalis Innerviert Extremitäten und Rumpf und hat eine Zylindrische Struktur (dicke eines Fingers, Länge 4045 cm). ist in den Kanal der knöchernen Wirbelsäule eingebettet Gehirn und Nervensystem „schwimmen* im Liquor Wirbelsäule besteht aus 3334 Wirbelknochen: 7 Zervikalwirbel, 12 Thorakalwirbel, 5 Lumbalwirbel, 5 Sakralwirbel (zusammengewachsen und 45 Kokzygealwirbel Rückenmarkssegmente So werden scheibenförmige Abschnitte des Hals bis Steissbereichs des Rückenmarks bezeichnet. Diese sind die 8 Zervikalsegmente, 12 Thorakalsegmente, 5 Lumbalsegmente, 5 Sakralsegmente und 1 Kokzygealsegment. Segmente sind Ursprungsund Zielgebiet der Spinalnerven. Diese Spinalnerven passieren Öffnungen zwischen den Wirbeln. Längenwachstum und Rückenmark: beim Fetus in Sakralkanal Hirnhäute (Rückenmark und Gehirn) Als die Hirnhaut bezeichnet man die Bindegewebsschichten, die das Gehirn umgeben und in die Rückenmarkshaut übergehen, welche den Rest des Zentralnervensystems (ZNS) umgibt. Rückenmark: Eintritt und Austritt von Fasern Vom Rückenmark aus laufen die sog. Spinalnerven zur Peripherie. Diese treten nach beiden Seiten aus den jeweiligen Segmenten des Rückenmarks durch die Zwischenräume zwischen den Wirbelknochen aus. Zunächst sind dies noch relativ dünne Bündel von Axonen, sog. Wurzelfäden, die sich dann zu den Wurzeln vereinigen. Je eine solche Wurzel findet sich auf der Ventralseite (Vorderwurzel) und auf der Dorsalseite (Hinterwurzel). Über die Hinterwurzel treten sensorische Fasern in das Rückenmark ein. Vor der Aufspaltung in die Wurzelfäden zeigt sich eine Verdickung. Die Vorderwurzel führt motorische (efferente Fasern, von denen die Muskeln des Bewegungsapparats u. der inneren Organe versorgt werden. Vorderund Hinterwurzel bilden also die zwei Äste der Spinalnerven. Insgesamt treten 31Spinalnerven naturgemäss zu beiden Seiten des Rückenmarks aus. (Siehe Bild auf S. 103) Die Bereiche mit Nervenzellköpern erscheinen grau (graue Substanz), während die Faserverbindungen (Bahnen) aufgrund der Myelinisierung weiss erscheinen (weisse Substanz). Rückenmark: Graue (Zellkörper) und weisse Substanz (Myelin Im Rückenmark liegt die weiße Substanz der grauen außen an Im Gehirn liegt die weiße Substanz innen und wird von der grauen Substanz umgeben. In der weißen Substanz sind jedoch auch Gebiete mit grauer Substanz, also Ansammlungen von Nervenzellkörpern, eingelagert. Diese bezeichnet man als Kerngebiete (Nuclei). Rückenmark: Dermatome Einteilung der Körperoberfläche in Dermatome. Aufeindanderfolge der Dermatome entspricht Abfolge der Rückenmarssegmente. Aufbau metamer. Jeder Spinalnerv versorgt auch Teile der benachbarten Dermatome jeder Punkt der Körperoberfläche wird von mind. 2 Spinalnerven erreicht. Querschnittlähmung: Plegie und Parese: Schweregrad motorisch und sensibel Paraplegie: Beine, tiefe Rückenmarkläsion Tetraplegie: Beine u. Arme, Halsmarkläsion Gürtelrose (Herpes zoster): segmentale Erkrankung bei Virus Infektion nicht dermatombezogene Hypästhesie Rückenmark: Aufgabe Leitungsaktivität: die in Längsrichtung des Rückenmarks verlaufenden Axone bilden weisse Substanz. Aufsteigenden Bahnen durchziehen grösstenteils den Hinterstrang, vereinzelt kommen sie auch im Seitenstrang u. Vorderstrang vor. Die Hinterstrangaxone entspringen an Hinterwurzel der gleichen Seite u. haben als Zielgebiete überwiegend sensible Kerne in der Medulla oblongata, die sich als Bestandteil des Gehirns direkt an das Rückenmark anschliesst. Im Vorderund Seitenstrang verlaufen Axone, deren Ursprung Zellkörper im Hinterhorn der kontralateralen Seite sind. Sie projizieren zumeist auf Kerngebiete in der Formation reticulais des Hirnstammst und im Thalamus. Ein weiterer aufsteigender Trakt zieht zum Kleinhirn. Die absteigenden Bahnen verlaufen primär im Vorderund teilweise im Seitenstrang relativ zentral, d.h nahe an der grauen Substanz. Ursprungsgebiete dieser Fasern sind Bereiche auf versch. Ebenen des Gehirns. Diese schliessen sowohl Hirnrindengebiete (höchstgelegenen Strukturen des Gehirns) als auch tiefere Gehirnregionen ein. So kann also ein einzelnes Rückenmarksneuron sehr grosse Strecken überbrücken. Reflexaktivität im Rückenmark wird afferente Info bereits so verarbeitet, dass nach Umschaltung über eine od. mehrere Synapsen Muskeloder Drüsenaktivität ausgelöst werden kann. Diese Verschaltung mit folgender motorischer Aktivität nenn man aufgrund ihres einfachen Charakters „Reflex. Man untersch. sog. Eigenund Fremdreflexe. Eigenreflex (direkter Reflex): das Organ der Reizentstehung ist identisch mit dem Reaktionsorgan. Reflexzeit kurz (ca. 10ms) und Ermüdung bei Wiederholung gering. Bekannteste Reflex ist der Kniesehnenreflex (Patellarsehnenreflex). Dabei folgt dem Schlaf auf eine Sehne unterhalb der Kniescheibe ein Vorschnellen des Unterschenkels. Fremdreflex (indirekter Refle): Reizort und Erfolgsorgan verschieden. Es sind mehr als zwei Neuronen beteiligt, demnach ist Leitungsweg polysynaptisch. Reflexzeit relativ lang (50150ms) und Ermüdbarkeit bei Wiederholung ist gross. Wichtigsten Fremdreflexe Fluchtreflexe. Wenn Hautrezeptoren schmerzhaft gereizt werden, kommt es zu integrierten Fluchtbewegung mehrerer Muskelgruppen. Siehe evtl. noch Zusammenfassung des Rückenmarks auf S. 107 Gehirn starke Furchung des Neocortex: Oberflächenvergrösserung Gewicht 1.1 – 1.5 kg Gewicht, Masse und Anzahl Neuronen bestimmt nicht direkt Leistungsfähigkeit sondern Verschaltungen sind ausschlaggebend. Problematisch: Ausfall von Neuronen Netzwerken beim Erwachsenen, weil keine Zellteilung bei Neuronen Neocortex hat in Phylogenese stark zugenommen (Sprache, exekutive Funktionen) Funktion des Gehirns hat sich bei uns in Tiefe verschoben. Abschnitte des Gehirns: Aufgrund morphologischer, funktioneller und evolutionsbiologischer Gesichtspunkte Aufteilung der unterschiedl. Gehirnarealen: Medulla oblongata verlängertes Mark Pons Brücke Mesencephalon Mittelhirn Diencephalon Zwischenhirn Cerebellum Kleinhirn Telencephalon Grosshirn (Endhirn) Absteigende Bahnen ziehen im vorderen Hirnstamm zum Rückenmark Kerngebiete im mittleren und hinteren Hirnstamm Aufsteigende sensorische Fasern im hinteren Bereich des Hirnstamms 12 Hirnnerven verlassen den Hirnstamm von oben bis unten in Reihenfolge der Bezifferung Liquor und Ventrikel Liquor (Cerebrospinalflüssigkeit) im Subarachnoidalraumund in Ventrikeln schützt das Gehirn vor mechanischen Schäden Ventrikel Hohlräume im Gehirn und Rückenmark, die mit Liquor gefüllt sind 4 verbundene Ventrikel: 1. und 2. Ventrikel Seitenventrikel 3. Ventrikel im Zwischenhirn 4. Ventrikel im Hirnstamm Halsarterien Kompliziertes Netz aufgrund der Entwicklung 1. Wurde Gehrind von vorn nach hinten her durchblutet, 2. Wuchs dann von hinten nach vorne, 3. Erst am Schluss wurde das „Vorne mit dem „Hals verbunden. Hirn wird also heute von hinten u. vorn mit Blut versorgt. Circulus arteriosus Willisi Beide Arterienpaare vereinigen sich im Arterienkreis Circulus anteriosus Willisi Vom WillisiKreis gehen paarweise die drei Arterien, Arteria cerebri posterior, media, anterior aus. Aufbau und Funktion des Nervensystems Der Begriff Nervensystem (lat. Systema nervosum) bezeichnet die Gesamtheit aller Nervenzellen in einem Organismus und beschreibt, wie diese angeordnet und miteinander verbunden sind. Es ist ein Organsystem der höheren Tiere, welches die Aufgabe hat, Informationen über die Umwelt und den Organismus aufzunehmen, zu verarbeiten und Reaktionen des Organismus zu veranlassen, um möglichst optimal auf Veränderungen zu reagieren. Das Nervensystem realisiert eine der Grundeigenschaften des Lebens, die Reizbarkeit (Irritabilität). Aufbau: Grundbaustein des Nervensystems ist das Nervengewebe. Es besteht aus vernetzten Nervenzellen (Neuronen), deren Zellkörper als Somata oder Perikarya und deren Fortsätze als Nervenfasern (Axone und Dendriten) bezeichnet werden. Bei höheren Lebewesen besteht das Nervengewebe aus einem Netz aus Neuronen und an vielen Stellen docken Gliazellen an. Letztere unterstützen die Tätigkeit der Nervenzellen. Durch Modulation der extrazellulären Konzentrationen von Ionen und Transmittern sowie der Regulation des lokalen Blutflusses, von dem Sauerstoffversorgung und die Verfügbarkeit hormonaler Neuromodulatoren (Bsp. NO) abhängen, beeinflussen sie die Weiterleitung elektrischer Reize von Neuron zu Neuron. Telencephalon (Grosshirn,Endhirn) Unterteilung in Kortex und Grosshirnmark. Oberfläche der beiden Grosshirnhemisphären (dazwischen liegt Fissura ongitudinalis cerebri) besteht aus grauer Substanz Darunter befindet sich die weisse Substanz. Oberfläche des Grosshirns ist in Sulci (Furchen) und Gyri (Windungen) gegliedert. Der Kortex: Bildet die äussere Schicht der Grosshirnhemisphären und besteht aus grauer Substanz (weisse Substanz liegt in tieferen Bereichen des Grosshirns). Schichtenstruktur (Zellen derselben Grösse und Form Treten zusammen in einer bestimmten Tiefe auf): Neokortex (6schichtiger Aufbau) Allokortex (3 bis 5schichtig) beinhaltet phylogenetisch ältere Anteile des Kortex, Paläokortex und Archikortex I. Molekularschicht II. äussere Körnerschicht III: äussere Pyramidenschicht IV. Innere Körnerschicht V. Innere Pyramidenschicht VI. Multiforme Schicht Neokortex: Mehr als 90 der gesamten Oberfläche der Grosshirn Hemisphären ist neokortikal. Analyse der Informationen aus der Umwelt und aus dem eigenen Körper als auch die Planung und Ausführung komplexer Handlungsabläufe. (Unter Neocortex wird der stammesgeschichtlich jüngste Teil der Großhirnrinde verstanden. Er wird nur bei Säugetieren gefunden. Der Begriff Neocortex wurde von dem Frankfurter Neurologen Ludwig Edinger (18551918) geprägt. Beim Menschen bildet der Neocortex den Großteil der Oberfläche des Großhirns (rund 90 %), darunter die Repräsentationen der Sinneseindrücke (sensorische Areale), den für Bewegungen zuständigen Motorcortex und die weiträumigen Assoziationszentren. Ältere Gebiete wie der Hippocampus werden als Archicortex bezeichnet, das Riechhirn gehört zum Paläokortex.) Hippocampus: Lernen und Gedächtnis, Aggression, Motivation und Bewusstsein Gyrus cinguli: Verbindung zu fast allen Anteilen des Neokortex. Besondere Bedeutung im Zusammenhang mit vegetativen und psychomotorischen Funktionen Amygdala: Erleben von Angst und Speicherung emotionaler Gedächtnisinhalte. Das limbische System ist die Zentralstelle des endokrinen, vegetativen und psychischen Regulationssystems. Kortikale Lappen und Areale Unterteilung der Hirnrinde in 4 Lappen: 1. Frontallappen (Lobus frontalis; Stirnlappen 2. Temporallappen (Lobus temporalis; Schläfenlappen) 3. Parietallappen (Lobus parietalis; Scheitellappen) 4. Okzipitallappen (Lobus occipitalis, Hinterhauptslappen) Unterteilung in Rindengebiete im Zusammenhang mit der Verarbeitung Primäre motorische Rindengebiete: Ausgangsstation für motorische Impulse aus Neokortex Sekundäre motorische Rindengebiete: Zielregion sind die primären motorischen Rindengebiete Frontallappen: Somatomotorisches System Primärer Motorischer Kortex: Somatotopisch gegliedert, jedem Abschnitt im Motorischen Kortex entspricht der Initiation von Bewegungen bestimmter Körperteile Prämotorisches und supplementärmotorisches Feld: Planung von Bewegungen. So laufen von hier aus zahlreiche Fasern zum Motorkortex, wo dann die Ergebnisse der Motorikplanung in absteigende Bewegungsimpulse umgesetzt werden. Allerdingst entsendet der prämotorische Kortex auch absteigende Fasern direkt zu subkortikalen motorischen Kerngebieten. Dennoch scheint Hauptaufgabe des präm. Kortex in der Vorbereitung von motorischen Aktionen zu bestehen. Auch sind vermutlich gut gelernte Bewegungsprogramme in ihrer sequentiellen Abfolge im prämotorischen Rindenfeld abgelegt. Brocasches Sprachzentrum: Broca Zentrum hat fundamentale Bedeutung für die Generierung von Sprache. Hier werden komplexen motorischen Programme zu sprachlichen Äusserung geformt, um dann in Impulse umgesetzt zu werden, die an die motorischen Ausgangsstationen der Hirnrinde laufen. Allerdings übernimmt diese Region ca. bei 90% der Menschen fast ausschliesslich in der linken Hemisphäre ihre Aufgabe im Zusammenhang mit der Sprachproduktion. Präfrontaler Kortex: wird aus der Gesamtheit derjenigen Kortexareale gebildet, die rostral der prämotorischen Rinde liegen. Er macht zudem ca. 2530% der gesamten Neokortexfläche aus. Die präfrontale Rinde ist sowohl afferent als auch efferent besonders eng mit limbischen Grosshirnstrukturen verbunden. Es liegen aber auch zahlreiche Verbindungen zur gegenüberliegenden Hemisphäre und über Assoziationsfasern zu allen anderen Bereichen des Neorkortex vor. Auch Thalamus steht sowohl afferent als auch efferent in enger Verbindung mit diesem Rindengebiet. Funktionen Arbeitsgedächtnis, Planung, Motivation, Persönlichkeit. Parietallappen: Somatosensibles System Primärer somatosensibler Kortex: Ort, in dem Berührungs, Wärme,Temperatur, Schmerz und Tastreize interpretationsfrei zum Bewusstsein kommen. Hier enden afferente Fasern, die Info aus der Haut, den Sehen und Gelenksrezeptoren sowie den Muskelspindeln herantransportieren. Alle Zuflüsse zum Gyrus postcentralis einer Heimisphäre stammen von der gegenüberliegenden Körperseite. Sekundärer somatosensibler Kortex: Zuständig für die Interpretation der in der primären somatosensiblen Rinde verschalteten Informationen. Dies zeigt sich z.b daran, dass bei Schädigung in diesem Areal über eine taktile Reizung noch berichtet werden kann, dass aber das Erkennen eines Gegenstandes etwa durch exploratorisches Befühlen nicht mehr möglich ist ( taktile Agnosie) Sensorische Rindengebiete: A) Primäre sensorische Rindengebiete: Erste Anlaufstation der einzelnen Sinnesbahnen im Kortex. Information wird interpretationsfrei repräsentiert. B) Sekundäre sensorische Areale: Komplexe Verarbeitung der Sinneseindrücke. C) Hinterer Parietallappen ist für die Raumwahrnehmung sowie Orientierung und Bewegung im Raum zuständig. Homunculus(gehört zum Frontallappen): Repräsentation verschiedener Körpergebiete Je nach funktionellen Bedeutsamkeit sind die verschiedenen Körpergebiete unterschiedlich gross repräsentiert. Okzipitallappen: Verarbeitung von Informationen aus dem optischen System. Dies beinhaltet zum einen die Verarbeitung rein physikalischen Information – Farbe, Helligkeit, Kontrast etc. zum anderen die Erkennung und Klassifikation von Objekten. Primäre Sehrinde: Zuständig für die interpretationsfreie Bewusstwerdung der visuellen Impulse der kontralateralen Gesichtsfeldhälfte beider Augen. Sekundäre Sehrinde: Interpretation der ankommenden visuellen Impulse im Sinne eines erkennenden Zuordnens (z.B. Zeichen werden als Schrift erkannt) Kortikale Plastizität: Fähigkeit des Gehirns, die Grösse und Antworteigenschaften von Hirnarealen in Abhängigkeit der Benutzung zu verändern (Beispiel: einseitiges Sehen). Temporallappen: Hör und Sprachzentrum (WernickeZentrum) Primäre Hörrinde: HeschlQuerwindungen bilden die primäre Hörrinde. Interpretationsfreie Bewusstwerdung von auditorischen Impulsen (z.B. Ton wird als Musik erkannt) Sekundäre Hörrinde: Interpretation von der in der primären Hörrinde ankommenden Impulse zuständig z.B. Erkennen und interpretieren von Sprache (Wernicke Sprachzentrum) Anatomie der Sprache: Aphasie Aphasieursache Gehirntumor WernickeAphasie: sensorische Aphasie Linkshänder mit rechtsdominanter Sprachfunktion kann operativ behandelt werden ohne dass Sprachfunktion zerstört wird. Erklärung: Trotz der Dominanz jeweils einer Hirnhälfte stehen dem gesunden Menschen jederzeit auch die Informationen der subdominanten Hirnhälfte zur Verfügung, da über den Balken ein reger Informationsaustausch stattfindet. Weisse Substanz des Grosshirns 1. Projektionsfasern: schaffen auf und absteigende Verbindungen zu subkortikalen Gebieten und verlaufen überwiegend durch die Capsula interna 2. Kommissurenfasern: verbindet die beiden neokortikalen Hemisphären 3. Assoziationsfasern: verbinden die verschiedenen KortexRegionen einer Hemisphäre miteinander Ab hier nicht mehr in Vorlesung behandelt: Hirnstamm: Das PinguinZeichen Als Hirnstamm (lat. Truncus cerebri) werden die unterhalb des Diencephalons lokalisierten Bereiche des Gehirns ohne Berücksichtigung des Cerebellums bezeichnet. Zum Hirnstamm gehören: das Mesencephalon (Mittelhirn), der Pons (Brücke) und die Medulla oblongata (verlängertes Rückenmark). Mesencephalon (Mittelhirn): Teil des Hirnstamms: zwischen Pons und Diencephalon. Es steuert die meisten Augenmuskeln und ist ein wichtiger Bestandteil des extrapyramidalen Systems. Erregungen sensibler Nerven werden an das Großhirn (Telencephalon) weitergeleitet oder auf motorische Nerven umgeleitet. Das Mittelhirn wird von allen Bahnen zwischen Vorderhirn und Rückenmark durchzogen. Wichtige Substrukturen sind: Tectum mit der Vierhügelplatte (zentrale Verarbeitung von optischen Reizen) mit den Colliculi superiores und Colliculi inferiores Tegmentum mit Substantia nigra (enthält dopaminproduzierende Zellen), Nucleus ruber (Schaltkreis für das extrapyramidalmotorsiche System), Formatio reticularis und Kerngruppen des III. und IV. Hirnnervs Crura cerebri werden von motorischen Bahnsystemen gebildet, die vom Kortex absteigen und zu den Hirnnervenkernen, dem Rückenmark und Pons laufen Pons: • Bündel von Fasern, die ins Cerebellumziehen, Verbindungen zw. Kleinhirnhemisphären • Ort von Hirnnerven Kernen: N. abducens (6): Seitwärtsbewegungen Augen N. facialis (8): mimische Gesichtsmuskulatur N. vestibulocochlearis (7): sensor. Info. aus Akustik Gleichgewicht N. trigeminus (5): sensor. Fasern aus Haut d. Gesichts, Mund, Nase Funktion: Durchgangsstation für alle Nervenfasern zwischen den vorderen und dahinterliegenden Abschnitten des Zentralnervensystems. Neben diesen Fasersträngen (weiße Substanz) liegen in der Brücke einige Ansammlungen von Nervenzellkörpern, die Brückenkerne (Nuclei pontis). Diese Brückenkerne sind Umschaltstation der Verbindungen zwischen Großhirn und Kleinhirn, die im Bereich der Brücke von links nach rechts bzw. von rechts nach links kreuzen. An einem Querschnitt durch die Brücke erkennt man schon mit bloßem Auge diese Querverbindungen (Fibrae transversae pontis). Medulla oblongata: verlängertes Mark • Auf Vorderseite: PyramidenkreuzungVerbindung zu Vordersträngen d. Rückenmarks • Oliven: Koordination von Bewegungen • Kerngebiete des Vegetativums: Atmung, Blutdruck, Herzschlagfrequenz, Kontraktionskraft des Herzens • Blutungen, Tumore: Druck auf Medulla Störung der Kreislaufregulation Koma, Tod • Austritt von den Hirnnerven 6 – 12 • Ort von Reflexen: Erbrechen, Schlucken, Husten Aufbau und Funktion des Nervensystems: Hirnnerven:12 Hirnnerven treten paarig aus dem Gehirn aus. Sie versorgen sensibel und motorisch den Kopf und Halsbereich sowie viszerosensibel und –motorisch den Brust und oberen Bauchraum. Hirnnerven leiten Informationen aus dem Bereich der Sensorik der Sensitivität der Motorik Cerebellum: Struktur: • Zwei Hemisphären, verbunden durch Kleinhirnwurm (Vermis cerebelli) • Rinde: 3schichtig, gefurcht • Im Cerebellumliegen 4 Kleinhirnkerne Funktion: • Motorische Feinabstimmung und Gleichgewicht, v.a. zeitliche Koordination von Einzelbewegungen viele Verbindungen zu anderen sensomotorischen Hirnregionen und Gleichgewichtsorgan • Klassisches Konditionieren, Prozedurales Lernen (Handlungsabläufe) Diencephalon (Zwischenhirn): Besteht aus Thalamus und Metathalamus Epithalamus mit der Epiphyse Subthalamus Hypothalamus mit der Hypophyse Informationsverarbeitung auf hohem Niveau, bezieht sich auf Feinsteuerung vegetativer Funktionen und höherer psychischer Funktionen wie auch Verarbeitung sensorischer Zuflüsse, die im Thalamus differenzierter analysiert und selektioniert werden. Thalamus: Paarig ausgebildet. Ansammlung von Nervenzellkörpern (graueSubstanz) Spezifische Kerne: Stehen in direkter Verbindung mit Teilen des Kortex und üben mit diesen spezifische Funktionen aus. Unspezifische Kerne: Stehen mit Hirnstamm, Formatio reticularis und indirekt mit Kortex inVerbindung. Assoziationskerne Funktionen des Thalamus: Sensorisches Umschaltzentrum, das die Information aus den Sinnesorganen filtert (Tor zum Bewusstsein) Motorische Koordination Schmerzwahrnehmung Aufgaben höherer psychischer Funktionen Basalganglien (Ansammlung von Nervenzellkörpern) Zu den Basalganglien gehören: Striatum (Nucleus caudatus und Putamen) Pallidum Amygdala Assozierte Basalganglienkerne Nucleus subthalamicus Substantia nigra Basalganglien sind unabdingbar für reibungslos und koordiniert verlaufende Bewegungsausführung, indem sie die motorischen Impulse des Kortex modulieren, dies geschieht durch komplexeVerschaltung mit hemmenden und erregenden Anteilen. Weisse Substanz des Grosshirns (3 funktionell unterschiedliche Bahnsysteme): 1. Projektionsfasern: schaffen auf und absteigende Verbindungen zu subkortikalen Gebieten und verlaufen überwiegend durch die Capsula interna 2. Kommissurenfasern: verbindet die beiden neokortikalen Hemisphären 3. Assoziationsfasern: verbinden die verschiedenen KortexRegionen einer Hemisphäre miteinander. Das vegetative Nervensystem Die Hauptaufgabe ist dieAufrechterhaltung der inneren Homöostase durch innerkörperliche Anpassungs und Regulationsvorgänge Das vegetative NS kontrolliert lebenswichtigen Funktionen (Vitalfunktionen) Es ist autonom. Das heisst, es ist weitgehend der willkürlichen Kontrolle durch Bewusstsein entzogen. Funktionen des Vegetativen Systems Erhält den normalen Zustand des Körpers unter wechselnden Bedingungen (Homöostase) (z.B. Kälte, Hitze, Stress, Ruhe) Regelt autonom (unwillkürlich) lebenswichtige Funktionen des Kreislaufes (Herz, Gefässe) der Atmung der Verdauung der Entleerung des Stoffwechsels Körpertemperatur Fortpflanzung der Sekretion (Tränen, Schweiss, Speichel, und Verdauungsdrüsen) der Pupillenweite Vegetatives Nervensystem VNS –supratentorielle Zentren • Insulärer Kortex: – Integration von wichtigen viszerosensorischen Informationen • Vorderer Gyrus cinguli, Ventromedialer präfrontaler Kortex: Integration von emotionalen und kognitiven Funktionen in die Steuerung des autonomen Nervensystems • Amygdala: Wichtige Afferenzen von visuellen, auditorischen und somatosensorischen kortikalen Arealen – wichtige subkortikale Projektionen zu autonomen Zentren im Hypothalamus und Hirnstamm • Hypothalamus: – Hauptsteuerungszentrum des autonomen Nervensystems mit Integration des endokrinologischen Funktionssystems Im somatosensorischen System versorgt ein motorisches Neuron im Rückenmark direkt die quergestreifte Muskulatur. Im vegetativen NS sind 2 Neuronen hintereinander geschaltet. Bei den Varikositäten handelt es sich um Aufreibungen des Axons einer postganglionären Zelle in der Nähe des Zielorgans. Varikositäten entsprechen den präsinaptischen Endigungen im ZNS. Der Abstand zwischen den Varikositäten und den Muskelfaserzellen ist vergleichsweise gross, so dass der Neurotransmitter über relativ weite Strecken diffundieren muss. Darum ist die Zeitverzögerung bei der Übertragung beträchtlich Das vegetative NS ist besser für langsam ablaufende, aber dafür grossflächier greifende Effekte geeignet, als das ZNS. Neurochemie der Übertragung im vegetativen Nervensystem: Im Parasympathikus und Sympathikus erfolgt die präganglionäre Übertragung durch Acetylcholin. Acetylcholin bindet hier an nikotinerge Rezeptoren. Die Transmitterwirkung wird durch das Enzym acetylcholinesterase unterbrochen. Im Prasympathikus ist der Transmitter, der die Übertragung vom postganglionären Axon auf das Effektororgan besorgt, ebenfalls Acetylcholin. Hier wird die Wirkung von Acetylcholin über muskarinerge Rezeptoren vermittelt. Im Sympathikus ist der wichtigste Neurotransmitter in den postganglionären Axonen das Noradrenalin. Die Wirkung von Noradrenalin wird durch einer Wiederaufnahme in die Varikosität beendet.