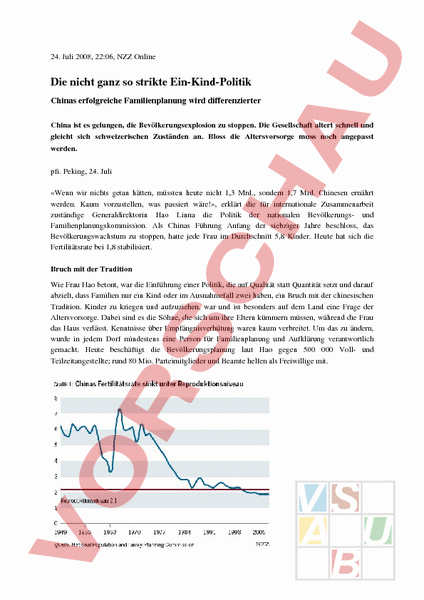Arbeitsblatt: Ein-Kind-Politik China
Material-Details
Zeitungsartikel
Anwendung:
Diskussion Pro-Contra
Geographie
Asien
8. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
37994
947
17
03.04.2009
Autor/in
Angela (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
24. Juli 2008, 22:06, NZZ Online Die nicht ganz so strikte EinKindPolitik Chinas erfolgreiche Familienplanung wird differenzierter China ist es gelungen, die Bevölkerungsexplosion zu stoppen. Die Gesellschaft altert schnell und gleicht sich schweizerischen Zuständen an. Bloss die Altersvorsorge muss noch angepasst werden. pfi. Peking, 24. Juli «Wenn wir nichts getan hätten, müssten heute nicht 1,3 Mrd., sondern 1,7 Mrd. Chinesen ernährt werden. Kaum vorzustellen, was passiert wäre!», erklärt die für internationale Zusammenarbeit zuständige Generaldirektorin Hao Linna die Politik der nationalen Bevölkerungs und Familienplanungskommission. Als Chinas Führung Anfang der siebziger Jahre beschloss, das Bevölkerungswachstum zu stoppen, hatte jede Frau im Durchschnitt 5,8 Kinder. Heute hat sich die Fertilitätsrate bei 1,8 stabilisiert. Bruch mit der Tradition Wie Frau Hao betont, war die Einführung einer Politik, die auf Qualität statt Quantität setzt und darauf abzielt, dass Familien nur ein Kind oder im Ausnahmefall zwei haben, ein Bruch mit der chinesischen Tradition. Kinder zu kriegen und aufzuziehen, war und ist besonders auf dem Land eine Frage der Altersvorsorge. Dabei sind es die Söhne, die sich um ihre Eltern kümmern müssen, während die Frau das Haus verlässt. Kenntnisse über Empfängnisverhütung waren kaum verbreitet. Um das zu ändern, wurde in jedem Dorf mindestens eine Person für Familienplanung und Aufklärung verantwortlich gemacht. Heute beschäftigt die Bevölkerungsplanung laut Hao gegen 500 000 Voll und Teilzeitangestellte; rund 80 Mio. Parteimitglieder und Beamte helfen als Freiwillige mit. Chinas Bevölkerungspolitik ist international wahrscheinlich die erfolgreichste. Sie ist allerdings nicht unumstritten, weil es häufig zu Zwangsmassnahmen wie unfreiwilligen Sterilisationen oder Abtreibungen kam. Laut Hao hatte dies damit zu tun, dass lokale Verantwortliche daran gemessen wurden, wie die Planvorgaben eingehalten wurden. Seit 2001 regle nun aber ein Gesetz die Familienpolitik Chinas. Deren Ziel sei es nicht mehr primär, die Zahl der Geburten zu kontrollieren, sondern alle Fragen der Bevölkerungsentwicklung umfassend anzugehen. Jahreslohn für ein Kind mehr Alle Familien hätten ein Recht darauf, ihre Entscheide in der Familienplanung selbst zu fällen. Wenn sie mehr Kinder wollten, als ihnen vom Gesetz her zustehe, müssten sie eine Strafe zahlen, die sich ungefähr in der Höhe eines durchschnittlichen Jahreslohns bewege. Beamte, die Frauen gegen ihren Willen zu einer Abtreibung oder Sterilisation drängen, machen sich strafbar. Ihre Aufgabe ist es lediglich, Familien aufzuklären, ihnen gratis Verhütungsmittel zur Verfügung zu stellen und für die Senkung der Kindersterblichkeit zu sorgen. Inzwischen befolgen laut Hao 99% der urbanen und 85% der ländlichen Haushalte die Vorschriften. EinKindFamilien und Eltern, die «nur» Töchter haben, werden mit relativ kleinen SonderRenten belohnt. Die EinKindPolitik ist längst differenzierter, als ihr Name suggeriert. Das Gebot, nur ein Kind zu haben, gilt nur für «normale» Städter. Ein weiteres gebären darf, wer ein behindertes Kind zur Welt bringt oder wer sein Kind verloren hat. Angehörige ethnischer Minderheiten können seit je zwei Kinder haben. In 5 ländlich geprägten der insgesamt 31 Gebietseinheiten auf dem Festland haben heute Familien grundsätzlich das Recht, zwei Kinder zu kriegen. Im Autonomen Verwaltungsgebiet Tibet gilt die Bevölkerungspolitik nur als Empfehlung. Ferner dürfen in ganz China städtische Paare, bei denen beide Elternteile aus einer EinKindFamilie stammen, zwei Kinder haben. Ausserdem steht in 19 Regionen Chinas allen Familien ein zweites Kind zu, deren erstes Kind ein Mädchen ist. Damit sollen Familien davon abgehalten werden, Schwangerschaften abzubrechen, wenn das Baby ein Mädchen ist. Pränatale Geschlechtsbestimmung ist in China streng verboten, doch in ländlichen Gegenden wurden im Jahr 2007 dennoch auf 100 Mädchen 123 Knaben geboren. Immer mehr Alte Chinas Bevölkerungszusammensetzung hatte noch 1970 die klassische Pyramidenform, wird aber im Jahre 2050 eher einem bauchigen Fässchen gleichen. Waren 1970 erst 7% der Bevölkerung über 60 Jahre alt, werden es 2050 voraussichtlich 29% sein. Weil es weniger Kinder gibt, hat sich der Anteil der Werktätigen vorerst allerdings erhöht. 2005 waren in China 65% der Männer und 62% der Frauen im werktätigen Alter, was fast den Zuständen in der Schweiz entspricht (64% bzw. 55%). Bis 2050 soll laut Prognosen der Uno dieser Anteil so sinken, dass in China im Schnitt auf jede erwerbsfähige eine abhängige Person fallen wird, was wiederum den erwarteten Schweizer Verhältnissen gleicht. Die Wirtschaft muss sich deshalb auf eine ältere Bevölkerung mit veränderten Konsumbedürfnissen und mehr verwöhnten Einzelkindern (in China «kleine Kaiser» genannt) einstellen. Der Alterungsprozess ist zudem eine Herausforderung, weil der grösste Teil der Landbevölkerung Chinas noch über keine Altersvorsorge verfügt. Die Staatsführung hofft, dass Wirtschafts und Produktivitätswachstum Raum schaffen, dies zu ändern. Sicher ist bereits jetzt, dass die Chinesen ohne ihre Bevölkerungspolitik deutlich ärmer wären.