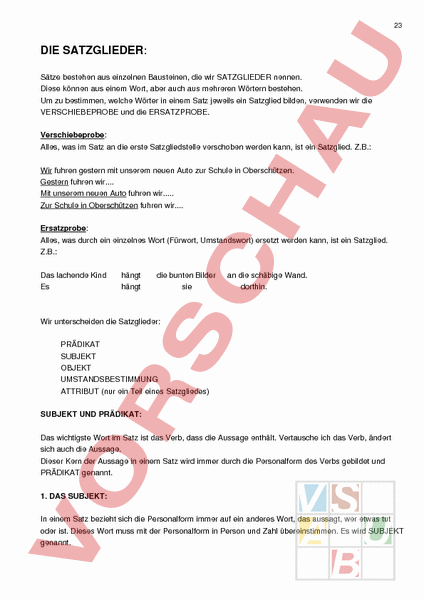Arbeitsblatt: Die Satzglieder
Material-Details
Das Subjekt
Das Prädikat
Das Objekt
Adverbale Bestimmungen
Attribut
Deutsch
Grammatik
7. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
38141
1823
72
07.04.2009
Autor/in
comimo (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
23 DIE SATZGLIEDER: Sätze bestehen aus einzelnen Bausteinen, die wir SATZGLIEDER nennen. Diese können aus einem Wort, aber auch aus mehreren Wörtern bestehen. Um zu bestimmen, welche Wörter in einem Satz jeweils ein Satzglied bilden, verwenden wir die VERSCHIEBEPROBE und die ERSATZPROBE. Verschiebeprobe: Alles, was im Satz an die erste Satzgliedstelle verschoben werden kann, ist ein Satzglied. Z.B.: Wir fuhren gestern mit unserem neuen Auto zur Schule in Oberschützen. Gestern fuhren wir Mit unserem neuen Auto fuhren wir. Zur Schule in Oberschützen fuhren wir Ersatzprobe: Alles, was durch ein einzelnes Wort (Fürwort, Umstandswort) ersetzt werden kann, ist ein Satzglied. Z.B.: Das lachende Kind Es hängt hängt die bunten Bilder sie an die schäbige Wand. dorthin. Wir unterscheiden die Satzglieder: PRÄDIKAT SUBJEKT OBJEKT UMSTANDSBESTIMMUNG ATTRIBUT (nur ein Teil eines Satzgliedes) SUBJEKT UND PRÄDIKAT: Das wichtigste Wort im Satz ist das Verb, dass die Aussage enthält. Vertausche ich das Verb, ändert sich auch die Aussage. Dieser Kern der Aussage in einem Satz wird immer durch die Personalform des Verbs gebildet und PRÄDIKAT genannt. 1. DAS SUBJEKT: In einem Satz bezieht sich die Personalform immer auf ein anderes Wort, das aussagt, wer etwas tut oder ist. Dieses Wort muss mit der Personalform in Person und Zahl übereinstimmen. Es wird SUBJEKT genannt. 24 z.B.: Ich schlafe fest. Du schläfst fest. Er schläft fest. Sie (Wir) schlafen fest. Die Kinder spielten im Garten. Es können auch zwei oder mehr Subjekte mit dem Verb verknüpft sein: Mein Bruder, mein Freund und ich spielten Fußball. 25 Wie erkenne ich das Subjekt im Satz? 1. durch Fragen: wer oder was Verb; damit wird der Nominativ (1. Fall) erfragt. Das Subjekt steht immer im Nominativ! z.B.: wer oder was schläft fest? 2. durch Veränderung der Personalform: z.B.: Er spielt im Garten spielst im Garten du Das Wort, das sich mit der Personalform ändert, ist das Subjekt 3. Infinitivprobe: Wenn wir das Verb eines Satzes in die Nennform setzen und die übrigen Satzglieder hinzufügen, bleibt das Subjekt übrig: z.B.: im Garten spielen die Kinder Das Subjekt kann aus mehreren Wörtern bestehen und muss nicht am Anfang des Satzes stehen: z.B.: Im Käfig lagen drei junge Tiger. Das Subjekt wird durch ein Nomen (Hauptwort) oder Pronomen (Fürwort) gebildet: Die Kinder jubelten laut. Sie jubelten laut. Viele jubelten laut. 2. DAS PRÄDIKAT: Das Prädikat wird durch die Personalform des Verbs gebildet. Zu dieser können noch weitere Teile des Prädikats kommen (Hilfsverben, Infinitiv, Verbzusatz). Das einteilige Prädikat besteht aus der Personalform des Verbs: Er kam zu spät. Sie isst gerade. Das zweiteilige Prädikat kann bestehen aus: Hilfsverb der Zeit Pers.F. und Verb im Infinitiv: Er wird zu spät kommen. Sie wird das Buch lesen. Hilfsverb der Zeit Pers.F. und Verb im 2.Partizip: Er ist(war) zu spät gekommen. Sie hat(te) das Buch gelesen. Modalverb Pers.F. und Verb im Infinitiv: Er muss zu spät kommen. Sie will das Buch lesen. Modifizierendes Verb Pers.F. und Verb im Infinitivzu: Er pflegt am Abend ausgiebig zu essen. Verb Pers.F. und Verb im Infinitiv oder im 2. Mittelwort. Wir sahen ihn kommen. Er kam angerannt. Verb Pers.F. und Verbzusatz: Er sprang vom Zug ab (abspringen). Sie setzte sich hin. Beispiel für ein dreiteiliges Prädikat: Sie kann von ihm abgeholt werden (Modalverb, Verb im 2. Partizip, Hilfsverb) 26 Beispiel für ein vierteiliges Prädikat: Du hättest ihn nicht hinausgehen lassen dürfen. (Hilfsverb, 2 Verben im Infinitiv, Modalverb) Die Personalform steht in Aussagesätzen an zweiter Satzgliedstelle, in Entscheidungsfragen an erster und in Gliedsätzen meist an letzter. In Sätzen mit zweiteiligem Prädikat steht das aussagende Verb an letzter Stelle (es bildet mit der Pers.F. die verbale Klammer). Z.B.: Gestern abends haben wir überraschenden Besuch bekommen. Habt ihr gestern Besuch bekommen? Ich weiß, dass ihr gestern Besuch bekommen habt. 27 3. OBJEKTE (Ergänzungen): Objekte sind Satzglieder, die die Aussage eines Verbs ergänzen, sie sind oft für das Verständnis des Satzes notwendig. Sie werden durch Nomen oder Pronomen gebildet. a. FALLOBJEKTE: Das sind Objekte, deren Fall vom Verb abhängt: Akkusativobjekt (O4): Frage: Wen?/Was? Ersatzprobe: mich/dich z.B.: Er unterstützt seinen Freund. Sie trägt den Koffer. Dativobjekt (O3): Frage: Wem? Ersatzprobe: mir/dir z.B.: Wir helfen dem Verletzten. Ich schenke ihm ein Buch. Genitivobjekt (O2): Frage: Wessen? (selten!) z.B.: Sie gedenken der Toten. Er rühmte sich seines Sieges. Ich schäme mich meiner Lügen. Das O2 wird heute oft durch Vorwortfügungen ersetzt: Sie denken an die Toten. Er rühmt sich wegen seines Sieges. Ich schäme mich wegen meiner Lügen. Gleichsetzungsglied im Nominativ: Einige Verben verlangen ein Objekt im 1.Fall, das wie das Subjekt erfragt wird. Da dieses Objekt mit dem Subjekt gleichgesetzt wird, nennt man es Gleichsetzungsglied. z.B.: sein: Er ist der beste Schüler. Meine Mutter ist Lehrerin. bleiben: Du bleibst mein bester Freund. Ein Esel bleibt ein Esel. werden: Sein Bruder wird Tierarzt. Gleichsetzungsglied im Akkusativ: Einige Verben setzen 2 Akkusativobjekte gleich, das 2. Objekt wird dann Gleichsetzungsakkusativ genannt. z.B.: nennen: Er nannte seinen Freund einen Dummkopf. heißen: Sie hieß mich einen Esel. b. PRÄPOSITIONALOBJEKTE (PO) (Vorwortergänzungen): Sie werden mit einem Vorwort (Präposition) gebildet, das auch den Fall des Nomens oder Pronomens bestimmt. Sie werden auch mit diesem VorwortFragewort erfragt. Bei Sachen fragt man besser mit dem Umstandswort wo Präposition (Umstandsfürwörter): PO4: Ich habe für dich (für einen guten Zweck) gearbeitet. Frage: für wen? (wofür?) PO3: Er spielt mit seinem Hund (mit Steinen). Frage: mit wem? (womit?) PO2: Er kehrt wegen des Nebels um. Frage: weswegen? 28 Vorwortfügungen (Vorwort Nomen) können aber auch für Umstandsergänzungen und Attribute verwendet werden: Z.B.: Er wandert in den Wald. (Wohin?) Er liest das Buch aus der Bibliothek. (Was für ein Buch?) 29 c. UMSTANDSERGÄNZUNGEN Sie sind wie die Objekte für den Satz notwendig und geben eine Zeit, einen Ort, eine Art oder einen Grund an. Sie werden durch ein Nomen – mitunter mit einer Präposition – oder durch ein Umstandswort gebildet. Ortsergänzung: Wo? Woher? Wohin? Wie weit? z.B.: Wir gehen in die Schule. Er kommt aus Wien. Dort geschah das Unglück. Zeitergänzung: Wann? Seit wann? Bis wann? Wie lange? Wie oft? z.B.: Der Start ist um neun Uhr. Die Stunde dauert 50 Minuten. Er braucht für seine Arbeit eine Stunde. Ich habe das zehn mal wiederholt. Artergänzung: Wie? (Meist durch Adjektiv gebildet!) z.B.: Er schaut schlecht aus. Sie verhalten sich unruhig. Begründungsergänzung: Warum? Weshalb? Weswegen? Wozu? z.B.: Der Fehler entstand wegen seiner Unachtsamkeit/deswegen. 4. ADVERBIALE BESTIMMUNGEN (Freie Umstandsangaben) Sie werden wie die Umstandsergänzungen gebildet und erfragt, sind aber für die Bildung des Satzes nicht notwendig. Ortsangabe (Lokalbestimmung): Wir spielten hinter dem Haus Fußball. (Wo?) Meine Oma hat mir aus Wien etwas mitgebracht. (Woher?) Zeitangabe (Temporalbestimmung): Ich war mit meiner Arbeit seit 15 Uhr fertig. (Seit wann?) Sie haben uns eine Woche lang besucht. (Wie lange?) Artangabe (Modalbestimmung): Er schleppte sich mit letzter Kraft ins Haus. (Wie?) Begründungsangabe (Kausalbestimmung): Sie versäumte wegen der Krankheit die Schularbeit. (Warum?) Sonderformen der Kausalbestimmung: Instrumentale Bestimmung: Sie gibt das Mittel an, mit dessen Hilfe etwas geschieht. Er schlug ihn mit einem Stein zu Boden. (Womit?) 30 Finale Bestimmung: Sie gibt den Zweck an, für den etwas geschieht. Er geht zum Trainieren in die Stadthalle. (Wozu?) 31 5. ATTRIBUT (Beifügung, Gliedteil) Es dient zur näheren Bestimmung eines Nomens und ist nur Teil des entsprechenden Satzgliedes, also kein selbständiges Satzglied. Das Attribut kann häufig weggelassen werden, ist mitunter aber auch für den Sinn des Satzes notwendig. Z.B.: Mein Freund ist ein freundlicher Junge. Frage: WAS FÜR EIN? WELCHER? WESSEN? (nicht mit O2 verwechseln!!), WIEVIEL? Attribute können gebildet werden aus: a) Adjektiv: der fleißige Schüler; ein scharfes Bild (das Adjektiv als Attribut ist gebeugt!) b) 1.Partizip: das lachende Mädchen; der stechende Schmerz c) 2.Partizip: der gepflegte Rasen; in der vergangenen Woche d) Nomen im Genitiv: der Hund des Freundes; der Wille Gottes e) Nomen im Vorwortfall: das Haus auf dem Hügel; der Mann mit dem Hut f) Pronomen: mein Freund, jener Tag, welche Kinder, wessen Auto g) Numerale: zwei Kinder, einige Bücher, das erste Spiel h) Adverb: die Hütte dort, die Feier übermorgen f) Infinitiv mit zu: die Angst zu versagen; der Wunsch zu siegen g) Apposition: Nomen im selben Fall wie das Bezugswort: Karl der Große, mein Onkel Oskar, ein Kilo Nüsse h) nachgetragene Apposition: durch Beistriche abgetrennte Fügung: Er traf Herrn Müller, seinen Fußballtrainer, im Urlaub. Franz, mein bester Freund, muss die Klasse wiederholen. Ein Attribut kann auch einen ganzen Satz bilden, der von einem Nomen oder Pronomen abhängig ist. z.B.: Das Buch, das du mir kürzlich geliehen hast, habe ich schon ausgelesen.