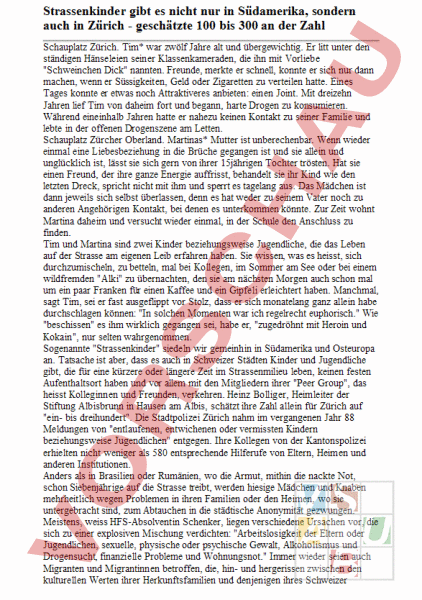Arbeitsblatt: Strassenkinder in ZH
Material-Details
Ein Bericht zu Strassenkindern in Zürich + Fragen
Deutsch
Anderes Thema
7. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
3824
1288
33
18.01.2007
Autor/in
BenutzerInnen-Konto gelöscht (Spitzname)
Land:
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Strassenkinder gibt es nicht nur in Südamerika, sondern auch in Zürich geschätzte 100 bis 300 an der Zahl Schauplatz Zürich. Tim* war zwölf Jahre alt und übergewichtig. Er litt unter den ständigen Hänseleien seiner Klassenkameraden, die ihn mit Vorliebe Schweinchen Dick nannten. Freunde, merkte er schnell, konnte er sich nur dann machen, wenn er Süssigkeiten, Geld oder Zigaretten zu verteilen hatte. Eines Tages konnte er etwas noch Attraktiveres anbieten: einen Joint. Mit dreizehn Jahren lief Tim von daheim fort und begann, harte Drogen zu konsumieren. Während eineinhalb Jahren hatte er nahezu keinen Kontakt zu seiner Familie und lebte in der offenen Drogenszene am Letten. Schauplatz Zürcher Oberland. Martinas* Mutter ist unberechenbar. Wenn wieder einmal eine Liebesbeziehung in die Brüche gegangen ist und sie allein und unglücklich ist, lässt sie sich gern von ihrer 15jährigen Tochter trösten. Hat sie einen Freund, der ihre ganze Energie auffrisst, behandelt sie ihr Kind wie den letzten Dreck, spricht nicht mit ihm und sperrt es tagelang aus. Das Mädchen ist dann jeweils sich selbst überlassen, denn es hat weder zu seinem Vater noch zu anderen Angehörigen Kontakt, bei denen es unterkommen könnte. Zur Zeit wohnt Martina daheim und versucht wieder einmal, in der Schule den Anschluss zu finden. Tim und Martina sind zwei Kinder beziehungsweise Jugendliche, die das Leben auf der Strasse am eigenen Leib erfahren haben. Sie wissen, was es heisst, sich durchzumischeln, zu betteln, mal bei Kollegen, im Sommer am See oder bei einem wildfremden Alki zu übernachten, den sie am nächsten Morgen auch schon mal um ein paar Franken für einen Kaffee und ein Gipfeli erleichtert haben. Manchmal, sagt Tim, sei er fast ausgeflippt vor Stolz, dass er sich monatelang ganz allein habe durchschlagen können: In solchen Momenten war ich regelrecht euphorisch. Wie beschissen es ihm wirklich gegangen sei, habe er, zugedröhnt mit Heroin und Kokain, nur selten wahrgenommen. Sogenannte Strassenkinder siedeln wir gemeinhin in Südamerika und Osteuropa an. Tatsache ist aber, dass es auch in Schweizer Städten Kinder und Jugendliche gibt, die für eine kürzere oder längere Zeit im Strassenmilieu leben, keinen festen Aufenthaltsort haben und vor allem mit den Mitgliedern ihrer Peer Group, das heisst Kolleginnen und Freunden, verkehren. Heinz Bolliger, Heimleiter der Stiftung Albisbrunn in Hausen am Albis, schätzt ihre Zahl allein für Zürich auf ein- bis dreihundert. Die Stadtpolizei Zürich nahm im vergangenen Jahr 88 Meldungen von entlaufenen, entwichenen oder vermissten Kindern beziehungsweise Jugendlichen entgegen. Ihre Kollegen von der Kantonspolizei erhielten nicht weniger als 580 entsprechende Hilferufe von Eltern, Heimen und anderen Institutionen. Anders als in Brasilien oder Rumänien, wo die Armut, mithin die nackte Not, schon Siebenjährige auf die Strasse treibt, werden hiesige Mädchen und Knaben mehrheitlich wegen Problemen in ihren Familien oder den Heimen, wo sie untergebracht sind, zum Abtauchen in die städtische Anonymität gezwungen. Meistens, weiss HFS-Absolventin Schenker, liegen verschiedene Ursachen vor, die sich zu einer explosiven Mischung verdichten: Arbeitslosigkeit der Eltern oder Jugendlichen, sexuelle, physische oder psychische Gewalt, Alkoholismus und Drogensucht, finanzielle Probleme und Wohnungsnot. Immer wieder seien auch Migranten und Migrantinnen betroffen, die, hin- und hergerissen zwischen den kulturellen Werten ihrer Herkunftsfamilien und denjenigen ihres Schweizer Freundeskreises, schliesslich keinen anderen Ausweg mehr wüssten, als sich für kurz oder länger davonzumachen. Wer ausreisst, setzt damit ein unübersehbares Zeichen: Stop! So nicht! Ich brauche andere Lebensbedingungen. Das sei zum einen Ausdruck von Verzweiflung und Orientierungslosigkeit, sagt Noori Beg vom Zürcher Schlupfhuus, das Kinder und Jugendliche in einer Notlage beherbergt. Zum anderen aber auch ein Akt der Selbstbehauptung, der Mut und Energie erfordert. Oder wie es Flavia Schenker ausdrückt: Nicht alle schaffen es, auszubrechen, denn das Leben im Strassenmilieu ist wirklich hart. Ständig auf der Suche nach der nächsten Unterkunft, von Hunger, Kälte und Gesundheitsproblemen geplagt, laure, so erzählen Gassenarbeiter übereinstimmend, stets die Gefahr, in irgendwelche Abhängigkeiten zu geraten: Sei es von Drogen, der Gunst von Freiern oder Kolleginnen. Wer polizeilich ausgeschrieben sei, befinde sich zudem in der dauernden Angst, aufgegriffen zu werden. Streetworker Heinz Bachmann betreut zur Zeit einige obdach- und arbeitslose Jugendliche, die zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof, dem Niederdorf, dem Bahnhof Stadelhofen und dem Bellevueplatz zirkulieren, betteln und sich so durch ihren Alltag mischeln. Eine zeitlang würde vielen, so Bachmann, ein solches Leben der Freiheit und des Abenteuers zusagen, aber irgendwann sei der Reiz des Bettelns und Herumlungerns dann vorbei. Wer die Nase voll und den permanenten Stress satt hat, kann in Zürich mit dem Schlupfhuus oder Mädchenhaus Kontakt aufnehmen. Das sind Einrichtungen, in denen Jugendliche für maximal drei Monate unterkommen und Hilfe beanspruchen können. Wer sich bei uns meldet, sagt Noori Beg vom Schlupfhuus, muss wissen, dass ihn ein klar strukturierter Alltag mit Regeln und Verbindlichkeiten und eine klare Absage an das Leben auf der Gasse erwartet. Die meisten ihrer Klientinnen und Klienten würden mit der Zeit denn auch in ihre Familien zurückkehren oder könnten andernorts plaziert werden. Fragen 1a) Welches Problem hatte Tim? b) Wie „erkaufte er sich Freunde? b) Was geschah, als er 13 war? 2a) Worunter leidet Martina? b) Was passiert, wenn Martinas Mutter einen Freund hat? c) Warum ist Martina auf ihre Mutter angewiesen? 3a) Was bedeutet Leben auf der Strasse? b) Warum hat er nicht gemerkt, wie schlecht es ihm ging? b) Worauf war Tim stolz? 4a) Aus welchen Gründen reissen bei uns Jugendliche aus? b) Was ist mit „städtischer Anonymität gemeint? c) Laut Noori Bog ist dieses Ausreissen ein Ausdruck von was? 5a) Welche Gefahr lauert auf die Strassenkinder? b) Welchem Stress sind sie ausgesetzt? c) Was bietet ihnen die Stadt ZH an? d) Wie lange dürfen sie dort bleiben? Unter welchen Bedingungen?