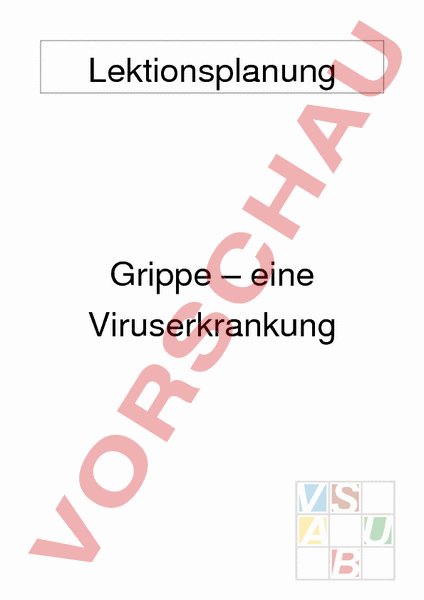Arbeitsblatt: Grippe - Eine Viruserkrankung
Material-Details
Bestandteile und Vermerung von Grippeviren
Biologie
Zellbiologie / Cytologie
10. Schuljahr
7 Seiten
Statistik
40456
1678
24
24.05.2009
Autor/in
Michael Compeer
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Lektionsplanung Grippe – eine Viruserkrankung Michael Compeer Glaserweg 1 5012 Schönenwerd 062 849 55 70 079 585 60 45 Thema: Lehrkraft: Grippe – eine Viruserkrankung Michael Compeer Bestandteil der Schule: KS Olten Unterrichtseinheit: Datum: 12.11.08 Zeit: 45 Minuten Einzeller, Viren Klasse: 9. Schuljahr Lektionsspezifische Vorkenntnisse: Die SuS kennen zelluläre Bestandteile wie Erbgut, Zellkern, Mitochondrien, Ribosomen (und Proteine). Die SuS haben eine Vorstellung von der Grösse einer tierischen Zelle (sowie eines Bakteriums). Die SuS sind in der Lage, zu zweit die 6 Kennzeichen des Lebens zu nennen. Lernziele: Die Leitidee: Viren und Bakterien stellen die einfachsten biologischen Systeme dar. Die SuS erhalten Einblick in ein mikrobielles Modell, an dem Wissenschaftler die grundlegenden molekularen Mechanismen des Lebens in ihrer einfachsten Form untersuchen können. Als Parasiten sind die Viren auf Wirte angewiesen. Eine Virusinfektion äussert sich stets in gewissen Krankheitssymptomen. Die Grippe ist speziell in der kalten Jahreszeit eine sehr häufige und ansteckende Krankheit infolge einer Virusinfektion. Kenntnisse über die Art der Ansteckung und den Vermehrungszyklus von Grippeviren helfen, den Krankheitsverlauf besser zu verstehen und sich vor Ansteckung zu schützen. Das Dispositionsziel: Die SuS sind sich einer drohenden Ansteckung mit dem Grippevirus in der kommenden kalten Jahreszeit bewusst. Sie kennen die Art der Infektion und schützen sich davor, so gut dies möglich ist. Operationalisiertes Lernziel 1: Die SuS nennen die drei Hauptbestandteile von Viren mit Hilfe eines Modells auswendig. Operationalisiertes Lernziel 2: Die SuS können die Infektionsart sowie die sechs Phasen des Vermehrungszyklus von Grippeviren mit Hilfe von Skizzen in je einem selbst formulierten Satz pro Bild erklären. Zentrale Fragen: Aus welchen Bestandteilen besteht ein Virus? Welche Phasen durchläuft ein Grippevirus um sich zu vermehren? Material Medien: Wandtafel, Hellraumprojektor, 1 gesundes Blatt, 1 krankes Blatt, zerkleinertes Blattmaterial, Chlorophyll Lösung, Sieb, filtrierte Lösung, Haushaltpapier, 23 Kopien Arbeitsblatt (Vermehrungszyklus von Grippeviren) mit Fragen, 23 Kopien Arbeitsblatt mit Skizzen, 1 Tennisball präpariert, Schnur, 1 Tennisball intakt, 1 Kiste Planungsziele, Handlung, Lehrinhalt, fachliche Angaben, Lehrver fahren, Prozesse Fakten, Daten Sozialform 2 IU Thema und Ziele der Lektion bekannt geben Plenum Wandtafel 10 Wie wurden Viren entdeckt? Experiment von Iwanowski und Beijering gesundes und krankes Blatt zeigen krankes Blatt zerkleinern (vorbereitet) Blattfragmente zermörsern, damit die Chloroplasten sich im Wasser lösen (vorbereitet) Lösung durch ein Haushaltpapier geben und auf gesundes Blatt streichen (vorzeigen) Blatt wird krank Lösung durch einen Bakterienfilter geben (nur theoretisch) und auf gesundes Blatt streichen Blatt wird immer noch krank Viren sind kleiner als Bakterien Plenum SuS kommen nach vorne gesundes Blatt krankes Blatt zerkleinertes Blattmaterial Chlorophyll Lösung Sieb filtrierte Lösung Haushalt papier 5 Lehrervortrag: Vergleich einer tierischen Zelle mit einem Virus Schulzimmer: tierische Zelle grosse Schachtel: Bakterienzelle Lehrerpult: Zellkern Personen: Zellbestandteile wie Mitochondrien, Ribosomen, Proteine Virus: Tennisball Schnur: virales Erbmaterial Das Virus besteht aus einem Proteinmantel mit Virusproteinen und eingeschlossenem Erbgut Viren benötigen Wirtszellen Stoffwechsel der Wirtszelle wird auf Bedürfnisse des Virus umgestellt Wirtszelle produziert Proteine und Erbsubstanz des Virus zahlreiche neue Viren entstehen exponentielles Wachstum der Anzahl Viren Plenum SuS wieder am Platz Tennisbälle und Schnur als Modell 5 Repetition: Kennzeichen der Lebewesen mit dem Banknachbarn die 6 Merkmale zu erinnern versuchen und stichwortartig aufschreiben Körpergestalt und Wachstum Stoffwechsel Bewegung aus eigener Kraft Reizbarkeit und Verhalten Fortpflanzung und Entwicklung Partnerarbeit Buch, Heft Zei ev. Buch S. 10 und 11 zu Hilfe nehmen Material, Medien Aufbau aus Zellen 1 Sind Viren Lebewesen? Aufgrund der 6 Kennzeichen sind Viren keine Lebewesen Plenum 2 Einführung in das Arbeitsblatt (Vermehrungszyklus von Grippeviren) Arbeit alleine oder zu zweit zuerst die Aufgabe 1 lösen Plenum Arbeitsblatt, 23 Kopien 10 Aufgabe 1 lösen Zeitlimite geben und einhalten Aufgaben 2, 3 und 4 als Zusatz (wenn die Zeit reicht) Einzelarbeit oder Partnerarbeit Arbeitsblatt 5 Besprechung der Aufgabe 1 Bei Bedarf Lösungen als Folie auflegen Plenum Folie mit Lösungen Fazit Noch einmal auf die Lernziele am Anfang Bezug nehmen Plenum Wandtafel Grippe – Eine Viruserkrankung Die Grippe Die Grippe geht um. Mit Husten, Schnupfen, Augentränen und Mattigkeit beginnt sich eine Grippe bemerkbar zu machen. Starkes Fieber, Schüttelfrost, Kopf und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit und Müdigkeit folgen. Nach einigen Tagen lassen die Beschwerden zwar nach, trotzdem fühlt man sich noch schwach und ist nicht voll leistungsfähig. Durch Husten oder Sprechen gelangen die Erreger der Grippe mit ganz kleinen Flüssigkeitströpfchen in die Luft. Mitmenschen atmen die Krankheitserreger mit der Luft ein. Sie haben sich angesteckt (Tröpfcheninfektion). Die Infektion wird zunächst gar nicht bemerkt. Nach mehreren Stunden, oft auch erst bis zu vier Tage später, treten die oben beschriebenen Anzeichen der Krankheit, die Symptome, auf. Die Zeit von der Infektion bis zum Ausbruch der Krankheit und dem ersten Auftreten der Symptome heisst Inkubationszeit. Besonders gross ist die Infektionsgefahr dort, wo viele Menschen in engem Kontakt untereinander stehen, beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Märkten, in Kinos oder Schulen. Auch das Wartezimmer des Arztes ist während einer Grippewelle ein Ort besonderer Infektionsgefahr. Zu den allgemeinen Massnahmen der Infektionsverhütung gehören daher alle Schritte die den Kontakt mit Infektionsquellen verringern. Die Grippe verbreitet sich während einer bestimmten Jahreszeit wie eine Seuche. Über die Tröpfcheninfektion werden viele Menschen infiziert. Man spricht daher auch von einer Grippeepidemie. Nach zwei bis drei Monaten ebbt die Grippewelle langsam wieder ab. Lange nahm man an, dass auch die Grippe von Bakterien ausgelöst wird. Man musste aber feststellen, dass mit Antibiotika diese Krankheit nicht zu bekämpfen war, höchstens einige Symptome konnten abgeschwächt werden. Der Grippeerreger kann also kein Bakterium sein. Der Erreger ist ein Virus, das sich in Aufbau und Wirkung von den Bakterien unterscheidet. Das Grippevirus befällt vor allem die Zellen der Schleimhäute von Nase und Bronchien. Dies erscheint zunächst harmlos. In der Folge können aber bakterielle Krankheitserreger leichter in die geschädigten Gewebe eindringen. Man spricht in solchen Fällen von Sekundärinfektionen. So ist die häufigste Todesursache im Verlauf einer Grippeerkrankung eine anschliessende Lungenentzündung, die durch Bakterien hervorgerufen wird. Gegen bakterielle Sekundärinfektionen kann der Arzt Medikamente wie Antibiotika verschreiben. Sie wirken jedoch nicht gegen die Viren. Vermehrungszyklus der Grippeviren Grippeviren vermehren sich innerhalb von Wirtszellen. Sie bestehen aus Erbgut, einer Hülle und zahlreichen Virusproteinen. Damit die Viren in das Innere einer Zelle eindringen können, benutzen sie eine spezielle Strategie. Als erstes dockt das Grippevirus mit seinen zahlreichen Virusproteinen an die Membran der Wirtszelle an. Die virale Hülle verschmilzt anschliessend mit der Zellmembran und entlässt das Erbgut in den Zellkörper. Das Erbmaterial gelangt darauf ins Innere des Zellkerns wo es einerseits kopiert und andererseits umgeschrieben wird. Aus den kopierten Anteilen entsteht Erbmaterial für weitere Viren, währenddem die umgeschriebenen Anteile zu neuen Virusproteinen verarbeitet werden. Die neuen Virusproteine werden in die Membran der Wirtszelle eingebaut und Tochterviren beginnen sich aus der Zelle zu knospen. Schliesslich werden die Tochterviren freigesetzt und können ihrerseits neue Wirtszellen infizieren. Aufgaben 1. Auf dem beiliegenden Blatt finden Sie eine Darstellung des Vermehrungszyklus von Grippeviren. Schneiden Sie diese Bilder aus und setzen Sie aufgrund des gelesenen Textes die Bilder in die richtige Reihenfolge. Formulieren Sie zu jedem Bild einen vollständigen Satz der möglichst exakt beschreibt, was auf dem Bild geschieht oder zu sehen ist. Kleben Sie die Bilder ins Heft und schreiben Sie Ihren formulierten Satz darunter. 2. Beschreiben Sie ein Beispiel, wo und wie man sich mit Grippeviren infizieren kann. 3. Erklären Sie, weshalb zwischen Ansteckung und Ausbruch einer Krankheit mehrere Tage vergehen können. 4. Wie unterscheiden sich Bakterien und Viren voneinander? Vermehrungszyklus von Grippeviren Vermehrungszyklus von Grippeviren – Lösung Aufgabe 1 Ein Virus besteht aus Erbgut und einer Hülle mit zahlreichen Virusproteinen. Das Virus dockt mit seinen Virusproteinen an eine Wirtszelle an. Die virale Hülle verschmilzt mit der Das Viruserbgut wird kopiert und zu Zellmembran der Wirtszelle und das neuen Virusproteinen verarbeitet. Erbmaterial dringt in den Zellkern ein. Die neuen Virusproteine werden in die Zellmembran eingebaut und Tochterviren beginnen sich abzuknospen. Die Tochterviren werden freigesetzt und können neue Wirtszellen infizieren. Aufgabe 2 Die Ansteckungsgefahr ist überall dort besonders gross, wo sich viele Menschen aufhalten. Die Ansteckung erfolgt über Tröpfchen, die beim sprechen oder husten in die Luft gelangen und von anderen Menschen eingeatmet werden. Aufgabe 3 Die Immunabwehr des Körpers wird anfangs mit noch wenigen Erregern fertig. Die Vermehrung der Erreger im Körper benötigt Zeit. Erst wenn die Erreger in einer so hohen Konzentration vorkommen, dass das Immunsystem überfordert ist, bricht die Krankheit aus. Aufgabe 4 Bakterien sind Einzeller. Ihre Zellen haben eine Zellwand und Zellplasma. Ausserdem haben Bakterien einen eigenen Stoffwechsel. Bakterien pflanzen sich durch Spaltung fort. Viren sind nicht aus einer Zelle aufgebaut. Sie sind lediglich von einer Proteinhülle umgebene GenFäden (DNA). Sie benutzen zur Vermehrung Wirtszellen, die Proteine für die Viren aufbauen. Viren sind 10 mal kleiner als Bakterien.