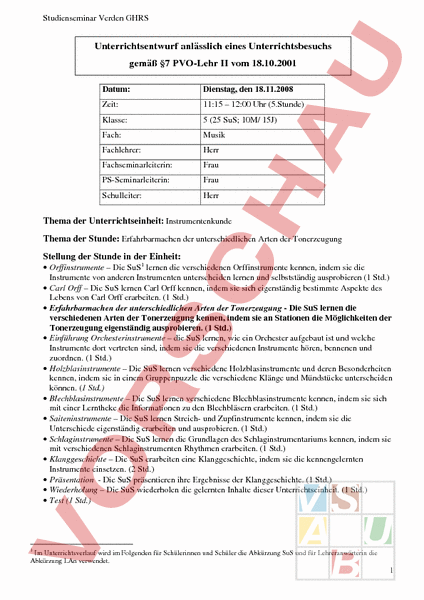Arbeitsblatt: Tonentstehung
Material-Details
Hierbei handelt es sich um eine Stationsarbeit zum Thema Tonentstehung. (Seitenklinger, Fellklinger, Selbstklinger und Luftklinger)
Musik
Musiktheorie / Noten
5. Schuljahr
16 Seiten
Statistik
40476
1130
13
24.05.2009
Autor/in
Catharina Bock
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Studienseminar Verden GHRS Unterrichtsentwurf anlässlich eines Unterrichtsbesuchs gemäß §7 PVO-Lehr II vom 18.10.2001 Datum: Dienstag, den 18.11.2008 Zeit: 11:15 – 12:00 Uhr (5.Stunde) Klasse: 5 (25 SuS; 10M/ 15J) Fach: Musik Fachlehrer: Herr Fachseminarleiterin: Frau PS-Seminarleiterin: Frau Schulleiter: Herr Thema der Unterrichtseinheit: Instrumentenkunde Thema der Stunde: Erfahrbarmachen der unterschiedlichen Arten der Tonerzeugung Stellung der Stunde in der Einheit: • Orffinstrumente – Die SuS1 lernen die verschiedenen Orffinstrumente kennen, indem sie die Instrumente von anderen Instrumenten unterscheiden lernen und selbstständig ausprobieren (1 Std.) • Carl Orff – Die SuS lernen Carl Orff kennen, indem sie sich eigenständig bestimmte Aspekte des Lebens von Carl Orff erarbeiten. (1 Std.) • Erfahrbarmachen der unterschiedlichen Arten der Tonerzeugung Die SuS lernen die verschiedenen Arten der Tonerzeugung kennen, indem sie an Stationen die Möglichkeiten der Tonerzeugung eigenständig ausprobieren. (1 Std.) • Einführung Orchesterinstrumente – die SuS lernen, wie ein Orchester aufgebaut ist und welche Instrumente dort vertreten sind, indem sie die verschiedenen Instrumente hören, bennenen und zuordnen. (1 Std.) • Holzblasinstrumente – Die SuS lernen verschiedene Holzblasinstrumente und deren Besonderheiten kennen, indem sie in einem Gruppenpuzzle die verschiedene Klänge und Mündstücke unterscheiden können. (1 Std.) • Blechblasinstrumente – Die SuS lernen verschiedene Blechblasinstrumente kennen, indem sie sich mit einer Lerntheke die Informationen zu den Blechbläsern erarbeiten. (1 Std.) • Saiteninstrumente – Die SuS lernen Streich- und Zupfinstrumente kennen, indem sie die Unterschiede eigenständig erarbeiten und ausprobieren. (1 Std.) • Schlaginstrumente – Die SuS lernen die Grundlagen des Schlaginstrumentariums kennen, indem sie mit verschiedenen Schlaginstrumenten Rhythmen erarbeiten. (1 Std.) • Klanggeschichte – Die SuS erarbeiten eine Klanggeschichte, indem sie die kennengelernten Instrumente einsetzen. (2 Std.) • Präsentation Die SuS präsentieren ihre Ergebnisse der Klanggeschichte. (1 Std.) • Wiederholung – Die SuS wiederholen die gelernten Inhalte dieser Unterrichtseinheit. (1 Std.) • Test (1 Std.) 1 Im Unterrichtsverlauf wird im Folgenden für Schülerinnen und Schüler die Abkürzung SuS und für Lehreranwärterin die Abkürzung LAn verwendet. 1 2. Zielformulierungen Grobziel: Die Schülerinnen und Schüler lernen die verschiedenen Arten der Tonerzeugung kennen, indem sie an Stationen die Möglichkeiten der Tonerzeugung eigenständig ausprobieren Feinziele: 1. Fachliche Ziele: Die Schülerinnen und Schüler sollen: • über Kenntnisse und Fachbegriffe der elementaren Musiklehre verfügen, indem sie die verschiedenen Arten der Tonzeugung (mit Fachbegriffen nennen und Instrumenten zuordnen können).2 • musikalische Grundprinzipien sensomotorisch erfassen können, indem sie an den Stationen handlungsorientiert die Arten der Tonerzeugung erfahren.3 • Wissen über Klangerzeuger besitzen (und Instrumente systematisieren, indem sie die gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse auf gebräuchliche Musikinstrumente hinsichtlich der Tonerzeugung übertragenen).4 2. Fächerübergreifende Ziele5: Die Schülerinnen und Schüler sollen: • ihre Sozialkompetenz verbessern, indem sie in Gruppen arbeiten und somit ihre Kooperationsfähigkeit, sowie ihre Kommunikationsfähigkeit weiter entwickeln. • ihre Methodenkompetenz und Selbstständigkeit weiterentwickeln, indem sie Arbeitsanweisungen verstehen und umsetzen müssen und ihre Ergebnisse vor der Klasse präsentieren.6 • ihre Eigeninitiative und Selbstkompetenz schulen, indem sie die Aufgaben eigenständig bearbeiten. • Verantwortung für andere und für das System übernehmen, indem sie sich an die vereinbarten Regeln und Absprachen halten. 2 Niedersächsisches Kultusministerium, 2004, S. 6 (Kompetenzbereich „Musik wahrnehmen und verstehen (B5)). Dieses Ziel ist nur dann zu erreichen, wenn am Ende der Stunde verschiedene Instrumente der Tonerzeugung zugeordnet werden. 3 Niedersächsisches Kultusministerium, 2004, S. 6 (Kompetenzbereich „Musik umsetzen (C12)) 4 Niedersächsisches Kultusministerium, 2004, S. 6 (Kompetenzbereich „Musik wahrnehmen und verstehen (B5) und Themenbereich Instrumentenkunde). Dieses Ziel ist nur dann zu erreichen, wenn am Ende der Stunde verschiedene Instrumente der Tonerzeugung zugeordnet werden. 5 Diese Ziele sind prozessual zu verstehen. 6 Es handelt sich hierbei nicht um das Präsentieren eines Produktes, sondern um die erarbeiteten Lösungen bzw. Lösungsvorschläge aus der Gruppenarbeit. Die Methodenkompetenz des Präsentierens erreichen nicht alle SuS in dieser Stunde, da nur einige SuS ihre Ergebnisse vortragen. 2 3. Verlaufsplan Zeit Unterrichtsphase Lehrer-SchülerInteraktion Arbeits-/ Sozial-/ Organisations-/ und Unterrichtsform 11:15 Begrüßung AF: Begrüßung • SuS und LAn begrüßen einander und den Besuch. SF: Klassenunterricht OF: Sitzordnung an 11:17 Gruppentischen UF: darbietend 11:18 Einstieg und Hinführung AF: Demonstration/ • Die LAn nimmt ein Lineal und lässt es auf der Unterrichtsgespräch 11:24 Tischkante schwingen, so dass ein Ton entsteht. SF: Frontalunterricht Einzelarbeit • Die LAn wiederholt diesen Vorgang 2-3 Mal. OF: Sitzordnung an • Die LAn fragt die SuS was sie hören und sehen Gruppentischen und was wohl passiert, wenn sie das Lineal UF: erarbeitend/ berührt. darbietend • Die SuS nennen den Ton, sowie die Bewegung (Schwingung) des Lineals und dass sie nichts mehr hören, wenn man das Lineal berührt. • Die SuS sollen das eben besprochene jeder selbst ausprobieren. • Die LAn sagt den SuS, dass sie nun bei dem Lineal gesehen haben, wie wir einen Ton entstehen lassen konnten. Die SuS sollen nun versuchen, wie bei anderen Gegenständen der Ton ensteht. • Die LAn erklärt den Ablauf der Stationsarbeit • Die LAn hängt das Gruppenarbeitssymbol an die Tafel • Die SuS finden sich in ihren Gruppen zusammen und bestimmen einen Materialholer, sowie einen Zeitwächter. Medien/ Arbeitsmaterial Lineal(e) Didaktisch-methodischer Kommentar • Die LAn wählt den Einstieg über die Demonstration und anschließendes selber machen, weil dadurch das Unterrichtsthema sinnlich erfassbar und anschaulich-konkret wird und um die SuS auf das Thema der Stunde einzustimmen, sowie eine gemeinsame Voraussetzung für die kommende Stationsarbeit zu schaffen. • Die LAn wiederholt den Vorgang des Vormachens 2-3 mal, damit alle SuS die Demonstration nachvollziehen können, da er Effekt nur jeweils wenige Sekunden anhält. • Die LAn erklärt den Ablauf der Stationsarbeit, damit die kommende Unterrichtsphase reibungslos, ohne Missverständnisse bezüglich der Reihenfolge o.ä. abläuft. • Die LAn lässt ein oder zwei SuS den Ablauf der Stationsarbeit wiederholen, um sicher zu sein, dass die SuS sich des Ablaufs bewusst sind. • Die LAn erläutert den Arbeitsauftrag der einzelnen Stationen nicht mündlich, da die SuS sich nicht die Arbeitsaufträge von vier verschiedenen Stationen merken könnten. • Die LAn hängt das Symbol für Gruppenarbeit an die Tafel, da die SuS wissen, dass sie während dieses Symols mit den anderen SuS kommunizieren dürfen, aber nur leise. Die LAn hat so die Möglichkeit, wenn es zu laut wird, stumm auf das Symbol zu verweisen, da den SuS dieses Symbol ritualisiert ist. • Die LAn hat für die Erarbeitung dieses Unterrichtsinhaltes die Form der Stationsarbeit gewählt, da die SuS hiermit das Phänomen der Tonentstehung (und ggf. Tonhöhen) selbstständig erarbeiten und jeder SuS beteiligt ist. Eine arbeitsteilige Gruppenarbeit hätte sich in diesem Fall nicht angeboten, weil dadurch den jeweils anderen SuS die Tonentstehung nur erläutert werden kann, sie diese aber nicht handelnd nachvollziehen können. • Die 8 Gruppen wurden von der LAn festgelegt, damit leistungsstärkere und leistungsschwächere SuS, sowie SuS mit mehr oder weniger musikalischen Vorkenntnissen zusammenarbeiten um sich gegenseitig helfen zu können. Eine der acht Gruppen ist eine leistungshomogene Gruppe, da drei Schüler der Klasse oft Konzentrationsschwierigkeiten haben und leistungsschwach sind, sowie sich oft aus Gruppenarbeiten herausnehmen. Diese Gruppe soll von ein oder zwei Seminarteilnehmern betreut werden, um sicher zu gehen, dass sie die Aufgaben richtig ausführen. • Jede Gruppe bestimmt einen „Materialholer, damit nicht jeder SuS aufsteht und durch die Klasse läuft um sich den Laufzettel zu holen. Dadurch kann Zeit gespart und Unruhe vermieden werden. • Jede Gruppe bestimmt einen Zeitwächter, der dafür verantwortlich ist, dass die Aufgabe in der vorgegebenen Zeit erfüllt wird. Die SuS lernen somit eigenverantwortlich zu 3 entscheiden und ihre Arbeitsweisen zeitlich zu planen und zu strukturieren. • Die Stationen sind alle doppelt vorhanden, damit die Gruppengröße von drei (bzw. eine Vierergruppe) nicht überschritten wird. Somit erhalten alle SuS die Gelegeheit aktiv an den Stationen mitzuarbeiten. • Die Arbeitsblätter mit den Arbeitsaufträgen liegen immer an der jeweiligen Station, damit die SuS nicht von Beginn an mit 4 Zetteln hantieren müssen, sondern immer eindeutig ist, welches Arbeitsblatt zu welcher Station gehört. • Während der beiden Arbeitsphasen besteht die Aufgabe der LAn darin, SuS für Rückfragen zur Verfügung zu stehen und vor allem einige SuS in ihrer Arbeitsphase zu beobachten, um zu sehen, wie sich die SuS einbringen und beteiligen. So kann ein differenziertes Bild von den SuS entstehen. • Die LAn beendet die einzelnen Arbeitsphasen, sowie das Ende der Stationsarbeit durch ein akustisches Signal, welches bereits ritualisiert ist, um die Arbeitsphase nicht verbal beenden zu müssen. Somit müssen die SuS ihre Arbeiten nicht sofort beenden, sondern können ihre letzten Überlegungen zuende bringen. Außerdem wird der Sprechanteil der LAn gering gehalten. AF: Unterrichtsgespräch Tafel Sicherung Präsentation • Die Schüler bilden auf Grund eines stummen Impulses einen Stuhlkreis, damit zum Kreide • Die LAn zeichnet einen Halbkreis mit einem Stuhl SF: Klassenunterricht einen der Sprechanteil der LAn gering gehalten wird und die SuS sich nicht nur auf Folie mit Merksatz aktustische Signale verlassen und sich zum anderen alle SuS ansehen können, wenn die an die Tafel. Die SuS bilden einen Stuhlhalbkreis. OF: Stuhlkreis UF: darstellend/ Overheadprojektor Ergebnisse besprochen werden, so dass sich ein interaktiveres Unterrichtsgespräch • Die LAn legt die Folie mit dem Merksatz auf, erklärend/ Bilder von aufbauen kann. Außerdem ist es für die gegebenenfalls stattfindende Aufgabe des sowie die passenden Elemente für die Lücken erarbeitend Instrumenten Sortierens eine geeignete Organisationsform, da alle SuS die Bilder erkennen und unsortiert daneben. (siehe Anhang) zuordnen können. • Die SuS ordnen die Begriffe den entsprechenden Arbeitsblätter der • Die Ergebnisse der SuS werden besprochen, um ihre Arbeit aus der Stationsarbeit zu Lücken zu. SuS würdigen oder auch zu korrigieren und ein gemeinsames Ergebnis zu haben. • Die LAn fragt, wie denn der Ton an den einzelnen • Die SuS sollen die Bilder mit Instrumenten der jeweiligen Tonerzeugung zuordnen, um Stationen entstanden ist ihr gelerntes Wissen anzuwenden und auf reale Gegenstände zu übertragen. • Die SuS nennen die verschiedenen Tonerzeugungen. • Die LAn fragt, wie das bei dem Lineal war und zu welcher Station man es zuordnen könnte. • Nachdem die SuS die vier verschiedenen Möglichkeiten der Tonerzeugung genannt haben bilden die SuS einen Stuhlkreis • Die LAn legt Abbildungen von Instrumenten in die Mitte und fragt die SuS, wie man diese ordnen könnte. • Die SuS ordnen die Instrumente nach den verschiedenen Möglichkeiten der Tonerzeugung AF: Lehrervortrag Verabschiedung: • Die LAn lobt die SuS gegebenenfalls, um ihnen ein positives Feedback zu geben, wenn SF: Klassenunterricht die Arbeitshaltung der Stunde erfreulich war, so dass die SuS ihr Verhalten einordnen • Die LAn verabschiedet sich von den SuS, lobt OF: Stuhlkreis können. diese ggf. für ihre Mitarbeit und gibt einen UF: darbietend Ausblick auf die nächste Stunde. • Die LAn verabschiedet die SuS und gibt einen Ausblick auf die nächste Musikstunde, um den Unterrichtsinhalt für die SuS transparent zu machen. 11:25 Erarbeitungsphase • Die LAn gibt den Materialholern den jeweiligen 11:48 Laufzettel • Die SuS beginnen an ihrer jeweiligen Station • Die LAn schlägt immer nach 5 Minuten die Klangschale und die SuS wechseln rotierend die Stationen • Die LAn wird in diese Arbeitsphase beobachten, wie die SuS in ihren Gruppen arbeiten. Da ein oder zwei Seminarteilnehmer die Gruppe mit den leistungsschwachen SuS betreuen soll, kann die LAn sich auf die leistungsstärkeren SuS konzentrieren, um zu sehen, wie sie zu den Lösungen gelangen. 11:49 11:58 11:59 12:00 AF: Holen der Materialien und arbeiten an den Stationen SF: Gruppenarbeit OF: Arbeit an den Stationen UF: erarbeitend Laufzettel Klangschale Plastikkiste Gummibänder leere Flasche Daunenfedern Stimmgabel Schüssel mit Wasser Papierkügelchen Congas Arbeitsblätter (siehe Anhang) Zeitplus: Die Erarbeitungsphase wird erweitert, indem die SuS zusätzlich zur Tonentstehung auch die Tonhöhe berücksichtigen sollen. Zeitminus: Die Sicherungsphase wird verkürzt, indem die SuS nur ihre Ergebnisse „präsentieren und die Zuordnung einzelner Instrumente in die jewelige Gruppe in der nächsten Stund erfolgt. 4 4. Literaturangaben Aust, Gabriele/ Engel, Walther/ Hartmann, Silke/ u.a. (Hrsg.): Soundcheck 1; Braunschweig 1999. Greving, Johannes/ Paradies, Liane: Unterrichts-Einstiege, Ein Studien- und Praxisbuch, Berlin 1996. Hesselink-Grötzbach, Marita: Zur Problematik von Zielformulierungen oder über die Transparenz der Formulierungen von Schülerkompetenzen. Unveröffentlicht 2005. Kemmelmeyer, Karl-Jürgen/ Nykrin, Rudolf/ Lang, Otmar/ u.a. (Hrsg.): Spielpläne 1; Leipzig 2003. Lugert, Wulf Dieter/ Küntzel, Bettina/ Krettenauer, Thomas (Hrsg.): Amadeus 1; Oldershausen 2001. Meyer, Hilber: Was ist guter Unterricht? Cornelsen, Berlin 2004. Niedersächisches Kulutusministerium (Hrsg.): Curriculare Vorgaben für die Realschule, Schuljahrgänge 5/6, Musik, Hannover 2004. Schulinterner Arbeitsplan der Beeke-Schule (HRS Scheeßel) für das Fach Musik, Neufassung Januar 2007; aktualisiert 1.11.2007. Studienseminar Verden: Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung, 2007. 5. Anhang I. Kommentierter Sitzplan II. Gruppeneinteilung III. Schülerfotos IV. Laufzettel für die Gruppen V. Arbeitsblätter (mit Musterlösungen) VI. Merksatz für die Sicherungsphase (mit Lösungen) VII. Gruppenarbeitssymbol VIII. Bilder für die Sicherungsphase 5 6 Station 1: Stimmgabel 1. Schlage die Stimmgabel mit dem Schlägel an! Was hörst du? 2. Schlage die Stimmgabel nochmal an! Beobachte die Spitze an der Stimmgabel und berühre die Stimmgabel ganz vorsichtig! Was siehst du und was fühlst du? Gruppe 1 Reihenfolge: Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Gruppe 3 Reihenfolge: Station 3 Station 4 Station 1 Station 2 Gruppe 5 Reihenfolge: Station 5 Station 6 Station 7 Station 8 Gruppe 7 Reihenfolge: Station 7 Station 8 Station 5 Station 6 Gruppe 2 Reihenfolge: Station 2 Station 3 Station 4 Station 1 Gruppe 4 Reihenfolge Station 4 Station 1 Station 2 Station 3 Gruppe 6 Reihenfolge: Station 6 Station 7 Station 8 Station 5 Gruppe 8 Reihenfolge: Station 8 Station 5 Station 6 Station 7 7 3. Schlage die Stimmgabel nochmal an und halte einen Finger schnell vorne gegen die Stimmgabel! Was passiert? 4. Schlage die Stimmgabel nun nochmal an und tauche sie dann ganz vorsichtig in die Schüssel mit Wasser! Was siehst du? Suche eine Begründung! Station 2: Gummibänder 1. Spanne ein Gummiband zwischen Daumen und Zeigefinger und zupfe es! Was siehst du? Was hörst du? 8 2. Spanne jetzt ein Gummiband über die Kiste und zupfe es! Was ist anders als bei Aufgabe 1? 3. Zupfe das Gummiband nochmal und halte dann einen Finger fest darauf! Was passiert? Spanne Gummibänder, die unterschiedlich groß sind über die Kiste und zupfe sie! Was hörst du? Fülle die Lücken: Je lockerer die Gummibänder gespannt sind, desto klingt der Ton. Je fester die Gummibänder gespannt sind, desto klingt der Ton. Station 4: Congas/ Bongos 1. Lege die Papierkügelchen auf die Congas und schlage vorsichtig auf das Fell! Was hörst du?(Ich höre einen Ton (o.ä.))_ Was siehst du?(Die Papierkügelchen fliegen in die Luft) 9 2. Suche eine Begründung!(Immer wenn ein Ton/ ein Klang erzeugt wird, wird etwas in Bewegung versetzt. Bei den Congas wird das Fell in Bewegung versetzt. Deswegen fliegen die Papierkügelchen in die Luft) Überlege was passiert, wenn du schwerere Gegenstände auf die Congas legst und auf das Fell schlägst! (Diese Gegenstände fliegen auch (oder nicht) in die Luft)_ Probiere es als erstes mit Büroklammern und dann mit Centstücken! Was fällt dir auf?(Beides fliegt in die Luft, wenn man auf die Congas schlägt)_ Station 3: Flasche 1. Nimm die Flasche mit der Feder darin und versuche durch Anblasen einen Ton zu erzeugen! Was hörst du? (Ich höre einen Ton) Was siehst du? 10 (Die Feder wirbelt in der Flasche herum)_ 2. Suche eine Begründung! (Wenn man durch blasen/ pusten einen Ton erzeugt ist es die Luft, die in Bewegung gebracht wird. Deswegen wirbelt die Feder in der Flasche herum) Gehe jetzt zu dem Waschbecken. Hier steht eine andere Flasche. Stelle eine Vermutung an, was du hörst, wenn du langsam Wasser in die Flasche tropfen lässt.(Der Ton verändert sich/ verändert sich nicht) Jetzt lass das Wasser langsam hineintropfen. Was hörst du, wenn die Flasche voller wird?(Der Ton wird höher)_ Fülle die Lücken: Je kürzer die Luftsäule, desto (höher) der Ton. Je länger die Luftsäule, desto (tiefer) der Ton. 11 VI. Arbeitsblätter für Gruppe 1 Station 1: Stimmgabel 1. Schlage die Stimmgabel mit dem Schlägel an! Was siehst und und was hörst du?(Einen Ton)_ 2. Schlage die Stimmgabel nochmal an und halte einen Finger schnell gegen die Stimmgabel! Was passiert?(Der Ton verstummt sofort)_ 3. Schlage die Stimmgabel nun nochmal und tauche sie dann ganz vorsichtig in die Schüssel mit Wasser! Was siehst du? (In dem Wasser bilden sich leichte Wellen)_ Suche eine Begründung!(Wenn ein Ton entsteht, wird immer etwas in Schwingungen versetzt. Hier sind die Schwingungen so minimal, dass man sie nur im Wasser als Wellen sehen kann) 12 Station 2: Gummibänder 1. Spanne ein Gummiband zwischen Daumen und Zeigefinger und zupfe es! Was siehst du?(Das Gummiband bewegt sich zittert/ vibriert) Was hörst du? (Ich höre einen Ton ein Geräusch/ einen Klang)_ 2. Spanne jetzt ein Gummiband über die Kiste und zupfe es! Was ist anders als bei Aufgabe 1?(Der Ton (o.ä.) ist lauter)_ 3. Zupfe das Gummiband nochmal und halte dann einen Finger fest darauf! Was passiert?(Das Gummiband bewegt sich nicht mehr und man hört nichts mehr) 13 Station 4: Congas/ Bongos 1. Lege die Büroklammern auf die Congas und schlage vorischtig auf das Fell! Was hörst du?(Ich höre einen Ton (o.ä.))_ Was siehst du?(Die Papierkügelchen fliegen in die Luft) 2. Suche eine Begründung!(Immer wenn ein Ton/ ein Klang erzeugt wird, wird etwas in Bewegung versetzt. Bei den Congas wird das Fell in Bewegung versetzt. Deswegen fliegen die Papierkügelchen in die Luft) Überlege was passiert, wenn du schwerere Gegenstände auf die Congas legst und auf das Fell schlägst! (Diese Gegenstände fliegen auch (oder nicht) in die Luft)_ Probiere es mit Centstücken! Was fällt dir auf?(Sie fliegen in die Luft, wenn man auf die Congas schlägt)_ 14 Station 3: Flasche 1. Nimm die Flasche mit der Feder darin und versuche durch Anblasen einen Ton zu erzeugen! Was hörst du? (Ich höre einen Ton) Was siehst du? (Die Feder wirbelt in der Flasche herum)_ 2. Suche eine Begründung! (Wenn man durch blasen/ pusten einen Ton erzeugt ist es die Luft, die in Bewegung gebracht wird. Deswegen wirbelt die Feder in der Flasche herum) 15 VI. Satz für die Sicherungsphase (mit Lösungen) Merksatz: Alle Gegenstände(bewegen sich/ zittern/ schwingen)_, wenn sie einen Ton erzeugen. Stoppt man die Bewegung, so (hört man nichts mehr) Das schnelle Zittern nennt man auch(schwingen) (so wie bei einer Schaukel, aber viel schneller!) Der Grund, warum wir einen Ton hören ist also, dass immer etwas in(Schwingungen)_ versetzt wird. VII. Gruppenarbeitssymbol 16