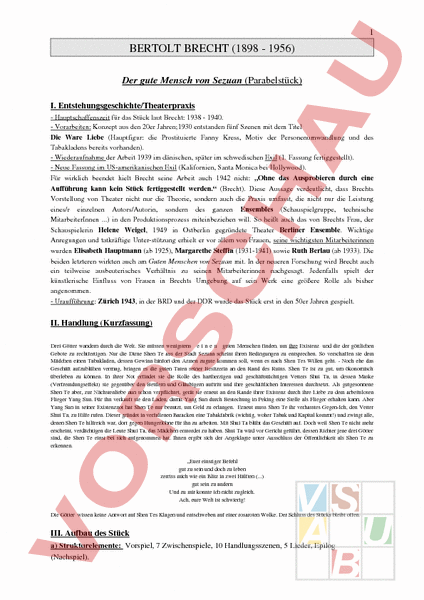Arbeitsblatt: Brecht "Der gute Mensch von Sezuan" und Lyrik Brechts
Material-Details
Merkblatt zu "Der gute Mensch von Sezuan" sowie zu den Kennzeichen von Brechts Lyrik sowie denen der Neuen Sachlichkeit und Prosagedichten im Allgemeinen;
Deutsch
Leseförderung / Literatur
12. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
40911
2537
22
02.06.2009
Autor/in
Martina Frick
Land: Österreich
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
1 BERTOLT BRECHT (1898 1956) Der gute Mensch von Sezuan (Parabelstück) I. Entstehungsgeschichte/Theaterpraxis Hauptschaffenszeit für das Stück laut Brecht: 1938 1940. Vorarbeiten: Konzept aus den 20er Jahren;1930 entstanden fünf Szenen mit dem Titel Die Ware Liebe (Hauptfigur: die Prostituierte Fanny Kress, Motiv der Personenumwandlung und des Tabakladens bereits vorhanden). Wiederaufnahme der Arbeit 1939 im dänischen, später im schwedischen Exil (1. Fassung fertiggestellt). Neue Fassung im USamerikanischen Exil (Kalifornien, Santa Monica bei Hollywood). Für wirklich beendet hielt Brecht seine Arbeit auch 1942 nicht: „Ohne das Ausprobieren durch eine Aufführung kann kein Stück fertiggestellt werden. (Brecht). Diese Aussage verdeutlicht, dass Brechts Vorstellung von Theater nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis umfasst, die nicht nur die Leistung eines/r einzelnen Autors/Autorin, sondern des ganzen Ensembles (Schauspielgruppe, technische MitarbeiterInnen .) in den Produktionsprozess miteinbeziehen will. So heißt auch das von Brechts Frau, der Schauspielerin Helene Weigel, 1949 in Ostberlin gegründete Theater Berliner Ensemble. Wichtige Anregungen und tatkräftige Unterstützung erhielt er vor allem von Frauen, seine wichtigsten Mitarbeiterinnen wurden Elisabeth Hauptmann (ab 1925), Margarethe Steffin (19311941) sowie Ruth Berlau (ab 1933). Die beiden letzteren wirkten auch am Guten Menschen von Sezuan mit. In der neueren Forschung wird Brecht auch ein teilweise ausbeuterisches Verhältnis zu seinen Mitarbeiterinnen nachgesagt. Jedenfalls spielt der künstlerische Einfluss von Frauen in Brechts Umgebung auf sein Werk eine größere Rolle als bisher angenommen. Uraufführung: Zürich 1943, in der BRD und der DDR wurde das Stück erst in den 50er Jahren gespielt. II. Handlung (Kurzfassung) Drei Götter wandern durch die Welt. Sie müssen wenigstens i e guten Menschen finden, um ihre Existenz und die der göttlichen Gebote zu rechtfertigen. Nur die Dirne Shen Te aus der Stadt Sezuan scheint ihren Bedingungen zu entsprechen. So verschaffen sie dem Mädchen einen Tabakladen, dessen Gewinn hinfort den Armen zugute kommen soll, wenn es nach Shen Tes Willen geht. Noch ehe das Geschäft aufzublühen vermag, bringen es die guten Taten seiner Besitzerin an den Rand des Ruins. Shen Te ist zu gut, um ökonomisch überleben zu können. In ihrer Not erfindet sie die Rolle des hartherzigen und geschäftstüchtigen Vetters Shui Ta, in dessen Maske (Verfremdungseffekt) sie gegenüber den Bettlern und Gläubigern auftritt und ihre geschäftlichen Interessen durchsetzt. Als gutgesonnene Shen Te aber, zur Nächstenliebe nun schon verpflichtet, gerät sie erneut an den Rande ihrer Existenz durch ihre Liebe zu dem arbeitslosen Flieger Yang Sun. Für ihn verkauft sie den Laden, damit Yang Sun durch Bestechung in Peking eine Stelle als Flieger erhalten kann. Aber Yang Sun in seiner Existenznot hat Shen Te nur benutzt, um Geld zu erlangen. Erneut muss Shen Te ihr verhasstes GegenIch, den Vetter Shui Ta, zu Hilfe rufen. Dieser gründet in verfallenen Baracken eine Tabakfabrik (wichtig, woher Tabak und Kapital kommt!) und zwingt alle, denen Shen Te hilfreich war, dort gegen Hungerlöhne für ihn zu arbeiten. Mit Shui Ta blüht das Geschäft auf. Doch weil Shen Te nicht mehr erscheint, verdächtigen die Leute Shui Ta, das Mädchen ermordet zu haben. Shui Ta wird vor Gericht geführt, dessen Richter jene drei Götter sind, die Shen Te einst bei sich aufgenommen hat. Ihnen ergibt sich der Angeklagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Shen Te zu erkennen. „Euer einstiger Befehl gut zu sein und doch zu leben zerriss mich wie ein Blitz in zwei Hälften (.) gut sein zu andern Und zu mir konnte ich nicht zugleich. Ach, eure Welt ist schwierig! Die Götter wissen keine Antwort auf Shen Tes Klagen und entschweben auf einer rosaroten Wolke. Der Schluss des Stücks bleibt offen. III. Aufbau des Stück a) Strukturelemente: Vorspiel, 7 Zwischenspiele, 10 Handlungsszenen, 5 Lieder, Epilog (Nachspiel). 2 b) Funktion der Elemente: 1) Vorspiel: Exposition (Ort d. Spiels, wichtigste Akteure); Vorstellung der Grundfrage des Stücks, ob es möglich sei, auf dieser Welt gut zu sein. Geldgeschenk der Götter an Shen Te dient als Katalysator der Handlung. 2) Zwischenspiele (Zsp.): (7) 5 der 7 Zsp. kommentieren den Fortgang der Handlung aus der Sicht Wangs. Im Dienste der Verfremdung beleuchten sie die zw. den Handlungsszenen (110) liegenden Zeiträume in Form des epischen Berichts. In den 2 Zsp. „Vor dem Vorhang agiert Shen Te. Zwischen 4/5 findet das Ummontieren in die Figur Shui Ta statt (Das Lied von der Wehrlosigkeit der Götter). Beim 2. Zsp. von 5 auf 6 formuliert Shen Te die BrechtVision einer kommenderen gütigeren Welt: „Keinen verderben lassen, auch nicht sich selber/Jeden mit Glück erfüllen, auch sich, das ist gut. 3) Lieder: poetische Reflexionen zu den Einzelaspekten des Stücks. Das Lied vom SanktNimmerleinsTag zeigt Suns Resignation, seinen Traum vom Fliegen nicht verwirklichen zu können. Das Lied vom Rauch (S. 27) drückt die Resignation dreier Generationen über die Welt, wie sie ist, aus. Das Lied vom achten Elefanten zielt auf Sun, den vorbildlichen Antreiber, der zum Verräter an den Gefährten seines eigenen Elends geworden ist (Kritik an Entsolidarisierung). Das Lied des Wasserverkäufers im Regen weist auf das Problem der kapitalistischen Überproduktionskrise hin. 4) Epilog: (ein Spieler) dient der Reflexion, Transparenz und Offenlegung: Wendet sich wie andere Teile des Stücks ans Publikum. „Vorschwebte uns die goldene Legende ist eine Anspielung auf die berühmteste Legendensammlung des Mittelalters, der Legenda aurea des Dominikanermönchs Jakobus de Voragine, die die Lebensgeschichte der Heiligen darstellt. Erkenntnis: Shen Te taugt nicht zur Heiligen. Sie bleibt ein Mensch und will leben. Aufforderung ans Publikums zum Selberdenken, da Stück keinen Schluss im herkömmlichen Sinn liefert. Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen Den Vorhang zu und alle Fragen offen. Die Fragen, um die es geht, werden ebenfalls im Epilog benannt. (Aufdeckung des Themas durch den Kommentar des Autors!!!!) Auch die Produktion von Theater selbst wird nicht als von ökonomischen Zwängen unabhängig betrachtet: „Wie können es uns leider nicht verhehlen:/ Wir sind bankrott, wenn Sie uns nicht empfehlen. Auch dies ebenso wie der fehlende Schluss eine Absage an herkömmliches Illusionstheater. IV. Figuren: Sie sind weniger durchgestaltete Charaktere wie bei Lessing oder Shakespeare, sondern Demonstrationsfiguren im Dienste der Fabel (sie sollen etwas anderes als sich selbst zeigen, sichtbar machen!) Dennoch wirken sie nicht etwa „blutleer oder in ihrem Handeln unverständlich, Teilidentifikationen sind durchaus möglich (und bewusst eingesetzt), was zur großen Theaterkunst Brechts gehört. Shen Te/Shui Ta: B. B. bereichert das Thema der gespaltenen Persönlichkeit um eine ungewöhnliche Variante: Gut und Böse wohnen nicht beieinander in einer Figur (keine 2 Seelen in einer Brust, vgl. Faust I). Shen Tes Gutsein ist Natur (Wesenszug von ihr), ihr Bösesein ist ausschließlich sozial bedingt, erzwungen durch die Verhältnisse (der kapitalistischen Klassengesellschaft) und Mittel zum Zweck. Shen Te und Shui Ta verkörpern 2 mögliche Haltungen gegenüber der gesellschaftlichen Realität: Shen Te, die „Gute, verliert im Konkurrenzkampf, Shui Ta, der „Böse, besteht ihn erfolgreich. Man sollte jedoch nicht die Ironie der Tatsache übersehen, dass der böse Shui Ta (Kapitalist) am Ende mehr für die Armen erreicht hat, als es der guten Shen Te jemals möglich gewesen wäre, nämlich Arbeit und Brot. Die Alternative heißt also nicht gut und böse, sondern die Frage, die gestellt wird, ist, ob die Gesellschaft im Kapitalismus so ist, dass man/frau sich das Gutsein leisten kann. 3 Shen Te als Prostituierte verkauft die Ware Liebe, kann sich aber die wahre Liebe zu Sun nicht leisten. Auch „private Beziehungen werden nicht unabhängig von ökonomischen Verhältnissen gesehen (z. B. auch Zweckheirat mit Barbier). Shen Tes beherrschender Charakterzug ist, dass sie nicht Nein sagen kann, was auch die Ursache für die Entstehung Shui Tas ist (Notwehrsituation): Shui Ta bewahrt den Laden vor der Vernichtung durch die Armen, er treibt 300 Silberdollar für Sun auf und sorgt durch das harte Regiment in der Fabrik für die Zukunft des Kindes. Gut und Böse sind schwer zu trennen. Shen Te wird durch die Maske Shui Tas nicht verwandelt, sie nimmt nur gleichsam Urlaub von sich selbst und rettet so die materielle Basis der Güte (Tabakladen), die Freundlichkeit (bei Brecht menschliche Handlungsweise gegenüber dem Nächsten, hier Sun) und die ihr zuteil gewordene Liebe (Kind). Dennoch leidet Shen Te an der „Maske. Es gehört zu den Wesensmerkmalen des guten Menschen, dass er die Maske des Bösen nicht zu tragen vermag, ohne darunter zu leiden. Götter: Im Gegensatz zur Vorstellung allmächtiger Götter recht klägliche, manchmal komische Erscheinungen. Mit verzeifeltem Eifer suchen sie den Beweis für ihre Existenzberechtigung und diejenige der göttlichen Gebote, dabei gibt bereits die Anspruchslosigkeit des Ziels (ein einziger guter Mensch würde zur Rechtfertigung genügen) Anlass zur Hinterfragung des Projekts. Sie verlangen, dass der Mensch gut sei, verschließen aber die Augen vor dem Zustand der Gesellschaft, der die Menschen daran hindert, ihre Gutherzigkeit zu leben. Die drei Götter gleichen oft den antiken, die oft recht menschliche Züge und Gefühle haben und sich auch voneinander charakterlich unterscheiden. Je länger sie auf Erden weilen, umso abgekämpfter werden sie, die Verhältnisse setzen auch ihnen zu. Brecht hat laut den gängigen Interpretationen keine Anspielung auf die Dreieinigkeit des christlichen Gottesbegriffes beabsichtigt, sondern eher eine Personifikation des (bei uns christlich geprägten) bürgerlichen Gewissens, das mit kleinen Geldspenden die Seele entlastet (Geschenk an Shen Te), aber vor den sozialen Missständen und deren Änderung resigniert. Die Sprache der Götter ist phrasenreich, flach und wenig argumentativ und demonstriert (realitätsferne, wenig durchdachte) bürgerliche Wohlanständigkeit. Ihre Aussagen haben teilweise das Niveau erbaulicher Stammtischgespräche: „Man bezahlt, was man schuldig ist. „Was haben Geschäfte mit einem rechtschaffenen und würdigen Leben zu tun? „Leid läutert oder „Die Menschen sind nichts wert. Der Schluss ist eine Umkehrung des im antiken Drama am Ende auftauchenden DEUS EX MACHINA. Im Gegensatz zum antiken Drama können die Götter jedoch die Konflikte oder die Verwirrung genauso wie die Figuren des Stücks nicht lösen. Yang Sun: beutet Shen Te aus, nicht liebesfähig. Karrierist, der ohne Rücksicht auf Verluste sein Ziel verwirklichen will. („Ich bin ein niedriger Mensch. Ohne Kapital, ohne Manieren. Aber ich wehre mich.) Sich wehren heißt für ihn, ohne jedes Solidaritätsgefühl/Mitleid mit anderen handeln. Die restlichen Figuren lassen sich in Besitzende und Hilfsbedürftige einteilen (Querschnitt der Bevölkerung). Wichtig ist, dass die Armen nicht automatisch die Guten, die Reichen nicht automatisch die Bösen sind. Sie repräsentieren verschiedene Überlebensstrategien und gesellschaftliche Gruppen. V. Interpretationsansätze: Die am Anfang des Stücks präsentierte Frage, ob die Welt so bleiben kann, wie sie ist, wird am Ende des Stücks eindeutig mit Nein beantwortet. Dennoch bleibt die inhaltliche Beantwortung, wie und in welche Richtung sie verändert werden soll, relativ offen. Durch Brechts Beschäftigung mit Marx und seiner Kapitalismuskritik rückt man den Autor ideologisch oft in die Nähe kommunistischer Gesellschaftsmodelle, die zu seiner Zeit als einzige wirkliche Alternative zu kapitalistischen und faschistischen galten. Das Stück selbst bietet keine bestimme Lösung als Allheilmittel an, sondern formuliert eine ideologisch offene Aufforderung zur Veränderung der Verhältnisse ans Publikum. Es führt nur den Nachweis der Notwendigkeit einer Lösung. Das Stück kann auch nicht als radikale Absage an die humanistische Forderung des „Gutseins gelesen werden, ganz im Gegenteil. Die Welt ist eben nicht in Ordnung (so wie es die 4 Götter gerne hätten), sondern sie bedarf der Veränderung, damit der Einzelne nach den Geboten der Liebe, Güte und Menschlichkeit (zu sich selbst und anderen) leben kann. Eine Absage wird nur jenen erteilt, die glauben, die Welt sei gut, so wie sie ist, und jenen, die glauben, ein/e Einzelne/r (Shen Te) könne die Welt (und sich als Teil der Welt) retten (siehe auch „Mutter Courage) Außerdem werden jene kritisiert, die Moral und Menschlichkeit als abstrakte Forderung von den äußeren Bedingungen des Menschseins abkoppeln wollen und im Falle eines Fehlverhaltens nur dem Einzelnen moralische Schuld zuweisen. Gut zu sein wird nicht auf eine Frage des Charakters reduziert, sondern auch als mehr oder weniger zulässige/förderliche Handlungsmöglichkeit in einer konkreten, von ökonomischen und sozialen Bedingungen geprägten Welt, gesehen (vgl. Woyzeck von Büchner). Wie in Brechts Dreigroschenoper gilt das Motto: „Zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. VI. Sprache in Brechts Stücken: Brechts Sprache hat didaktische Funktion. Sie steht im Dienst des Verfremdungseffekts, sie soll demonstrierend verfremden. Dazu dienen z. B. folgende Mittel: Wechsel von Stilschicht und Rhythmus (auch innerhalb einer Figur) befremdliche Ausdruchsweise oder nicht eingeschmolzene Zitate Sprichwörter an überraschender Stelle insgesamt sachlichtrockene Ausdrucksweise, die scheinbar einfach wirkt Es geht Brecht in seinen Stücken nicht um Sprachkunstwerke im herkömmlichen Sinn (obwohl sie dies auf ihre Art sind), sondern um die Übersetzung des Gestus, der Grundhaltung einer Figur. Das Spiel bezieht seine Lebendigkeit aus den Wirkungen starker sprachlicher Kontraste: Wechsel von Prosa zu Vers, Anrede des Publikums ohne Rücksicht auf den Rollenpartner, Jargonausdrücke und wirkungsvolle Metapher, Volksweisheiten mit didaktischem Gehalt, hohle Phrase und Plattheit zur Figurencharakterisierung, Antithese (z. B. Epilog). Brechts Lyrik (Einige Anmerkungen) So wie Brecht im Theater die Grenzen zwischen den Gattungen (Epischem und Dra matischem) aufhob, so darf man auch seine Lyrik episch nennen. Mit episch ist hier gemeint: distanzierend, beschreibend, reflektierend, Kritik statt Einfühlung ermöglichend. Seine Gedichte brechen wie sein Theater mit bürgerlichen Traditionen, Ästhetizismus und Bekenntnislyrik scheinen unmöglich geworden zu sein. Er wendet sich gegen die Lyrik des persönlichen Erlebnisses und der Erinnerung, die vor allem seit der Romantik gepflegt wird. Brecht wird oft in die Nähe der sogenannten Neuen Sachlichkeit gerückt, die in der Lyrik DichterInnen wie Peter Huchel, Georg Britting, Elisabeth Langgässer, Günter Eich, Oskar Loerke u. a. meint. Diese literarische Strömung tendiert dazu, eine das Ich des Dichters oft ausschließende Dinglichkeit und Präzision des Details zu erreichen. Die Poesie, das Magi sche wird nicht geleugnet, es kommt nur bereits durch Beschreiben und Besprechen der „Ord 5 nung des Sichtbaren zutage. Oft resultiert daraus die Landschafts und Naturbezogenheit der Neuen Sachlichkeit. Natur ist jedoch nicht mehr romantisches Ziel dichterischer Sehn sucht, sondern birgt auch Zeichen der Zerstörung, des Kampfes, der Aggressivität in sich. Die DichterInnen der Neuen Sachlichkeit verstanden sich als Reaktion auf die Subjek tivität und das Pathos des Expressionismus. Bei Brecht ist diese Sachlichkeit, der Verzicht auf ästhetisches Spiel aber nicht als grundsätzliches, literarisches Programm zu verstehen, son dern ergibt sich aus der Notwendigkeit der „finsteren Zeiten, ist also politisch motiviert („die Reden des Anstreichers), was im Gedicht Schlechte Zeit für Lyrik deutlich zum Ausdruck kommt. Für ihn ist die „reimlose(n) Lyrik mit unregelmäßigem Rhythmus, so der Titel eines Aufsatzes von Brecht, eine Forderung der Zeit. Wenn sich die Zeiten ändern, kann die Lyrik auch wieder „Die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum (aus: Schlechte Zeit für Lyrik) ausdrücken. Brechts lyrisches Gesamtwerk (ca. 2500 Gedichte!!!) zeugt von ungeheurerVielfalt und vor allem von der Beherrschung aller wesentlicher Formen der Lyrik (Hexameter und Odenstrophen, Knittelverse, Sonette, Balladen, Lieder, Epigramme, Prosagedicht, .). Brecht meidet jedoch die übliche lyrische Gefühlshaftigkeit. Thematisch greift er Alltägliches, Frivo les, Obszönes, politisch Brisantes, aber auch traditionelle Themen der Lyrik wie Liebe und Natur auf und bringt sie in neue, überraschende und provozierende Zusammenhänge. Satire und Parodie gehören genauso wie politisches und humanes Engagement zu seinen Ausdrucks formen. Brechts Sprache kann vereinfacht als streng, nüchtern, von gläserner und unsentimen taler Präzision beschrieben werden. Dennoch ist Brechts Lyrik nur scheinbar einfach und hat nichts mit Alltagssprache zu tun. Rhythmus, Satzbau und Wortstellung, Verslänge, Bildhaftigkeit und Wortwahl zeugen von hoher poetischer Fertigkeit und Durchkomponiertheit. Quellen: Brecht, Bertolt: Der gute Mensch von Sezuan. Parabelstück. Frankfurt, Suhrkamp, 1964. edition suhrkamp, 73) Paintner, Peter: Erläuterungen zu Bertolt Brecht/Der gute Mensch von Sezuan. Hollfeld, C. BangeVerlag, 6. überarb. Aufl. 1997. (Königs Erläuterungen und Materialien, Bd. 186). Paucker, Henri R. (Hg.): Neue Sachlichkeit Literatur im Dritten Reich und im Exil. Stuttgart, Reclam, 1974 (Die deutsche Literatur. Ein Abriss in Text und Darstellung, Band 15). Killy, Walther (Hg.): Deutsche Autoren. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Band 1. Gütersloh/München, Bertelsmann Lexikon Verlag, 1994. Auszug aus Kindlers neues Literaturlexikon (Zugang über: www.amazon.de Titelabfrage) Mag. Martina Frick Vgl. auch Stichwort Literatur, Kapitel zu Epischem Theater und zu Brechtscher Lyrik. S. 329 336, S. 232233. 6