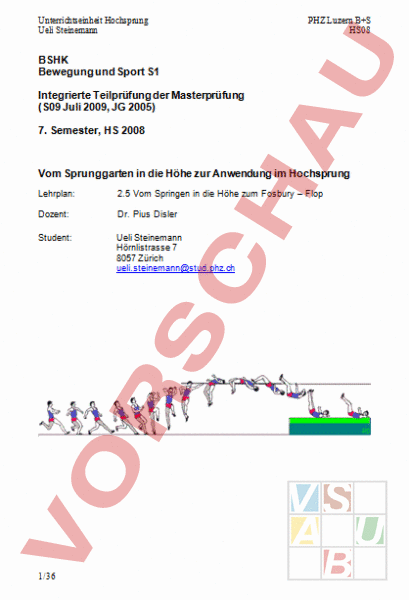Arbeitsblatt: Unterrichtseinheit Hochsprung
Material-Details
Teilmasterarbeit zum Thema Hochsprung. 5 Doppellektionen
Bewegung / Sport
Anderes Thema
7. Schuljahr
36 Seiten
Statistik
41047
1739
31
05.06.2009
Autor/in
Ueli Steinemann
8057 Zürich
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 BSHK Bewegung und Sport S1 Integrierte Teilprüfung der Masterprüfung (S09 Juli 2009, JG 2005) 7. Semester, HS 2008 Vom Sprunggarten in die Höhe zur Anwendung im Hochsprung Lehrplan: 2.5 Vom Springen in die Höhe zum Fosbury – Flop Dozent: Dr. Pius Disler Student: Ueli Steinemann Hörnlistrasse 7 8057 Zürich 1/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann Inhaltsverzeichnis: 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 4.0 5.1 5.2 5.3 6.0 7.0 2/36 Analyse Rahmenbedingungen Pädagogische Analyse Motorische Analyse Lernziele LZ Lernverfahren LV Lernkontrolle LK Detaillierte motorische Analyse Hochsprung Zeitliche Gliederung Stoffsammlung Feinplanung 1. Doppellektion Hallenaufbau Sprunggarten Materialliste 1. Doppellektion Zusätzliche Materialien Literaturverzeichnis PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit: Vom Sprunggarten zum Hochsprung 1.1 Analyse: Der Hochsprung ist eine der klassischen Leichtathletik Disziplinen. Er erfordert Kraft, Koordination und Rhythmusgefühl. Er ist darum eine geeignete Form diese Fähigkeiten in der Schule zu erlernen und üben. Es gibt nicht einfach den Hochsprung. Es gibt verschiedene Formen, die sehr unterschiedliche Anforderungen an die SuS stellen. Die SuS sind am Anfang des Themas oft nicht sehr begeistert, sie können aber mit viel Abwechslung und spielerischen Formen begeistert werden. Gemeinsame Elemente sind der Anlauf, das Umwandeln der horizontalen Anlaufenergie in die vertikale und das Überspringen einer möglichst grossen Höhe. Das Ziel dieser UE ist es, den Lernenden verschiedene Techniken des Hochsprungs bei zu bringen, die Endform des Fosbury – Flops zu erlernen und dabei die „Airtime zu geniessen. Lehrplan: Vom Springen in die Höhe zum Fosbury-Flop S.24 1.2 Rahmenbedingungen: Wintersemester, normal grosse, gut ausgestattete Halle. Einzellektionen und Doppellektionen. 7 SJ Niveau A; 10 Knaben, 6 Mädchen, die körperlichen Unterschiede sind zum Teil gross. Die SuS sind alle Sport begeistert und motiviert. 1.3 Pädagogische Analyse: Die SuS sind in der 1. Sekundarschule Niveau A; 12 Jungen und 6 Mädchen die immer gemeinsam Turnen haben. Die Entwicklung der SuS ist heterogen, manche der Jungen sind noch fast Kinder andere sind körperlich bereits ziemlich weit und kräftig. Daraus können sich rein durch die Körpergrösse beim Hochsprung schon einige Probleme entwickeln. Um dem Rechnung zu tragen werde ich vermehrt mit mindestens 2 Anlagen arbeiten müssen, um eine ständige Höhenanpassung vermeiden zu können 1.4 Motorische Analyse: In der Primarschule haben die meisten SuS bereits Erfahrungen mit Hochsprung gesammelt. Die SuS sollten nach Lehrplan alle den Schersprung bereits erprobt haben. Im gegenwärtigen Alter (ca. 13 Jahre), haben die motorischen Fähigkeiten oft Mühe mit dem körperlichen Wachstum schritt zu halten, deshalb ist eine sorgfältige, Koordinative Sprungschulung sehr wichtig. 3/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 2.1 Lernziele (LZ): Die SuS erlernen die Techniken des Schersprunges, des Straddle und des Fosbury – Flops. Um überhaupt mit Schersprung und den anderen Techniken beginnen zu können, ist es wichtig die SuS an die Grundlagen heran zu führen. Die Feinziele werden in den Lektionszielen aufgeführt. Kernbewegungen: Gerader 45 Anlauf für Schersprung Anlauftechnik (Tata-tam) Anlauf auf Kreisbahn, Körperneigung Blockieren, Drehen und möglichst senkrechter Absprung Ganzkörperstreckung Arm- und Schwungbeineinsatz Optimale Lattenüberquerung 2.2 Lernverfahren und Didaktische Analyse (LV): Die SuS werden erst langsam an offene und selbstverantwortliche Lehr- und Lernformen herangebracht. Es ist deshalb wichtig immer klare Anweisungen zu geben. Trotzdem oder gerade deswegen möchte ich den SuS Freiheiten eingestehen. Die SuS werden in 4 Gruppen (evtl. zwei Gruppen und Partnerkorrektur) ihrer Grösse und ihrer Sprungkraft nach eingeteilt werden. Sie sollen sich innerhalb dieser Gruppen gegenseitig Beobachten und auch beraten. Zu diesem Zweck sollen die Jugendlichen die Bewegungsabläufe kennen lernen und später erkennen was ihre Mitschüler evtl. falsch machen und Verbesserungen vorschlagen. Sie lernen dabei die Bewegungsabläufe zu beobachten, sich eine Bewegungsvorstellung zu bilden und diese danach umzusetzen. Indem sie andere beobachten und ihnen Vorschläge machen, erlernen sie diese Bewegungsvorstellung auch zu formulieren und zu differenzieren (AVU)1 Die einzelnen Lektionen und die ganze UE sind immer wieder in Erwerben, Anwenden, Gestalten unterteilt. 2.3 Lernkontrolle (LK): Während des Lern und Übungsprozesses sollen die SuS Freiraum haben um auszuprobieren und zu üben. Ich als Lp und die SuS geben sich gegenseitig Hilfe und Rückmeldungen. In einem letzten Schritt gibt es eine Prüfung. Kriterien sind die Kernbewegungen und die Höhe im Vergleich zur Körpergrösse und dem Geschlecht. 1 Aufnehmen Verarbeiten Umsetzten aus: Schneesport Schweiz 4/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 2.4 Detaillierte motorische Analyse Hochsprung 2 Wälzer (Straddle) Die Leistung im Wälzsprung wird technisch durch folgende Schwerpunkte bestimmt: • die Gestaltung eines rhythmischen und genauen Anlaufs; • die Qualität des Absprungs hinsichtlich der Einnahme einer günstigen Körperrücklage am Absprungbeginn • der richtigen Ausführung der Absprungstreckung, insbesondere der guten Koordination zwischen den Bewegungen des Sprung- und Schwungbeines sowie der Arme • die folgerichtige Verlagerung der Körperteile in der Anflugphase zur Unterstützung der notwendigen Drehungen; • die optimale Gestaltung der Lattenüberquerung durch Kombination von Drehungen, Verlagerung und Torsion des Körpers bzw. der Körperteile. Anlauf 2 Grundlagen der Leichtathletik 5/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann • • • PHZ Luzern BS HS08 genauer, zügig gesteigerter Anlauf in optimaler Länge; ausgeprägte Rhythmisierung der letzten 3 mit deutlicher Schwerpunkt Senkung; Einnahme einer optimalen Sprungauslage durch Vorbringen der Hüfte, schnelles Aufsetzen des gestreckten Sprungbeines, frühzeitiges Beschleunigen des Schwungbeines. Absprung • schneller, schlagender Einsatz des Schwungbeines bis zur völligen Kniestreckung (nach dem Überholen des Sprungbeines aus bis dahin gebeugtem Knie); • Nutzung der Schwungelemente zum Erreichen einer großen Abflughöhe des KSP durch • Doppelarmeinsatz bis in Kopfhöhe; • Einsatz der Schultern; • gestrecktes Schwungbein über Schulterhöhe; • explosive Streckung im Fuß-, Knie- und Hüftgelenk des Sprungbeines; • Erzeugung vertikaler Kraft- und optimaler Drehmomente unter möglichst minimalem exzentrischem Kraftstoß und unter Nutzung der Schwungelemente. Flugphase • zweckmäßige Vorbereitung der Lattenüberquerung durch Drehen des Springers mit der Brust zur Latte; • Verzögerung der Drehung in die Horizontale in der Anflugphase durch betont gehaltenes, möglichst fast gestrecktes Schwungbein; • Erhöhung der Drehgeschwindigkeit bei der Lattenüberquerung durch • gutes Abspreizen des im Hüft- und Kniegelenk gebeugten Sprungbeines, • Gegendrehen von Schulter und Beckenachse bei der Lattenüberquerung, • Senken von Schwungbein und Rumpf (Tauchen). 6/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann 3 3 Grundlagen der Leichtathletik 7/36 PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann 4 4 Grundlagen der Leichtathletik 8/36 PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann 5 5 Grundlagen der Leichtathletik 9/36 PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 Fosburyflop Die Leistung beim Fosburyflop wird technisch durch folgende Schwerpunkte bestimmt6: • • • • • • • • Gestaltung eines genauen Anlaufs mit einer optimalen Geschwindigkeit und einer guten Absprungvorbereitung, dass heißt einer der Anlaufgeschwindigkeit entsprechenden Rücklage und Körperschwerpunkt – Senkung in der Sprungauslage; Qualität des Absprungs optimale Arbeit und Koordination von Schwungbein, Sprungbein und Schwungarmen optimaler Abflugwinkel gute und zeitlich richtig gesteuerten Einnahme und Auflösung der Brückenposition bei der Lattenüberquerung Anlauf • Gleichmäßig gesteigerter Anlauf; • optimale Impulskurve auf den letzten drei Schritten ohne Geschwindigkeitsabfall; • deutliche Kurvenneigung und Körperrücklage im letzten Schritt; • stemmender Einsatz des Sprungbeines; Absprung • Körper bildet in der Sprungauslage eine gerade Linie vom Fuß bis zur Schulter; • schnelles Abklappen des Fußballens nach Aufsetzen über die Ferse; • Fußaufsatz auf der Fußpunktkurve; • Fußspitze in Sprungrichtung (10 bis 30) zur Latte; • explosive Streckung des Sprungbeines und des ganzen Körpers bei nahe zu • senkrechter Körperposition; • beidseitiger Armschwung nach vorn-oben bis in Kopfhöhe (Doppelarmschwung); • diagonaler Einsatz des gebeugten Schwungbeines auf kürzestem Weg; Flugphase • Kniewinkel in der Steigphase 90; • Hüftstreckung am Ende der Steigphase – maximale Ausprägung in der • Brückenposition; • Körper über Latte waagrecht, Schulterachse parallel zur Latte; • Landung auf dem Rücken mit ausgebreiteten Armen. 6 Grundlagen der Leichtathletik 10/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann 7 7 Grundlagen der Leichtathletik 11/36 PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 8 8 Grundlagen der Leichtathletik 12/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 Ausführliche Beschreibung des Fosburyflops Die folgende Bewegungsbeschreibung9 bezieht sich auf einen Linksspringer, der von rechts anläuft. Der gesamte Anlauf umfasst ca. 10 Schritte. Idealtypisch beginnt man bei der Bewegungsausführung aus der Grundstellung mit dem linken Bein (1. Schritt) und einer nur leichten Innenneigung loszulaufen. Sodann erfolgt der 2. Bodenkontakt mit dem rechten beschleunigten Fuß. Dabei wird der Körperschwerpunkt (man geht etwas in die Hüfte) leicht abgesenkt um den Antriebsweg zu verlängern, und der rechte Arm in Vorbereitung des Doppelarmschwungs verzögert. Beim dritten und etwas verkürzten letzten Schritt wird wieder der linke Fuß, zugleich lattenfernes Bein und Sprungbein, kräftig, mit der Ferse beginnend, aufgesetzt und die Innenneigung aufgegeben. Es erfolgt ein kräftiger Absprung bei sich aufrichtendem Körper, um mit Hilfe des anwinkelnden nach innen gehenden Schwungbeins die Rotation des Rückens zur Latte einzuleiten. Zurück zum Armschwung: Nach der Verzögerung des rechten Arms wird der linke und gegengleich schwingende Arm in Vorbereitung des jetzt einsetzenden Doppelarmschwungs im letzten Schritt nach hinten genommen. Bei dem Absprung sind das Schwungbein, die Arme und Schultern angehoben. Der Springer bewegt sich vorwärts-aufwärts, und die Schulter- u. Beckenachse dreht sich zur Latte. Die Beine hängen dabei parallel und entspannt hinunter. Der Kopf wird, wenn sich der Rücken über der Latte befindet, in den Nacken genommen, damit eine Brückenstellung bei zeitgleicher Anhebung der Hüfte (Bauchnabel geht zur Decke) nach oben erreicht wird. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Oberschenkelrückseite die Latte überquert, wird die Hüfte gebeugt und die noch entspannt herabhängenden Unterschenkel dabei aktiv hochgeschlagen und möglichst bis zur Landung parallel gestreckt gehalten. Das Kinn wird dabei bis zur endgültigen Landung auf die Brust genommen. Die Rückenlandung soll mit ausgebreiteten Armen in einer L-Position erfolgen, um ein zu starkes Überrollen (Rolle rückwärts) zu vermeiden. Zur Veranschaulichung dient nachfolgende Abbildung 1. 9 Grundlagen der Leichtathletik 13/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann Abbildung 1: Phasenstruktur Hochsprung – Flop (Rechtsspringer) 10 10 Quelle: JONATH at all. 1995, S. 248 f. 14/36 PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann 11 11 Kursdokument von 15/36 PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 3.0 Zeitliche Gliederung: Doppellektion 1: 12 Ziele: • Die SuS kennen ihr Sprung- und ihr Schwungbein • Die SuS erfahren verschiedenste Formen um die Schnur zu überqueren • sie haben keine Angst vor dem Sprung und der Landung • sie erkennen die Wichtigkeit: eines guten Anlaufs, des Schwungbeins und dem Einsatz der Arme und sie verbessern ihre Sprungkraft • Die SuS können sich gegenseitig ihre Beobachtungen schildern und konstruktive Vorschläge machen Erwerben Inhalt: • Bekannt geben des Themas der nächsten 5 Doppellektionen. • Herausfinden, welches das Sprungbein und welches das Schwungbein ist • Erfahrungen sammeln beim überspringen verschiedener Hindernisse und beim Versuch Aufgehängte Objekte zu erreichen. • Verschiedenste freie Sprünge (vor- und rückwärts-, Scher-, Hecht-, Walzund Flopsprünge) über die Gummischnur auf die grossen Matten. • Es steht das Ausprobieren, die Airtime und der Spass im Vordergrund. Doppellektion 2: 12 Erwerben Anwenden Gestalten aus: Schneesport Schweiz 16/36 Anwenden Ziele: • Die SuS erlernen die KB Anlauf für Straddle und Schersprung • Die SuS erkennen die Wichtigkeit der KB Absprung • Die SuS setzten ihr Schwungbein richtig ein und benutzen die Arme um die Flugphase zu verbessern • Sie beherrschen den Schersprung und den Straddle Erwerben Inhalt: • Gezielter Anlauf, von wo nach wo (senkrecht, 45 und auf Kreislinie) und wie viele Schritte (tata-tam) KB Anlauf • Umwandlung der Vorwärtsbewegung in Vertikalbewegung (KB Absprung) • Schersprung • Straddle (Wälzer) Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 Doppellektion 3: Inhalt: • Übungsstunde, die SuS repetieren den Schersprung und den Straddle • Die SuS wenden den Fosbury – Flop an und helfen sich gegenseitig sich auf die Prüfung vor zu bereiten • Die Schnur wird spätestens jetzt durch eine Latte ersetzt • Die SuS festigen die Bewegungsabläufe und merken sich ihre individuellen Startpunkte für Anlauf und Höhe der Latte Gestalten Ziele: • Die SuS sind am Ende der Stunde bereit, die drei Sprungformen auf Prüfungsniveau zu springen • Sie sind in der Lage sich gegenseitig konstruktive Feedbacks zu geben Anwenden Doppellektion 4: Anwenden Ziele: • Die KB des Fosbury – Flops werden in ihrer Grobform beherrscht: Anlauf, Absprung, Flugbild, Landung, Hüfte hoch und dann 90 knicken • Die SuS können sich gegenseitig helfen und beraten. • Verbalisieren und Analysieren der Abläufe Erwerben Inhalt: • Einführung des Fosbury – Flops • Sprung aus Stand, richtige Fluglage • Anlauf auf Kreisbahn Anlauf mit 3 Schritten Anlauf mit 5 Schritten • Blickrichtung bei Absprung • Lage bei Landung Doppellektion 5: Ziele: • Die SuS springen ihre Bestleistungen und werden bewertet • Kriterien sind die Kernbewegungen und die Sprunghöhen gemessen an Körpergrösse und Geschlecht 17/36 Gestalten Inhalt: • Letzte Probesprünge vor der Prüfung • Anzeichnen der Anlaufstellen • Durchführen der Prüfung Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 4.0 Stoffsammlung: 1. Doppellektion Ziel 1.1: • Die SuS kennen ihr Sprung- und ihr Schwungbein • Die SuS machen vielfältige Sprungerfahrungen und gewinnen Selbstvertrauen Übung 1.1a: Sprunggarten, Inselspringen Die SuS überspringen verschiedenste Hindernisse (Schwedenkasten ein- und zweiteilig, Ringe, Schnüre und Matten. An etwa 2 bis 3 Stellen sind die Ringe auf verschiedenen Höhen herabgelassen, die SuS versuchen sie zu erreichen. • • • • • 13 Die SuS zuerst frei springen lassen sucht sich einen Weg, folgt ihm sucht sich einen komplizierten Weg folgt erst am Schluss. sucht sich Weg und macht spezial Sprünge, darf aber nur das linke Bein als Sprungbein benutzten, folgt sucht sich Weg und macht spezial Sprünge, darf aber nur das rechte Bein als Sprungbein benutzten, folgt Variationen: Die SuS können individuell das Niveau variieren. 14 Die SuS darauf aufmerksam machen, darauf zu achten welches Bein sie zum Absprung bevorzugen, Parallelen mit Snow-, oder Skateboard? 13 14 Reivo De Kursdokument von 18/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 Abschluss mit den Variationen: Möglichst schnell und möglichst langsam von Hindernis zu Hindernis zu Springen. Rhythmusgefühl Übung 1.1b: Die SuS überspringen im 4er Rhythmus eine Bahn aus zweiteiligen Schwedenkästen. Variationen: Zuerst stehen die Schwedenkästen noch sehr nahe beisammen und werden dann mit jedem Durchlauf weiter auseinander geschoben. Rhythmusgefühl und Koordination des Anlaufs 15 Ziel 1.2: • Die SuS erfahren verschiedenste Formen um die Schnur zu überqueren • sie haben keine Angst vor dem Sprung und der Landung • sie erkennen die Wichtigkeit: eines guten Anlaufs, des Schwungbeins und dem Einsatz der Arme und sie verbessern ihre Sprungkraft Übung 1.2a: Die SuS springen über eine Zauber-, Gummischnur etc. auf die grosse Matte. Sie haben dabei die freie Wahl der Art, wie sie diese Schnur überqueren wollen. Vorschläge machen oder im Gespräch mit der Klasse herausfinden was es für Möglichkeiten gab. Variationen: Variation der Anlaufrichtung und der Fugphasen, des Sprungbeins, mit Hilfe der Arme oder, ganz ohne die Arme zu schwingen, vorwärts, rückwärts, seitwärts, beidbeinig oder mit nur einem Bein, Hock-, Dreh- und andere Sprünge, Landung beidbeinig, Landung auf Sprung oder Schwungbein 2. Doppellektion Ziel 2.1: Die SuS erlernen den Schersprung Übung 2.1a: Der Lehrer zeigt die Form zuerst vor. Die SuS überqueren drei dreie Schwedenkasten in der Schersprungtechnik und dann das Gummiseil auf die dicke Matte. 15 Reivo De 19/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 Übung 2.1b: In zwei Bahnen werden Schersprünge auf die dicke Matte gemacht. Zwei Bahnen ermöglichen einen schnelleren Durchlauf. Es können auch zwei Anlagen in der Halle aufgebaut werden und die SuS laufen eine Acht über diese BahnVariationen: Wichtig erscheint mir, dass einmal von Links und dann von Rechts her in ca. 45 angelaufen wird. Dies verbessert die Koordination und die SuS merken einmal mehr, welches ihr bevorzugtes Sprungbein ist (Übung mit der Acht laufen) Übung 2.1c: Die SuS machen den Anlauf über eine Matte und ein Schwedenkastedeckel, dies hilft ihnen den Anlauf zu koordinieren und verkürzt die letzten Schritte wichtig um die horizontale Bewegung in die vertikale Bewegung um zu wandeln. Die SuS versuchen dabei die Schritte abzuzählen und dann im Moment des Absprungs den Schwung der Arme voll aus zu nutzten. 16 • • • 16 Gezielter Anlauf, von wo nach wo (senkrecht, 45 und auf Kreislinie) und wie viele Schritte (tata-tam) KB Anlauf Umwandlung der Vorwärtsbewegung in Vertikalbewegung (KB Absprung) Schersprung Kursdokument von 20/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 17 Variationen: Lattenhöhe, verschiedene Anlaufrichtungen und Längen, mit Markierungen etc. Ziel 2.2: Die SuS erlernen den Straddle. Dieser Sprung wurde lange Zeit von den Spitzensportlern angewandt und galt als beste Technik um im Hochsprung zu gewinnen. Übung 2.2a: Um den Straddle vor zu bereiten, eigenen sich die beiden unten aufgeführten Übungen 18 Die SuS erlernen dabei die Bewegungsprinzipien des Straddle. Den Körper über das Hindernis zu wälzen. Die Idee dahinter ist einfach. Dadurch, dass der Körper in eine Horizontale Lage gebracht wird, muss der Körperschwerpunkt viel weniger weit über die Latte hinaus bewegt werden als beim Schersprung- Wird die Technik richtig angewandt, so bleibt (wie beim Fosbury – Flop) der Körperschwerpunkt sogar immer unter der Lattenhöhe! 17 18 Lehrmittel Sporterziehung Band 4 Broschüre 4 S.24 Kursdokument von 21/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 Folgende Übungen 2.2b eignen sich ebenso: 19 Die SuS versuchen während der gesamten Zeit sich gegenseitig zu helfen und sich Feedbacks zu geben. Lp hilft bei der Bewegungsanalyse und bei der Fehlerkorrektur Zur besseren Visualisierung werden grosse Kopien mit den Sprungbildern und Bewegungsskizzen an den Wänden aufgehängt (siehe Anhang). (GAG) Mögliche Anweisung: Überquere die Latte (Seil) in einer Schrägrolle vor-seitwärts über die Aussenschulter. Beim Überqueren der Latte sind die Beine gespreizt (Froschstellung). Wichtig: Vor dem Rollen Wälzen muss abgesprungen werden! Variationen: Lattenhöhe, verschiedene Anlaufrichtungen und Längen, mit Markierungen. Tauchwälzer oder Parallelwälzer. 19 Lehrmittel Sporterziehung Band 5 Broschüre 4 S.17 22/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 Doppellektion 3: Ziel 3.1: Einführung des Fosbury – Flops Übung 3.1a: Die erste Übung macht die SuS mit dem Absprung und der Drehung des – Flops bekannt. Die SuS machen eine Art Hochfangis. Die SuS können sich retten, in dem sie einbeinig abspringen und auf den Kasten sitzen. Variationen: SuS hüpfen auf Schwungbein und dürfen das Sprungbein nur benutzen um auf den Kasten zu springen. 20 Übung 3.1b: Die SuS machen Standsprünge auf zwei aufeinander liegende dicke Matten, dann über Seil auf nur noch eine Matte. Die Herausforderung ist, in eine Brückenposition zu kommen bevor man landet. Falls es bewegliche Mädchen hat, kann eine diese Brücke am Boden vorzeigen. 21 20 21 Lehrmittel Sporterziehung Band 5 Broschüre 4 S.18 Kursdokument von 23/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 Übungen 3.1c: im Weiteren machen wir noch einige Übungen, die alle die Drehung zum Thema haben. 22 Dann wird gemeinsam anhand einer Bewegungsskizze der Fosbury – Flop besprochen und durchgedacht (GAG)23. Die Lp zeigt den Sprung vor und weißt auf die einzelnen Kernbewegungen hin. Die SuS sollen mit höchstens drei Schritten Anlauf holen und die Latte Schnur ist zuerst auf Bauchnabelhöhe. 22 Kursdokument von 24/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 Variationen: Bogenförmiger 3 – Schritte Anlauf, später 5 – Schritte Anlauf, gerader Anlauf, Höhe der Latte Die SuS sollen Zeit bekommen um zu Üben und um alles aus zu probieren. Nach einer gewissen Zeit wird folgende Übung eingebaut, um den Anlauf und die richtige Neigung zu verbessern. 24 Zwischenbesprechung mit den SuS. Das Ziel ist es, das sie die Bewegungsvorstellung verbalisieren können. Das hilft den SuS später sich gegenseitig Feedbacks zu geben und präzisiert die Bewegungsvorstellung. Evtl. bemerkt der eine oder die andere eigene Fehlvorstellungen beim Aussprechen der Bewegungsabläufe (GAG). Doppellektion 4: Ziel 4.1: Die SuS wenden die drei erworbenen Sprungtechniken an und beginnen damit sie zu gestalten (Höhe der Latte, eigener Anlaufrhythmus, Startposition). An drei Stationen werden die Sprünge geübt und die SuS geben sich gegenseitig Feedbacks. An den Wänden stehen die Bewegungsskizzen zur Verfügung. Die Lp entscheidet von Fall zu Fall, ob ein Klassen-, Gruppen- oder Einzelinput nötig ist. Die SuS bereiten sich so auf die Zwischenprüfung vor. Sie üben die Anläufe und merken sich die Distanzen. Sie entscheiden auch, auf welcher Höhe sie am Prüfungstag in das Geschehen mit einsteigen. Sie bekommen wie im Profisport die Möglichkeit die Höhen mit drei Sprünge zu bewältigen. Doppellektion 5: Ziel 5.1: Lernkontrolle anhand eines Hochsprung Wettkampf Nach einem gemeinsamen Aufwärmen und einigen Probesprüngen beginnt der Wettkampf. Alle drei Sprungformen werden gesprungen und gleich bewertet. Es zählen die Korrektheit der Ausführung und die Sprunghöhe im Vergleich zur Körpergrösse (mit Excel sollte dies kein Problem sein). 24 Lehrmittel Sporterziehung Band 5 Broschüre 4 S.18 25/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann 5.1 PHZ Luzern BS HS08 Feinplanung 1. Doppellektion Student/in: Datum/Zeit: Klasse/Anzahl: Lehrer/in: Ueli Steinemann 90 7 SJ, A. 10;6 Lernstufe Erwerben/Festigen Anwenden/Variieren Gestalten/Ergänzen Thema: Vom Sprunggarten in die Höhe Voraussetzungen: Die SuS haben in der Primarschule bereits einige Sprungerfahrungen gesammelt. Sie sollen aber nun auf der Oberstufe diese Erfahrungen auffrischen und vertiefen. Das Klassenklima ist angenehm und lern fördernd, Partnerarbeit ist problemlos Lernziele: Die SuS kennen ihr Sprung- und ihr Schwungbein Die SuS erfahren verschiedenste Formen um ein Hindernis zu überqueren sie haben keine Angst vor dem Sprung und der Landung sie erkennen die Wichtigkeit: eines guten Anlaufs, des Schwungbeins und dem Einsatz der Arme und sie verbessern ihre Sprungkraft Die SuS können sich gegenseitig ihre Beobachtungen schildern und konstruktive Vorschläge machen Grundsatzüberlegungen (wozu – wohin): Lernziele LZ: Laufen und Springen gehören zu den natürlichen Bewegungsformen, die jedes Kind beim Spielen automatisch und unbewusst bereits erlernt hat und kann. Beim bewussten neu erlernen und erwerben neuer Techniken werden diese Bewegungsformen erweitert und neue Bewegungserfahrungen gesammelt. Das Körper- und somit das Selbstbewusstsein werden gesteigert. Alle Bereiche (Kondition, Koordination, Kognition, Rhythmus) werden beim Hochsprung gefordert und geschult. Der spielerische Einstieg mit einem Sprunggarten ermöglicht vielfältige Erfahrungen ohne Druck. Ängste werden abgebaut und Erfahrungen gesammelt. Das Austauschen der individuellen Beobachtungen und dem Beobachten der anderen SuS werden vielfältigere Erfahrungen möglich und durch Verbalisierung vertieft. Am Ende der Stunde soll jede/r SuS wissen welches das bevorzugte Schwungbein und welches das Schwungbein ist und zu was diese Wissen gut ist. Lernverfahren LV: Die SuS wechseln ab zwischen individuellen, entdeckenden Lernformen und Partner/ Gruppenarbeit, bei der sie sich austauschen und sich gegenseitig Feedbacks und Anregungen geben. Durch gezielte Anregungen der LP wird der Focus auf bestimmte Punkte gelegt. Sprung- und Schwungbeineinsatz, Armeinsatz etc. Lernkontrolle LK: Die gegenseitigen Feedbacks dienen als Lernkontrolle. Die SuS entscheiden sich zudem für je einen Posten, den sie besonders spannend finden oder an dem sie sich sicher fühlen. Am Schluss zeigen sie ihren Erfolg an diesem Posten und beschreiben ihre Beobachtungen in einem Satz (inkl. welches ihr Schwungbein ist). 26/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann Zeit Lerninhalte – Was? 10 Bekanntgabe des Themas und der Ziele der nächsten Wochen PHZ Luzern BS HS08 Lernverfahren – Wie? – Wer? Warm – Up 5 Warm – Up mit schneller Musik (120 – 140 Bpm) Hauptsächlich Hüpf-, Lauf- und Sprungformen. Ein Zweibeinige Sprungfolgen Sprünge mit 90, 180, 270 und 360 Drehungen an Ort, wer schafft am meisten Drehungen? (in beide Richtungen) Weitsprünge Froschsprünge Beim Korb, Sprünge in die Höhe 8 Laufen, die SuS laufen dabei durch die eigenen Reihen Vorzeigen und Nachamen SuS sollen auch Sprungfolgen vormachen Die Musik soll nicht nur einfach da sein, damit sie da ist, der Rhythmus soll bei den Sprungübungen beachtet und genutzt werden! Stretch – In und kräftigen der Rumpfmuskulatur Ruhigere Musik (ca. 100 Bpm) Mobilisierung aller Gelenke, Rumpfmuskulatur und Körperspannungsübungen Begonnen wird mit den Fußgelenken und dann wird nach oben gearbeitet Liegestützstellung auf Ellbogen: Arme abwechslungsweise ausstrecken Beine abwechslungsweise ausstrecken übers Kreuz Arm re. Bein li. strecken. Seitenstütz auf Ellbogen: Oberes Bein wird angehoben und gesenkt Liegestützstellung mit Rücken zum Boden: Beine werden abwechselnd angewinkelt und gestreckt Sprunggarten 10 Aufbau des Sprunggartens nach Plan, welcher in A3 Format aufgehängt und besprochen wird. (Plan im Anhang) 8x5 Die Schüler haben nun die Gelegenheit in Paaren die verschiedenen Posten zu erkunden. An jedem Posten gibt es Hinweise und Ideen. Die SuS sollen möglichst frei Bewegungserfahrungen machen. 20 Variante bei Zeitmangel: Ein SuS des Paares zeigt die Übung und der andere kommentiert die Vorgehensweise. 27/36 Sie sollen sich dabei zu jedem Posten gegenseitig ein Feedback geben und Beobachtungen austauschen. Welches ist wohl das Sprungbein, was passiert wenn ich die Arme nicht bewege etc. Lernkontrolle Die SuS zeigen am Posten ihrer Wahl ihren Sprung oder ihre besonders elegante Sprungfolge. 5 Aufbau der Geräte in der Gruppe Aufräumen Durch das Vorzeigen und beschreiben ihrer Beobachtungen, verbalisieren und verinnerlichen sie das Gelernte und Erfahrene. Welches ist das Schwungbein? Bringt der Einsatz der Arme etwas? Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 5.2 Hallenaufbau Sprunggarten 2 1 5 4 3 6 8 7 Rolf Dober, Sportunterricht.de 2002 25 1. Sprossenwand mit grosser Matte dahinter, klettere über die Sprossenwand und springe aus einer dir entsprechenden Höhe auf die Matte. Varianten: Verändere die Höhe des Absprungs. Versuche eine Rotation ein zu bauen. Versuche so schnell wie möglich die Wand zu überqueren und auf die Matte zu kommen. 2. Bärensprung: Überquere die höher werdenden Schwedenkästen und springe auf die Matte. Varianten: Springe möglichst weit, möglichst hoch, möglichst stylisch Versuche mit dem anderen Bein Anlauf zu nehmen Vergrössere den Abstand zwischen den Kästen 3. Sprungbrett und weiche Matte unter dem Basketballkorb. Das Ziel sind spektakuläre Korbleger. Varianten: (Minitrampolin) 25 Aufbauplaner von 28/36 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 4. Verschieden hoch aufgehängte Ringe. Versuche die Ringe mit Sprüngen in die Höhe zu erreichen Varianten: eine oder beidhändige Berührung, ein oder beidbeiniger Absprung Berührung mit Ellbogen. 5. Hocksprunganlage mit Zauberschnur. Ziel, alle möglichen Überquerungsarten entdecken. Varianten: Mit welcher Variante kommst du am höchsten? 6. Ringe am Boden, versuche verschiede Sprungkombinationen Varianten: Versuche möglichst komplizierte Sprungfolgen zu kreieren, die dein Sprungpartner nachahmen muss. 7. Mattenbahn mit Schwedenkastenelementen, suche den Rhythmus. Ein und zweibeinig. Varianten: Höhe der Schwedenkasten oder deren Abstand variieren 8. Malstäbe mit Zauberschnüren verbunden (verschiedene Höhen), versuche so viele Übersprunge zu machen wie möglich. Varianten: Gib deinem Sprungpartner eine möglichst schwierige Sprungfolge vor. 5.3 Materialliste 1. Doppellektion 29/36 Musik 4 große Matten 4 kleine Matten Ringe Sprossenwand, ausklappbar Sprungbrett, Minitramp ca. 10 Reifen Ringe 8 – 10 Mahlstäbe 6 Schwedenkasten oder Bänkli Hallenaufbauplan Postenanweisungen Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann 6.0 Zusätzliche Materialien 30/36 PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann 31/36 PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann 32/36 PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann 33/36 PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann Leichtathletik 2 34/36 PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann Leichtathletik 2 35/36 PHZ Luzern BS HS08 Unterrichtseinheit Hochsprung Ueli Steinemann PHZ Luzern BS HS08 7.0 Literaturverzeichnis Jonath U., Krempel R. (1995): Leichtathletik 2, Rowohlt Verlag Bauersfeld Karl-Heinz, Schröter Gerd (1992): Grundlagen der Leichathletik, Sportverlag Berlin,. Augustin Dieter (2004): Vorlesung Leichtathletik-Theorie ESSM Magglingen (1998): Leiterhandbuch Leichtathletik Schweizerischer Leitathletikverband SVSS (1996): Lehrmittel Sporterziehung Band 4/5 Broschüre 4 www.blv-nachwuchs.ch (2008): Kursdokument (2008) 36/36