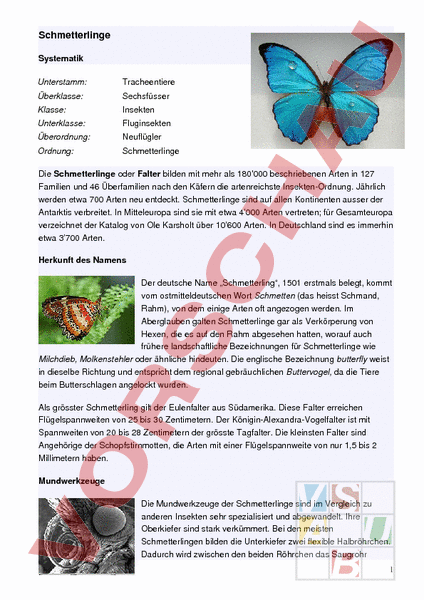Arbeitsblatt: Schmetterling
Material-Details
Informationen
Biologie
Tiere
5. Schuljahr
9 Seiten
Statistik
41225
1247
18
09.06.2009
Autor/in
Stephan Borgogno
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Schmetterlinge Systematik Unterstamm: Tracheentiere Überklasse: Sechsfüsser Klasse: Insekten Unterklasse: Fluginsekten Überordnung: Neuflügler Ordnung: Schmetterlinge Die Schmetterlinge oder Falter bilden mit mehr als 180000 beschriebenen Arten in 127 Familien und 46 Überfamilien nach den Käfern die artenreichste InsektenOrdnung. Jährlich werden etwa 700 Arten neu entdeckt. Schmetterlinge sind auf allen Kontinenten ausser der Antarktis verbreitet. In Mitteleuropa sind sie mit etwa 4000 Arten vertreten; für Gesamteuropa verzeichnet der Katalog von Ole Karsholt über 10600 Arten. In Deutschland sind es immerhin etwa 3700 Arten. Herkunft des Namens Der deutsche Name „Schmetterling, 1501 erstmals belegt, kommt vom ostmitteldeutschen Wort Schmetten (das heisst Schmand, Rahm), von dem einige Arten oft angezogen werden. Im Aberglauben galten Schmetterlinge gar als Verkörperung von Hexen, die es auf den Rahm abgesehen hatten, worauf auch frühere landschaftliche Bezeichnungen für Schmetterlinge wie Milchdieb, Molkenstehler oder ähnliche hindeuten. Die englische Bezeichnung butterfly weist in dieselbe Richtung und entspricht dem regional gebräuchlichen Buttervogel, da die Tiere beim Butterschlagen angelockt wurden. Als grösster Schmetterling gilt der Eulenfalter aus Südamerika. Diese Falter erreichen Flügelspannweiten von 25 bis 30 Zentimetern. Der KöniginAlexandraVogelfalter ist mit Spannweiten von 20 bis 28 Zentimetern der grösste Tagfalter. Die kleinsten Falter sind Angehörige der Schopfstirnmotten, die Arten mit einer Flügelspannweite von nur 1,5 bis 2 Millimetern haben. Mundwerkzeuge Die Mundwerkzeuge der Schmetterlinge sind im Vergleich zu anderen Insekten sehr spezialisiert und abgewandelt. Ihre Oberkiefer sind stark verkümmert. Bei den meisten Schmetterlingen bilden die Unterkiefer zwei flexible Halbröhrchen. Dadurch wird zwischen den beiden Röhrchen das Saugrohr 1 gebildet, mit dem die Falter ihre Nahrung aufsaugen können. Diese kann nur flüssig sein. Nahezu alle Schmetterlinge ernähren sich von Blütennektar, Pflanzensäften und anderen nährstoffreichen Flüssigkeiten. In Ruhestellung wird der Saugrüssel unter dem Kopf eingerollt. An heissen Tagen saugen Schmetterlinge auch gerne Wasser aus kleinen Pfützen. Sie tun dies aber auch, um Mineralsalze aufzunehmen. Einige tränenflüssigkeitstrinkende Falterarten saugen auch gerne Blut aus offenen Wunden. Bei einigen anderen subtropischen Arten der Eulenfalter, die in Südostasien verbreitet sind, ist der Saugrüssel zu einem Stechrüssel umgebildet und kann bis zu sieben Millimeter tief in die Haut des Wirtstieres eindringen. Diese Schmetterlingsarten ernähren sich vom Blut bestimmter Säugetiere und auch des Menschen. Sie können daher auch Krankheitserreger wie Viren übertragen. Augen Augen und Rüssel des kleinen Kohlweisslings Die Augen sind wie bei anderen Insekten als Facettenaugen ausgebildet. Diese bestehen aus bis zu 6000 kleinen Einzelaugen. Hinzu kommt, dass sie durch die Facetten auch nur „pixelig sehen. Sie besitzen aber ein grosses Gesichtsfeld und reagieren gut auf Bewegungen. Die Falter haben auch eine andere Farbempfindlichkeit als der Mensch. Sie erkennen keine roten Farben, dafür sind sie im Ultraviolettbereich empfindlich. Tarnung und Warnung der Falter 2 Tagpfauenauge Durch die vielen verschiedenartigen Fressfeinde der Schmetterlinge haben sich im Laufe der Evolution zur Tarnung, Täuschung und Warnung auf ihren Flügeln vielfach Zeichnungen entwickelt, die entweder wie Tieraugen aussehen, gefährliche und giftige Tiere imitieren oder durch auffällige Färbung vor ihrer Giftigkeit warnen. Tieraugen finden sich etwa auf den Flügeln des Tagpfauenauges. Die falschen Augen verwirren Räuber und verleiten sie, an falscher Stelle zuzuschnappen. Der HornissenGlasflügler sieht Hornissen zum Verwechseln ähnlich. HornissenGlasflügler (Achtung: es ist keine Hornisse!) Falter, deren Körper Gifte enthalten und die damit für die meisten ihrer potentiellen Feinde ungeniessbar sind, warnen diese durch eine auffällige Färbung. Raupen Raupe des Mittleren Weinschwärmers Auch die Raupen haben viele Fressfeinde und haben sich ebenso wie die Falter angepasst. Raupen, die etwa auf Nadelbäumen leben, haben meist eine Längszeichnung, die sie zwischen den Nadeln scheinbar verschwinden lässt. Raupen, die giftig sind, warnen Fressfeinde durch auffällige Färbung Merkmale der Raupe Raupe des Pappelschwärmers Die Raupe ist das eigentliche Fressstadium des Schmetterlings. Bei manchen (z. B. Pfauenspinner ist es sogar das einzige, in dem überhaupt Nahrung aufgenommen wird). Die Falter dieser Arten leben dann nur für die Fortpflanzung und sterben schon bald nach ihrem Schlupf. Da sich das Körpervolumen der Raupen stark vergrössert, müssen sie sich mehrmals häuten, bis sie ihre endgültige Grösse erreicht haben. In der Regel häuten sie sich vier bis fünf Mal, wobei sich ihr Volumen jeweils etwa verdoppelt. Zur hormonell gesteuerten Häutung schwillt die Raupe an, bis die alte Haut platzt und durch Muskelbewegungen nach hinten weg geschoben werden kann. 3 Zum Schutz vor Vögeln oder parasitoiden Wespen und Fliegen tragen viele Raupen Dornen oder Haare. Die Haare verursachen bei Menschen teilweise Hautreizungen durch Gifte, oft lösen sie sich, wenn sie gegen den Strich gebürstet werden. Wenn die Haare keine Gifte enthalten, können sie alleine durch das Eindringen in die Haut, was wie viele kleine Nadelstiche wirkt, Juckreize und Rötungen verursachen. Die Raupe des Eichenprozessionsspinners hat über 600000 giftige Haare, die schon Allergien auslösen können, wenn sich Menschen nur unter befallenen Bäumen aufhalten. Ernährung und Lebensweise der Raupen Die Raupen, welche völlig anders gestaltet sind als die Falter, ernähren sich auch komplett anders. Meist wird nach dem Schlupf zuerst die Eischale gefressen. Danach fressen die Raupen der meisten Schmetterlingsarten Blätter, Nadeln, Blüten, Samen oder Früchte verschiedener Pflanzen, wobei viele Arten auf bestimmte Pflanzen spezialisiert und angewiesen sind. Andere Schmetterlingsraupen ernähren sich von organischen Abfällen, Algen, Flechten oder auch räuberisch. Bei Schmetterlingsraupen kommt es auch zu Kannibalismus (Kannibalen fressen Artgenossen, hier fressen Raupen Raupen), wenn Nahrungsmangel herrscht. Symbiose (das Zusammenleben und voneinander profitieren) Die Raupen einiger Schmetterlingsfamilien leben in Symbiose mit Ameisen. Die Raupe sondert mit Drüsen am Rücken eine zuckerhaltige Flüssigkeit aus. Diese lockt Ameisen an. Die Ameisen trommeln mit ihren Beinen auf den Rücken der Raupe um die Produktion der süssen Flüssigkeit anzuregen. Im letzten Raupenstadium schleppen sie die Raupe in ihren Bau. Hier nimmt sie den Geruch der Ameisen an. Sie lebt jetzt nicht mehr symbiotisch mit den Ameisen, sondern sie tritt hier als Sozialparasit auf und ernährt sich von der Brut und lässt sich auch von den Ameisen füttern. Da sie genauso bettelt wie die Brut der Ameisen. Obwohl sie nach wie vor eine zuckerhaltige Flüssigkeit absondert, steht das nicht im Verhältnis, zu dem Schaden, den die Ameisen erleiden. Im Bau verpuppt sie sich und überwintert je nach Jahreszeit. Damit gehören diese Schmetterlinge zu den wenigen, die in stark von Ameisen besiedelten Gebieten überleben können. In Mexiko lebt der Würfelfalter symbiotisch mit Ameisen. Die Ameisen sperren die Raupe jeden Abend in eine Erdhöhle um sie vor anderen räuberischen Ameisen zu schützen. Tagsüber bewachen sie die Raupe und wehren beispielsweise Schlupfwespen ab. Auch bei Trockenheit bringen die Ameisen die Raupe in eine Erdhöhle, wo sie sogar Waldbrände überdauern kann. Als Belohnung erhalten die Ameisen ebenfalls eine süsse Flüssigkeit. Flugverhalten 4 Taubenschwänzchen beim Nektar Saugen Zu den schnellsten Faltern gehören die Schwärmer, deren Flügel ähnlich wie bei einem Kolibri schlagen. Sie können sich mit bis zu 50 km/h fortbewegen und im Flug, während des Nektarsaugens, auch stillstehen und sogar rückwärts fliegen. Als wechselwarme Tiere müssen sie sich erst aufwärmen, um fliegen zu können. Tagfalter nutzen dafür die Sonne. Durch die grosse Flügelfläche können sie dies auch bei bedecktem Himmel tun. Nachtfalter müssen sich durch Vibrieren der Flügel und die aus der Bewegung der Muskeln resultierende Wärme aufheizen. Wenn die Körpertemperatur an sonnigen, sehr heissen Tagen zu hoch wird, setzen sich die Falter in den Schatten und kühlen sich durch Flügelschlag. Überwinterung Schmetterlinge, die in Klimazonen leben in denen es kalte Jahreszeiten gibt, müssen überwintern. Sie verstecken sich in hohlen Bäumen oder in Tierbauten und verharren dort regungslos. Die meisten Schmetterlinge überwintern aber als Raupe, Puppe oder ungeschlüpft im Ei. Manche Raupen erwachen sogar an sehr warmen Wintertagen und fressen, bevor sie wieder in die Winterruhe fallen. Wanderungen Monarchfalter Einige Schmetterlingsarten legen lange Wanderungen zurück; sie werden als Wanderfalter bezeichnet. In Europa sind viele Arten nördlich der Alpen nicht bodenständig; das bedeutet, dass sie nicht dauerhaft überleben können und jedes Jahr erneut einwandern. Beispiele hierfür sind neben dem Distelfalter, das Taubenschwänzchen und der Admiral. Sie fliegen im Frühjahr aus ihren Lebensräumen in Südeuropa und Nordafrika nach Norden, teilweise überqueren sie dabei die Alpen. Über den Sommer leben sie in Mitteleuropa und Teilen von Nordeuropa. Sie bilden hier sogar neue Generationen. Naht der Winter, fliegen die meisten wieder zurück in den Süden. Manche Exemplare versuchen zu überwintern und überleben in milden Wintern oder in besonders geschützten Verstecken. Der Grund der Wanderungen ist nicht geklärt. Fortpflanzung und Entwicklung 5 Ursprüngliche Insekten verändern ihre Gestalt während ihres Lebens nicht, sie werden nur grösser und müssen sich deswegen häuten. Bei Schmetterlingen ändert die Metamorphose das Aussehen grundlegend. Sie wird hier vollständige Metamorphose genannt, denn neben dem Larvenstadium gibt es noch ein weiteres, nämlich das der Puppe. Somit haben die Schmetterlinge vier Entwicklungsstadien: Ei, Raupe, Puppe und Falter. Balzverhalten Die Balz ist ein sehr streng eingehaltenes Ritual. Sie beginnt normalerweise mit einem besonderen Flug und setzt sich am Boden durch das Umschreiten des Weibchens fort. Während des Fluges berühren sich oft die Flügel des Pärchens oder das Weibchen berührt mit ihren Fühlern die Flügel des Männchens. Die Paarungswilligkeit der Partner wird durch Duftstoffe verstärkt. Die männlichen wirken nur auf kurze Distanz, aber besonders die Nachtfalterweibchen locken die Männchen über grosse Entfernungen. Mit der Balz einher geht das Territorialverhalten der Männchen. Je nach Art werden bestimmte Bereiche wie beispielsweise Baumkronen und Hügelkuppen („Gipfelbalz), Wegabschnitte oder kleine unbewachsene Stellen verteidigt. HauhechelBläulinge bei der Paarung 6 Ei und Eiablage Ei Weibchen des HartheuSpanners bei der Eiablage Gelegt wird meistens auf der entsprechenden Futterpflanze, damit die Raupen schon nach dem Schlüpfen Nahrung vorfinden. Es gibt aber auch Arten, die ihre Eier wahllos auch auf nicht geeigneten Pflanzen verteilen. Die Raupen schlüpfen in der Regel nach zwei bis drei Wochen, dies ist aber auch schon nach weniger als einer Woche möglich. Wenn die Eier überwintern, was bei vielen Arten vorkommt, schlüpfen die Raupen mitunter erst nach einem halben Jahr. Ihre erste Entwicklung ist dann meist schon vor dem Winter abgeschlossen, lediglich das Schlüpfen wird hinaus gezögert. Nach dem Schlüpfen fressen viele Arten als erstes die Eischale. Vermutlich dient dies dazu Nährstoffe von der Mutter an das Ei übergeben wurden. Raupe Raupe eines Spanners Raupe des Schlehen Bürstenspinners Bei manchen Arten kann man ein Sozialverhalten beobachten. Die Raupen der Prozessionsspinner etwa leben in grossen Gespinsten miteinander und bewegen sich gemeinsam in langen „Prozessionen zu ihren Nahrungsquellen. Puppe Verpuppung eines Tagpfauenauges in 60 SekundenSchritten 7 Puppe des UlmenHarlekin Ist die Raupe erwachsen, beginnt sie mit der Verpuppung indem sie sich zum letzten Mal häutet. Danach findet die Metamorphose zum Schmetterling statt. Dabei werden die Raupenorgane abgebaut oder umgeformt und zu Falterorganen umgebildet und auch die gesamte äussere Gestalt der Tiere ändert sich. Die Puppen der Schmetterlinge sind grundsätzlich Mumienpuppen. Das heisst, dass alle Körperanhänge (Fühler, Beinanlagen und Flügelscheiden) mit einem Kitt an den Körper geklebt werden. Die Puppe ist fast unbeweglich. Sie kann nur den Hinterleib seitwärts schwingen und rollende Bewegungen ausführen. Die Puppen der übrigen Schmetterlingsfamilien verpuppen sich entweder frei am Boden oder in einem mehr oder weniger fest gesponnenen Gespinst aus Seide. Dieses wird Kokon genannt. Die Seide wird aus speziellen Spinndrüsen, die sich auf der Unterlippe befinden, hergestellt. Damit der fertige Falter seine zuweilen sehr feste Puppe wieder verlassen kann sind Vorkehrungen notwendig. Oder es wird ein runder Deckel vorgesehen, der dann von innen aufgestossen wird. Die Puppenphase (sog. Puppenruhe) beträgt meist zwei bis vier Wochen. Manche Arten überwintern aber als Puppe. Hier entwickeln sich die Falter schon vor dem Winter, schlüpfen aber erst im Frühling. Manchmal ruhen die Falter in den Puppen länger als einen Winter. So können die FrühlingsWollafter bis zu sieben Jahre in ihrer Puppe verharren, bevor sie schlüpfen. Der Seidenspinner liefert wohl das bekannteste Beispiel eines Kokons, denn aus ihm wird Seide hergestellt. Der Kokon besteht aus einem einzigen, über 500 Meter langen Faden, der maschinell ab und wieder auf Spulen aufgewickelt wird. Schlupf Erreicht die Puppe das Endstadium ihrer Entwicklung, ist sie sichtlich dunkler gefärbt und oft kann man die Flügelzeichnung durch die Puppenhülle erkennen. Die Puppe platzt an vorgegebenen Nähten auf und der Falter schlüpft. Bei Kokons verlässt der Falter entweder durch einen vorgesehenen Deckel das Gespinst oder er zwängt sich nach draussen. Danach beginnt er Luft in den Körper zu pumpen, um die Puppenhülle weiter aufplatzen zu lassen. Danach zieht er den Körper aus der Hülle und klammert sich mit den Beinen aussen fest. Die Flügel hängen noch schlaff vom Körper, sie werden aufgepumpt, indem die Falter Blut in die noch leeren Adern pumpen. Sind die Flügel zur vollen Grösse ausgefaltet, haben sie sich gleichzeitig geglättet. Danach startet der Falter schliesslich zu seinem ersten Flug. Er kann sich paaren, mit der neuen Eiablage vollendet sich der Lebenszyklus. Das Durchschnittsalter von Tagfaltern beträgt zwei bis drei Wochen. 8 Natürliche Feinde Fledermaus im Anflug auf einen künstlich aufgehängten Nachtfalter Die Falter und insbesondere auch die Raupen sind unzähligen Fressfeinden ausgesetzt. Hauptfeinde von Raupen sind wohl weltweit, insektenfressende Vögel. Hauptfeind nachtaktiver Schmetterlinge sind Fledermäuse, Lebensraumansprüche Jede Schmetterlingsart stellt vielfältige, artspezifische Ansprüche an die Eigenschaften ihrer Umwelt. Nur wenn diese erfüllt sind, können die Tiere überleben. Eine der wichtigsten Bedingungen für die Verbreitung und das Vorkommen der überwiegend pflanzenfressenden Schmetterlinge spielt das Vorhandensein von Nahrungspflanzen. Falter und Raupennahrung muss in hinreichender Menge vorhanden sein. Während manche Arten viele Nahrungspflanzen annehmen und eine weite Verbreitung finden, sind etliche Arten auf wenige oder nur eine einzige Nährpflanze angewiesen. Sie sind somit auch in ihrer Verbreitung beschränkt. Zwingend erforderlich sind in vielen Fällen spezielle Landschafts oder Vegetationsstrukturen. Falterpflanzen In Mitteleuropa sind einige Pflanzenarten die Nahrungsquelle für eine Vielzahl von Schmetterlingsraupen, so die Brennnessel, deren zahlreiche Frassgäste auch als Brennnesselfalter bezeichnet werden. Dazu zählen Grosser und Kleiner Schillerfalter, Trauermantel, Grosser Fuchs, Abendpfauenauge, Nachtpfauenauge, Rotes Ordensband, Grosser und Kleiner Gabelschwanz. Den Rekord als Nahrungspflanzen von Schmetterlingsraupen halten in Mitteleuropa Eiche und Salweide, an denen jeweils Raupen von über 100 Arten leben. Fast hundert Arten siedeln auf Pappeln und Birken. Von Weissdorn leben die Raupen von 65 Arten, auf Schlehe, Brombeere und Himbeere je 54, auf Hasel 44 und auf Rosen 33. Schmetterlinge und der Mensch DDRBriefmarke (Alpenapollo) Seidenproduktion in China 9 Getrocknete Raupen auf dem Markt von Burkina Faso Die Raupen und Puppen einiger Arten werden als eiweissreiches Nahrungsmittel genutzt. In Ostasien werden gekochte Seidenraupenpuppen als Snack gegessen. Schädling, von der Rosskastanienminiermotte zerfressene Allee Schmetterlinge in der Kunst Auch in der Dichtung wurden viele Texte über Schmetterlinge geschrieben. Von Wilhelm Busch stammt das Gedicht: Der Schmetterling Hell aufgeblüht im Sonnenschein. Er war ein junger Schmetterling, Der selig an der Blume hing. Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm Und nascht und säuselt da herum. Oft kroch ein Käfer kribbelkrab Am hübschen Blümlein auf und ab. Ach Gott, wie das dem Schmetterling So schmerzlich durch die Seele ging. Doch was am meisten ihn entsetzt, Das Allerschlimmste kam zuletzt Ein alter Esel frass die ganze Von ihm so heiss geliebte Pflanze. 10