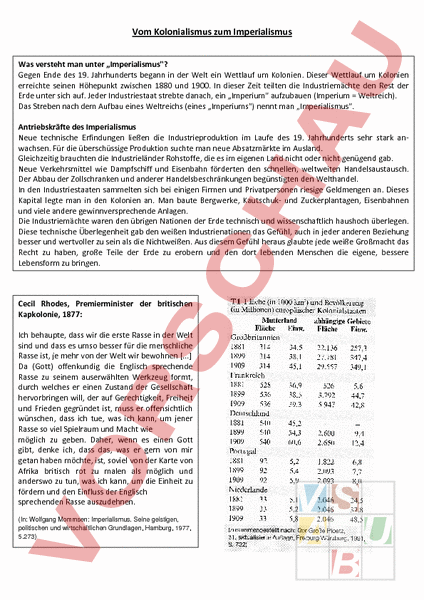Arbeitsblatt: Von Kolonialismus zu Imperialismus
Material-Details
AB zur Verdeutlichung der Entwicklung des Kolonialismus hin zum expansiven Imerialismus (Antriebskräfte, Begründungen, usw.) Quelle (Cecil Rhodes), Verfassertext und Diagramm.
Geschichte
Neuzeit
8. Schuljahr
1 Seiten
Statistik
41892
1955
59
23.06.2009
Autor/in
Thomas Wittmann
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Vom Kolonialismus zum Imperialismus Was versteht man unter „Imperialismus? Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann in der Welt ein Wettlauf um Kolonien. Dieser Wettlauf um Kolonien erreichte seinen Höhepunkt zwischen 1880 und 1900. In dieser Zeit teilten die Industriemächte den Rest der Erde unter sich auf. Jeder Industriestaat strebte danach, ein „Imperium aufzubauen (Imperium Weltreich). Das Streben nach dem Aufbau eines Weltreichs (eines „Imperiums) nennt man „Imperialismus. Antriebskräfte des Imperialismus Neue technische Erfindungen ließen die Industrieproduktion im Laufe des 19. Jahrhunderts sehr stark anwachsen. Für die überschüssige Produktion suchte man neue Absatzmärkte im Ausland. Gleichzeitig brauchten die Industrieländer Rohstoffe, die es im eigenen Land nicht oder nicht genügend gab. Neue Verkehrsmittel wie Dampfschiff und Eisenbahn förderten den schnellen, weltweiten Handelsaustausch. Der Abbau der Zollschranken und anderer Handelsbeschränkungen begünstigten den Welthandel. In den Industriestaaten sammelten sich bei einigen Firmen und Privatpersonen riesige Geldmengen an. Dieses Kapital legte man in den Kolonien an. Man baute Bergwerke, Kautschuk- und Zuckerplantagen, Eisenbahnen und viele andere gewinnversprechende Anlagen. Die Industriemächte waren den übrigen Nationen der Erde technisch und wissenschaftlich haushoch überlegen. Diese technische Überlegenheit gab den weißen Industrienationen das Gefühl, auch in jeder anderen Beziehung besser und wertvoller zu sein als die Nichtweißen. Aus diesem Gefühl heraus glaubte jede weiße Großmacht das Recht zu haben, große Teile der Erde zu erobern und den dort lebenden Menschen die eigene, bessere Lebensform zu bringen. Cecil Rhodes, Premierminister der britischen Kapkolonie, 1877: Ich behaupte, dass wir die erste Rasse in der Welt sind und dass es umso besser für die menschliche Rasse ist, je mehr von der Welt wir bewohnen [.] Da (Gott) offenkundig die Englisch sprechende Rasse zu seinem auserwählten Werkzeug formt, durch welches er einen Zustand der Gesellschaft hervorbringen will, der auf Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden gegründet ist, muss er offensichtlich wünschen, dass ich tue, was ich kann, um jener Rasse so viel Spielraum und Macht wie möglich zu geben. Daher, wenn es einen Gott gibt, denke ich, dass das, was er gern von mir getan haben möchte, ist, soviel von der Karte von Afrika britisch rot zu malen als möglich und anderswo zu tun, was ich kann, um die Einheit zu fördern und den Einfluss der Englisch sprechenden Rasse auszudehnen. (In: Wolfgang Mommsen: Imperialismus. Seine geistigen, politischen und wirtschaftlichen Grundlagen, Hamburg, 1977, 5.273) Vom Kolonialismus zum Imperialismus Was versteht man unter „Imperialismus? Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann in der Welt ein Wettlauf um Kolonien. Dieser Wettlauf um Kolonien erreichte seinen Höhepunkt zwischen 1880 und 1900. In dieser Zeit teilten die Industriemächte den Rest der Erde unter sich auf. Jeder Industriestaat strebte danach, ein „Imperium aufzubauen (Imperium Weltreich). Das Streben nach dem Aufbau eines Weltreichs (eines „Imperiums) nennt man „Imperialismus. Antriebskräfte des Imperialismus Neue technische Erfindungen ließen die Industrieproduktion im Laufe des 19. Jahrhunderts sehr stark anwachsen. Für die überschüssige Produktion suchte man neue Absatzmärkte im Ausland. Gleichzeitig brauchten die Industrieländer Rohstoffe, die es im eigenen Land nicht oder nicht genügend gab. Neue Verkehrsmittel wie Dampfschiff und Eisenbahn förderten den schnellen, weltweiten Handelsaustausch. Der Abbau der Zollschranken und anderer Handelsbeschränkungen begünstigten den Welthandel. In den Industriestaaten sammelten sich bei einigen Firmen und Privatpersonen riesige Geldmengen an. Dieses Kapital legte man in den Kolonien an. Man baute Bergwerke, Kautschuk- und Zuckerplantagen, Eisenbahnen und viele andere gewinnversprechende Anlagen. Die Industriemächte waren den übrigen Nationen der Erde technisch und wissenschaftlich haushoch überlegen. Diese technische Überlegenheit gab den weißen Industrienationen das Gefühl, auch in jeder anderen Beziehung besser und wertvoller zu sein als die Nichtweißen. Aus diesem Gefühl heraus glaubte jede weiße Großmacht das Recht zu haben, große Teile der Erde zu erobern und den dort lebenden Menschen die eigene, bessere Lebensform zu bringen. Cecil Rhodes, Premierminister der britischen Kapkolonie, 1877: Ich behaupte, dass wir die erste Rasse in der Welt sind und dass es umso besser für die menschliche Rasse ist, je mehr von der Welt wir bewohnen [.] Da (Gott) offenkundig die Englisch sprechende Rasse zu seinem auserwählten Werkzeug formt, durch welches er einen Zustand der Gesellschaft hervorbringen will, der auf Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden gegründet ist, muss er offensichtlich wünschen, dass ich tue, was ich kann, um jener Rasse so viel Spielraum und Macht wie möglich zu geben. Daher, wenn es einen Gott gibt, denke ich, dass das, was er gern von mir getan haben möchte, ist, soviel von der Karte von Afrika britisch rot zu malen als möglich und anderswo zu tun, was ich kann, um die Einheit zu fördern und den Einfluss der Englisch sprechenden Rasse auszudehnen. (In: Wolfgang Mommsen: Imperialismus. Seine geistigen, politischen und wirtschaftlichen Grundlagen, Hamburg, 1977, 5.273)