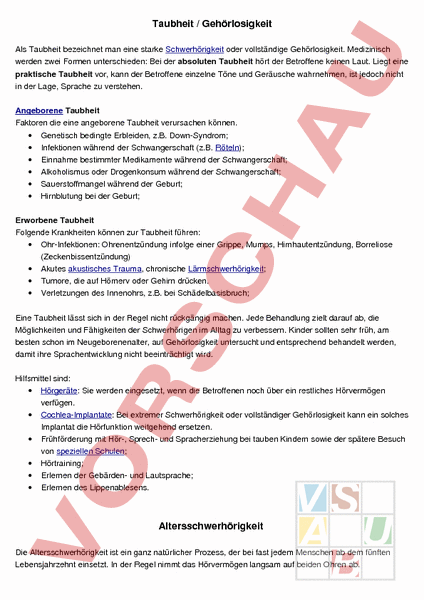Arbeitsblatt: Gehörschäden
Material-Details
Infoblatt zu den häufigsten Hörschäden
Biologie
Anatomie / Physiologie
7. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
42580
938
13
14.07.2009
Autor/in
jennifer ramsauer
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Taubheit Gehörlosigkeit Als Taubheit bezeichnet man eine starke Schwerhörigkeit oder vollständige Gehörlosigkeit. Medizinisch werden zwei Formen unterschieden: Bei der absoluten Taubheit hört der Betroffene keinen Laut. Liegt eine praktische Taubheit vor, kann der Betroffene einzelne Töne und Geräusche wahrnehmen, ist jedoch nicht in der Lage, Sprache zu verstehen. Angeborene Taubheit Faktoren die eine angeborene Taubheit verursachen können. • Genetisch bedingte Erbleiden, z.B. DownSyndrom; • Infektionen während der Schwangerschaft (z.B. Röteln); • Einnahme bestimmter Medikamente während der Schwangerschaft; • Alkoholismus oder Drogenkonsum während der Schwangerschaft; • Sauerstoffmangel während der Geburt; • Hirnblutung bei der Geburt; Erworbene Taubheit Folgende Krankheiten können zur Taubheit führen: • OhrInfektionen: Ohrenentzündung infolge einer Grippe, Mumps, Hirnhautentzündung, Borreliose (Zeckenbissentzündung) • Akutes akustisches Trauma, chronische Lärmschwerhörigkeit; • Tumore, die auf Hörnerv oder Gehirn drücken. • Verletzungen des Innenohrs, z.B. bei Schädelbasisbruch; Eine Taubheit lässt sich in der Regel nicht rückgängig machen. Jede Behandlung zielt darauf ab, die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Schwerhörigen im Alltag zu verbessern. Kinder sollten sehr früh, am besten schon im Neugeborenenalter, auf Gehörlosigkeit untersucht und entsprechend behandelt werden, damit ihre Sprachentwicklung nicht beeinträchtigt wird. Hilfsmittel sind: • Hörgeräte: Sie werden eingesetzt, wenn die Betroffenen noch über ein restliches Hörvermögen verfügen. • CochleaImplantate: Bei extremer Schwerhörigkeit oder vollständiger Gehörlosigkeit kann ein solches Implantat die Hörfunktion weitgehend ersetzen. • Frühförderung mit Hör, Sprech und Spracherziehung bei tauben Kindern sowie der spätere Besuch von speziellen Schulen; • Hörtraining; • Erlernen der Gebärden und Lautsprache; • Erlernen des Lippenablesens. Altersschwerhörigkeit Die Altersschwerhörigkeit ist ein ganz natürlicher Prozess, der bei fast jedem Menschen ab dem fünften Lebensjahrzehnt einsetzt. In der Regel nimmt das Hörvermögen langsam auf beiden Ohren ab. Alterungsprozesse beeinträchtigen das Innenohr mit seinen Sinneszellen (Haarzellen), den Hörnerv sowie die Hirnbereiche, die für eine Weiterverarbeitung der Signale notwendig sind. Altersschwerhörigkeit kann durch verschiedene Faktoren beschleunigt werden. Dazu zählen: • • • • Krankheiten wie Herz, Kreislauf und Stoffwechselerkrankungen, Lärm, Umweltfaktoren (z.B. Gifte) oder Medikamente, die das Ohr schädigen, Genussgifte wie Nikotin; Trommelfellperforation Das Trommelfell ist eine dünne Haut, die das Mittelohr zur Außenwelt abschließt. Es schützt das Ohrinnere vor Keimen und leitet von außen eintreffende Schallwellen weiter. Hat diese Membran ein Loch, spricht man von einer Trommelfellperforation. Verletzungen des Trommelfells können durch direkte oder indirekte Gewalteinwirkung entstehen. Die häufigste Ursache ist die Selbstverletzung bei der Reinigung des Ohrs mit Wattestäbchen Doch auch bei einer akuten Mittelohrentzündung mit Eiterbildung kann das Trommelfell durchbrechen. Typisch für eine traumatische Trommelfellperforation ist der stechende Schmerz. Dazu kann eine plötzliche Hörverschlechterung und ein hohles Gefühl im Ohr kommen. Hin und wieder treten auch kleinere Blutungen auf. Kleine Trommelfelldefekte wachsen meist von alleine wieder zu. Bei größeren, verletzungsbedingten Rissen müssen die Defektränder zunächst geglättet und anschließend Silikon oder Papierstreifen zur Stabilisierung aufgelegt werden. Mit einer solchen Schienung kann das Trommelfell besser heilen. Ansonsten lässt sich der Defekt operativ mit körpereigener Muskel oder Knorpelhaut verschließen. Gelangt kaltes Wasser ins Mittelohr, wird das Gleichgewichtsorgan gereizt und es treten Schwindelgefühle auf. Akustisches Trauma Explosionstrauma Die tiefen Frequenzen der Explosion verletzen vor allem das Mittelohr, die mittleren und hohen das Innenohr. Häufig zerreißt das Trommelfell und es kommt zu einer andauernden Mittel und Innenohrschwerhörigkeit (kombinierte Schwerhörigkeit), die im Verlauf weiter zunehmen kann. Die schwerste, akustisch bedingte Verletzung ist das Explosionstrauma. Bei Sprengarbeiten, militärischen Explosionen, Platzen eines Airbags, aber auch durch eine Ohrfeige, trifft eine Schalldruckwelle mit einer Lautstärke von mehr als 150 Dezibel (dB) und einer Dauer von mehr als drei Millisekunden das Ohr. Der Schaden entsteht häufig beidseitig und bildet sich ohne Behandlung nur selten komplett zurück. Knalltrauma Das Knalltrauma entsteht ebenfalls bei extremen Lautstärken über 150 dB. Diese wirken aber kürzer ein (weniger als drei Millisekunden). Der Krach von Gewehrschüssen (auch Spielzeugpistolen!) oder Knallkörpern verletzt meist nur ein Ohr. Beschwerden sind eine Hörminderung mit Tinnitus. In der Hälfte der Fälle bilden sich die Beschwerden innerhalb von zwei Tagen zurück. Trotzdem sollte jeder Betroffene sofort einen Arzt aufsuchen. Etwa 50 Prozent tragen bleibende Schäden auf dem Ohr davon, das der Schallquelle zugewandt war. Die hohen Frequenzen des Knalls schädigen genau die Nervenzellen im Innenohr, die diese Tonhöhe normalerweise verarbeiten. Deshalb betrifft diese Schwerhörigkeit in erster Linie den Hochtonbereich. Trommelfell und Mittelohr bleiben meist unverletzt. Akutes Lärmtrauma Der akute Lärmschaden (akutes Lärmtrauma) entsteht bei Lärm über 100 dB, der über Minuten bis Stunden anhält. Beispiele sind laute Rockkonzerte, Rennsportveranstaltungen oder Diskothekenbesuche. Der Schall wirkt deutlich länger auf das Gehör ein als beim Explosions oder Knalltrauma. Es kommt meist zu einer beidseitigen Innenohrschwerhörigkeit, hauptsächlich für hohe Töne. Sie kann sich spontan bessern, doch eine Verschlechterung ist leider auch möglich. Ohrenschmerzen und Gleichgewichtsstörungen sind selten, Tinnitus hingegen häufig. Chronisches Lärmtrauma Die Lärmschwerhörigkeit wird durch eine langfristige Einwirkung hoher Schallstärken auf das Gehör verursacht. Der Hörverlust beginnt schleichend und die Betroffenen nehmen ihn anfangs nicht wahr. Fernseher oder Radio werden stattdessen einfach lauter gedreht. In vielen Fällen betrifft der Hörverlust nicht alle Frequenzen gleichermaßen. Wer einige Geräusche noch ausgezeichnet hört, kommt kaum auf den Gedanken, dass er dennoch ein Hörgerät braucht. Gegen Lärmschäden helfen bisher weder Medikamente noch Operationen. Sie sind unheilbar. Nur Hörgeräte können den Schaden ausgleichen helfen. Fensterruptur Mittel und Innenohr sind über zwei hauchdünne Häutchen miteinander verbunden sie überspannen das runde und das ovale Fenster. Diese Häutchen trennen den luftgefüllten Mittelohrraum von der Hörschnecke und dem Gleichgewichtsapparat. Reißt die Membran in einem der Fenster, spricht man von einer Fensterruptur. Dabei tritt Flüssigkeit aus der Schnecke in die Mittelohrhöhle. Die Folgen eines solchen Risses können eine Schwerhörigkeit bis hin zur Taubheit und Schwindel sein. Fensterrupturen werden meist durch Druck und Pressmechanismen oder Verletzungen ausgelöst. Sehr selten können sie aber auch ohne erkennbare Ursache auftreten. Häufige Ursachen sind: • Plötzliche Druckänderungen, z.B. bei starker körperlicher Anstrengung (Tauchen, Fliegen), • Schädelverletzungen, • Explosionen (akustisches Trauma); Der Patient sollte sich so bald wie möglich einer Operation (Tympanoskopie) unterziehen, bei der das geschädigte Fenster mit Bindegewebe abgedichtet wird. Wie gut sich das Gehör erholt, hängt vom Ausmaß der Schädigung ab. Je schneller operiert wird, desto besser stehen die Chancen. Otosklerose (Ohrverkalkung) Das innerste Gehörknöchelchen (Steigbügel) ist mit der Hörschnecke verwachsen. Dadurch ist die Beweglichkeit der Gehörknöchelchenkette eingeschränkt und die Schallübertragung gehemmt. Die Folge ist, dass sich das Hörvermögen verschlechtert. Die Erkrankung tritt vorwiegend zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr auf, die knöchernen Veränderungen beginnen aber schon viele Jahre vor den ersten Symptomen. Mediziner vermuten, dass die Störung bestimmter Stoffwechselvorgänge Knochenwucherungen im Ohr auslöst. Die Otosklerose beginnt meist mit einer langsamen, schubweisen Hörverschlechterung auf einer Seite. Diese kann sich anfangs auch wieder bessern. Mit Medikamenten ist die Otosklerose bislang nicht heilbar. Die aussichtsreichste Therapie ist die Operation. Der Steigbügel wird durch eine Prothese aus Metall oder Kunststoff ersetzt, welche die Schallübertragung übernimmt.