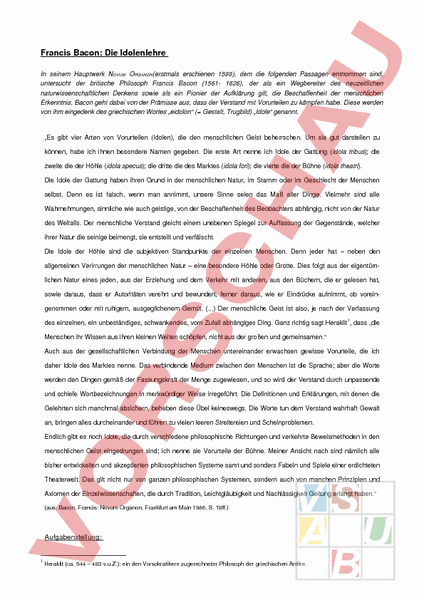Arbeitsblatt: Die Idolenlehre F. Bacons
Material-Details
Dieser berühmte Text von Francis Bacon ist seines Alters zum Trotz noch immer trefflich geeeignet, um Vorurteile auf ihre Stichhaltigkeit zu durchleuchten.
Lebenskunde
Ethik / Moral
10. Schuljahr
1 Seiten
Statistik
43374
1766
17
03.08.2009
Autor/in
Schimbo (Spitzname)
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Francis Bacon: Die Idolenlehre In seinem Hauptwerk NOVUM ORGANON(erstmals erschienen 1599), dem die folgenden Passagen entnommen sind, untersucht der britische Philosoph Francis Bacon (1561 1626), der als ein Wegbereiter des neuzeitlichen naturwissenschaftlichen Denkens sowie als ein Pionier der Aufklärung gilt, die Beschaffenheit der menschlichen Erkenntnis. Bacon geht dabei von der Prämisse aus, dass der Verstand mit Vorurteilen zu kämpfen habe. Diese werden von ihm eingedenk des griechischen Wortes „eidolon ( Gestalt, Trugbild) „Idole genannt. „Es gibt vier Arten von Vorurteilen (Idolen), die den menschlichen Geist beherrschen. Um sie gut darstellen zu können, habe ich ihnen besondere Namen gegeben. Die erste Art nenne ich Idole der Gattung (idola tribus); die zweite die der Höhle (idola specus); die dritte die des Marktes (idola fori); die vierte die der Bühne (idola theatri). Die Idole der Gattung haben ihren Grund in der menschlichen Natur, im Stamm oder im Geschlecht der Menschen selbst. Denn es ist falsch, wenn man annimmt, unsere Sinne seien das Maß aller Dinge. Vielmehr sind alle Wahrnehmungen, sinnliche wie auch geistige, von der Beschaffenheit des Beobachters abhängig, nicht von der Natur des Weltalls. Der menschliche Verstand gleicht einem unebenen Spiegel zur Auffassung der Gegenstände, welcher ihrer Natur die seinige beimengt, sie entstellt und verfälscht. Die Idole der Höhle sind die subjektiven Standpunkte der einzelnen Menschen. Denn jeder hat – neben den allgemeinen Verirrungen der menschlichen Natur – eine besondere Höhle oder Grotte. Dies folgt aus der eigentüm lichen Natur eines jeden, aus der Erziehung und dem Verkehr mit anderen, aus den Büchern, die er gelesen hat, sowie daraus, dass er Autoritäten verehrt und bewundert, ferner daraus, wie er Eindrücke aufnimmt, ob vorein genommen oder mit ruhigem, ausgeglichenem Gemüt. (.) Der menschliche Geist ist also, je nach der Verfassung des einzelnen, ein unbeständiges, schwankendes, vom Zufall abhängiges Ding. Ganz richtig sagt Heraklit 1, dass „die Menschen ihr Wissen aus ihren kleinen Welten schöpfen, nicht aus der großen und gemeinsamen. Auch aus der gesellschaftlichen Verbindung der Menschen untereinander erwachsen gewisse Vorurteile, die ich daher Idole des Marktes nenne. Das verbindende Medium zwischen den Menschen ist die Sprache; aber die Worte werden den Dingen gemäß der Fassungskraft der Menge zugewiesen, und so wird der Verstand durch unpassende und schiefe Wortbezeichnungen in merkwürdiger Weise irregeführt. Die Definitionen und Erklärungen, mit denen die Gelehrten sich manchmal absichern, beheben diese Übel keineswegs. Die Worte tun dem Verstand wahrhaft Gewalt an, bringen alles durcheinander und führen zu vielen leeren Streitereien und Scheinproblemen. Endlich gibt es noch Idole, die durch verschiedene philosophische Richtungen und verkehrte Beweismethoden in den menschlichen Geist eingedrungen sind; ich nenne sie Vorurteile der Bühne. Meiner Ansicht nach sind nämlich alle bisher entwickelten und akzeptierten philosophischen Systeme samt und sonders Fabeln und Spiele einer erdichteten Theaterwelt. Das gilt nicht nur von ganzen philosophischen Systemen, sondern auch von manchen Prinzipien und Axiomen der Einzelwissenschaften, die durch Tradition, Leichtgläubigkeit und Nachlässigkeit Geltung erlangt haben. (aus: Bacon, Francis: Novum Organon, Frankfurt am Main 1986, S. 18ff.) Aufgabenstellung: 1 Heraklit (ca. 544 – 483 v.u.Z.): ein den Vorsokratikern zugerechneter Philosoph der griechischen Antike. Finde für jede der vier genannten Vorurteilsarten jeweils ein Beispiel, das Bacons Gedanken illustriert! Vergleiche Bacons Idolenlehre dann mit einer anderen dir bekannten erkenntnistheoretischen Auffassung! Beurteile schließlich, ob der Ansatz Bacons auch heute noch von Bedeutung ist!