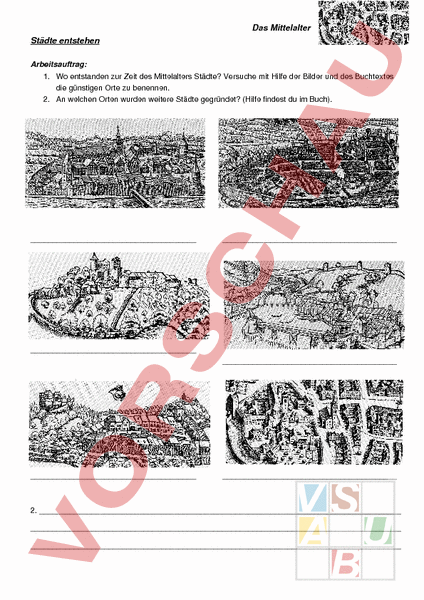Arbeitsblatt: Arbeitsblätter zur Postenarbeit "Leben in einer mittelalterlichen Stadt"
Material-Details
Arbeitsblätter zur Postenarbeit "Leben in einer mittelalterichen Stadt"
Passend zum Buch "Menschen i Raum und Zeit, Band6" Aber auch losgelöst möglich.
Geschichte
Mittelalter
6. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
43556
2170
101
05.08.2009
Autor/in
Rahel Niederhauser
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Städte entstehen Das Mittelalter Arbeitsauftrag: 1. Wo entstanden zur Zeit des Mittelalters Städte? Versuche mit Hilfe der Bilder und des Buchtextes die günstigen Orte zu benennen. 2. An welchen Orten wurden weitere Städte gegründet? (Hilfe findest du im Buch). 2. Die Bewohner der mittelalterlichen Stadt Das Mittelalter Wer wohnte in der Stadt? Wer vom Stadttor aus die engen Gassen der Stadt betrat, sah sofort, dass es ganz verschiedene Gruppen von Bewohnern gab. Am Stadtrand, in der Nähe der Stadtmauer, lagen viele Handwerksbetriebe, die mit offenem Feuer arbeiteten, vor allem Schmiede. Auch Bauernfamilien, Gärtner und Tagelöhner hatten sich hier niedergelassen. Die anderen Handwerker lebten oft dicht beieinander und häufig siedelte jedes Handwerk in einem bestimmten Viertel. Daran erinnern uns heute noch Strassennamen wie Schustergasse oder Schneidergasse. Die Handwerker mit ihren Familien, Gesellen und Lehrlingen stellten über die Hälfte der Stadtbevölkerung. Je näher man dem Zentrum kam, desto ansehnlicher wurden Strassen und Häuser. Direkt am Marktplatz standen die prachtvollsten Häuser. Hier lebten die Grund besitzenden Adligen und reichen Kaufmannsfamilien, die so genannten Patrizier. An Markttagen wimmelte es nur so von Menschen. Dann erschienen auch viele Krämer, d. h. kleine Händlerinnen und Händler, und die Bauernfamilien der Umgebung. Aber auch die Gaukler und Spielleute, die auf dem Markt ihr Können vorzeigten, waren dann auf dem Marktplatz anzutreffen. Die Geistlichen, Nonnen oder Mönche lebten in der Nähe der Kirchen oder in städtischen Klöstern. Sie waren der Anlaufpunkt für die Armen und Kranken der Stadt, die oft genug keinen festen Wohnsitz hatten. verteidigen. Bürger In unserer Gesellschaft werden alle Menschen als Bürgerinnen und Bürger bezeichnet. Das war in der mittelalterlichen Stadt anders. Ihre Bewohner waren zwar von keinem Grundherrn abhängig und für sie galt der Ausspruch Stadtluft macht frei. Jedoch verfügten nicht alle Bewohner über die gleichen Rechte. Wer als Bürger in die Stadtgemeinde aufgenommen werden wollte, musste über Grundbesitz verfügen und ein Handwerk oder Handelsgeschäft ausüben. In einem Eid schwor er, regelmässig Steuern zu zahlen, auf der Stadtmauer Wachdienste zu leisten und die Stadt notfalls gegen Angreifer zu Einwohner Neben den Bürgern mit den vollen Bürgerrechten gab es die so genannten Einwohner. Sie hatten weder Grundbesitz noch waren sie selbstständig. Zu ihnen gehörten Teile der Handwerker, Gesellen, Mägde, Knechte, Dienstboten, Tagelöhner. Diese Personen durften sich zumeist nur auf Widerruf in der Stadt aufhalten. Bei Gefahren von aussen konnten sie jedoch sehr wichtig werden und sich an der Verteidigung der Stadt beteiligen. Dann liess der Rat der Stadt sie schwören, treu und gehorsam zu sein. Randständige Neben den Bürgern und den Einwohnern gab es noch die Randständigen. Das waren entweder Leute, die nicht sesshaft waren, also von Stadt zu Stadt zogen. Dazu gehörten: Wanderbettler, entlassene Söldner, Akrobaten, Spielleute und Zigeuner. Zu den sesshaften Randgruppen zählten zum Beispiel die Bettler, Aussätzige und Angehörige von unehrlichen Berufen. Zu den unehrlichen Berufen gehörten alle Tätigkeiten, die verachtet wurden, zum Beispiel weil die Arbeiten Ekel erregend waren. Dazu zählten: der Henker, die Totengräber, der Bader und die Prostituierten. Arbeitsauftrag: 1. Vergleiche die Aufteilung von „Bürger – „Einwohner – „Randständige mit unserer Gesellschaftsstruktur heute. Gibt es bei uns heute eine ähnliche Einteilung? Die Zünfte Das Mittelalter Die Aufgaben der Zünfte Das Handwerk der mittelalterlichen Städte war in Zünften organisiert. Ihnen standen Zunftmeister vor. Da Zunftzwang herrschte, man also in der Zunft organisiert sein musste, wenn man in der Stadt einen Betrieb eröffnen wollte, gelang es den Zünften, die Zahl der Zulassungen zu begrenzen und so die Konkurrenz einzuschränken. Auch Werbung gab es nicht. Die Zünfte kontrollierten Qualität und schrieben Preise vor (Festpreise), nutzten günstige Einkaufs und Verkaufsmöglichkeiten für alle Meister, regelten die Arbeitszeit (12 16 Stunden Arbeit, etwas weniger als ein Drittel des Jahres sind Sonn und Feiertage), vermittelten Gesellen an Meister (Arbeitsvermittlung), und waren an der Ausbildung beteiligt. Der Lehrling wurde dem Meister durch die Zunft zugewiesen. Nachdem er das Gesellenstück erfolgreich abgelegt hatte, wurde er Geselle und ging auf Wanderschaft, die ihn auch ins Ausland führen konnte. Noch heute gehen z.B. Zimmermannsgesellen zwecks Ausbildung auf Wanderschaft (Walz). Nach gewöhnlich 4 Jahren legte er sein Meisterstück ab, wurde so Meister, eröffnete mit Zustimmung der Zunft eine Werkstatt und gründete eine Familie. Lehrling und Geselle wohnten übrigens in der Wohnung des Meisters, Werkstatt und Wohnung lagen im selben Haus. Der Meister war gegenüber dem Lehrling erziehungsberechtigt. Viele heutige Namen gehen auf das Handwerk der Städte zurück, z.B. Schmid, Metzger, usw. Zünfte bestanden bis ins 19. Jahrhundert. Alles klar? – Fülle den Lückentext aus! Die Handwerker waren in zusammengeschlossen. Ihre wichtigste Aufgabe bestand darin, jedem Mitglied sein zu verschaffen. Die Zünfte legten deshalb die der Waren fest. Niemand durfte die Ware unter dem festgesetzten verkaufen. So wurde der unter den Mitgliedern ausgeschaltet. Die Zunftmitglieder hatten von dieser Regelung nicht nur, sondern auch. Handwerksmeister, die in derselben Zunft mehr Waren als die anderen herstellten, mussten ihre Waren genauso teuer verkaufen, wie die anderen Mitglieder der. Die Zunft regelte auch die der Lehrlinge und Gesellen. Sie unterstützte ihre Mitglieder bei oder im . Sie vertraten die Interessen ihrer Mitglieder auch gegenüber den reichen . Welche Zunftwappen gehören zu welchen Zünften? Nenne einige Familiennamen, die auch ehemalige Handwerksberufe hinweisen! Kennst du in Muttenz oder Umgebung Strassen oder Gassen, die nach Handwerksberufen benannt sind? Das Mittelalter Handel treiben Sicherlich warst du schon einmal an einem Markt in Liestal, Basel oder in einer anderen Stadt. Mit ihren Buden, Ständen und mittelalterlichen Produkten locken sie viele Menschen an. Für uns sind solche Veranstaltungen ein Blick zurück in die Geschichte. Für die Menschen des Mittelalters waren die städtischen Märkte dagegen etwas sehr Modernes. Am Anfang noch Bauern – dann eine immer bessere Arbeitsteilung Die Bauernfamilien produzierten ihre , ihreund zumeist selbst, sie waren \. Mit der Entstehung und Ausbreitung der Städte stieg die Anzahl der Menschen stark an, die mit Nahrungsmitteln versorgt werden mussten. Deren Bedarf deckten die der Umgebung, die ihre in die Stadt auf den Markt brachten. Andere Waren, z.B. Seidenstoffe oder Gewürze aus China, bezogen Grosskaufleute über den und verkauften sie über Händler auf den weiter. Die Handwerker der Stadt waren hauptberuflich damit beschäftigt, Produkte für den herzustellen. Sie kauften von dem ihrer Waren Nahrung und Kleider. So bildete sich unter Bauern, Handwerkern und Kaufleuten eine immer feinere _ heraus. Arbeitsgeräte Arbeitsteilung Bauern Erlös Fernhandel Haushaltsbedarf – Nahrungsmittel – Kleidung Märkten Produkte – Selbstversorger Kaufleute und Kauffrauen – Erfinder der Globalisierung? Im 12. und vor allem im 13. Jahrhundert blühte in den grossen Städten Europas der Handel auf. Einige Regionen entwickelten sich zu Handelszentren, wo sich die europäischen Händler regelmässig zu grossen Messen trafen: Die französische Champagne, Oberitalien mit Venedig, Genua, Mailand und Florenz; ebenso Flandern mit der Hauptstadt Brügge. Der Tausch von Ware zu Ware wurde wegen seiner Umständlichkeit durch die Geldwirtschaft verdrängt, die bis heute unseren Alltag prägt. Bankhäuser entstanden zuerst in Oberitalien. Die Kaufleute waren jedoch nicht nur Männer. Immer mehr Frauen arbeiteten im 14. und 15. Jahrhundert als Gross und Fernhändlerinnen. Viele Ehefrauen führten mit ihren Männern gemeinsam die Geschäfte. Wie die Handwerker schlossen sich die Kaufleute in Gilden zusammen. Auf dem Markt Peter und sein Vater gehen durch eine schmale Strasse. Als ein Wagen entgegenkommt, müssen sie nahe an eine Hauswand ausweichen. Die Häuser sind so eng gebaut, dass keine Gärten dazwischen Platz haben. Die Balken der Fachwerkbauten gefallen Peter, denn sie sind schön bemalt. Manche Häuser haben im oberen Stock einen Erker. Die Dächer waren wie im Dorf mit Stroh oder Holzschindeln gedeckt. Über einer Tür hängt ein Stiefel und im Fenster liegen Schuhe. Einige Häuser weiter steht ein Kupferkessel vor einer Werkstatt. Gustav bleibt stehen und schaut dem Meister zu. Da sieht er über einem anderen Eingang ein gemaltes Schild, das dem Haus den Namen gibt. Arbeitsaufträge: 1. Wie waren die Strassen der mittelalterlichen Stadt? Was erfährst du über die Häuser der Bürger? An den Häusern hat man Zeichen angebracht. Weshalb? Versuche die Zeichen zu entziffern. Frauen im Handel In erstaunlichem Umfang waren Frauen am Handel beteiligt. Möglich war dies nur, weil die Frau seit dem 13. Jahrhundert als voll geschäftsfähig galt. Sie konnte eigenständig Geschäfte tätigen, Prozesse führen, über ihr Einkommen testamentarisch verfügen1 und haftete bei Schulden oder Konkurs. Frauen führten die Buchhaltung, vertraten den Mann in Zeiten der Abwesenheit oder wenn dieser durch städtische Ämter belastet war. Sie besuchten Märkte und Messen, unternahmen Handelsreisen. Sie handelten mit Wein genauso wie mit Tuchen oder Metallwaren. Ende des 15. Jahrhunderts gehörte bespielsweise eine Frau zu den bedeutendsten Stahlimporteuren Kölns. Aber man muss wissen, dass dies trotz allem Einzelfälle waren Arbeitsauftrag: 1. Betrachte dir das Bild. Über welche Kenntnisse und Fertigkeiten musste die Frau verfügen, um die gezeigte Tätigkeit ausüben zu können? 2. Woher hatten die Frauen zu dieser Zeit das nötige Wissen um diese Tätigkeiten ausführen zu können? Was meinst du? (Tipp: Um diese Frage beantworten zu können, brauchst du dein gesamtes „MittelalterWissen) 1 Bestimmen, wer nach ihrem Tod ihr Vermögen erbt.