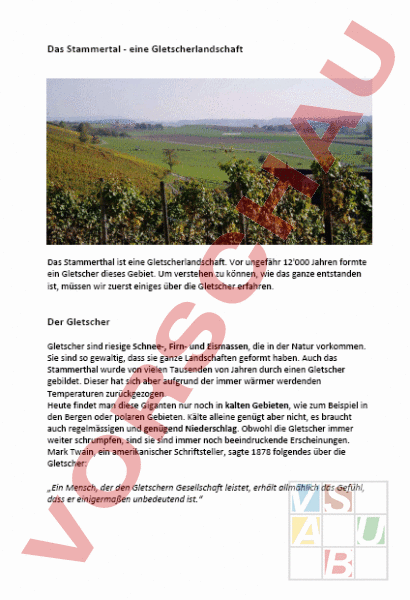Arbeitsblatt: Gletscher im Stammertal
Material-Details
Informationen zu Gletschern allgemein, aber auch auf das Stammertal bezogen.
Geographie
Schweiz
5. Schuljahr
6 Seiten
Statistik
43774
746
5
07.08.2009
Autor/in
Stephan Vögeli
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Das Stammertal ‐ eine Gletscherlandschaft Das Stammerthal ist eine Gletscherlandschaft. Vor ungefähr 12�00 Jahren formte ein Gletscher dieses Gebiet. Um verstehen zu können, wie das ganze entstanden ist, müssen wir zuerst einiges über die Gletscher erfahren. Der Gletscher Gletscher sind riesige Schnee‐, Firn‐ und Eismassen, die in der Natur vorkommen. Sie sind so gewaltig, dass sie ganze Landschaften geformt haben. Auch das Stammerthal wurde von vielen Tausenden von Jahren durch einen Gletscher gebildet. Dieser hat sich aber aufgrund der immer wärmer werdenden Temperaturen zurückgezogen. Heute findet man diese Giganten nur noch in kalten Gebieten, wie zum Beispiel in den Bergen oder polaren Gebieten. Kälte alleine genügt aber nicht, es braucht auch regelmässigen und genügend Niederschlag. Obwohl die Gletscher immer weiter schrumpfen, sind sie sind immer noch beeindruckende Erscheinungen. Mark Twain, ein amerikanischer Schriftsteller, sagte 1878 folgendes über die Gletscher: „Ein Mensch, der den Gletschern Gesellschaft leistet, erhält allmählich das Gefühl, dass er einigermaßen unbedeutend ist. Aufbau eines Gletschers 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Schneefelder Firnfelder Randspalten Längspalten Querspalten Seitenmoräne Mittelmoräne 8. Gletscherabbruch 9. Gletscherzunge 10. Geltschertor 11. Gletscherbach 12. Trogwand 13. Nährgebiet 14. Zehrgebiet Trage die Nummern an der richtigen Stelle im Bild ein. Der Text hilft dir dabei, die die verschiedenen Begriffe zu verstehen. 1 Bild aus Robert C. Bachmann, Gletscher der Schweiz Oberhalb des Gletschers, auf den umliegenden Gebirgsflanken, liegen die Schneefelder (1). Aufgrund der tiefen Temperaturen wird der Schnee nur sehr langsam in Firn umgewandelt. Unterhalb befinden sich die Firnfelder (2), wo der Schnee sich bereits umgewandelt hat und sich weiter zu Eis wandeln wird. Aus diesen Firnfeldern wird der Gletscher genährt. In diesem Gebiet bewegt sich der Gletscher nicht talwärts, weil die Firnfelder am Fels angefroren sind. Unterhalb der Firnfelder befindet sich der Gletscherabbruch (8), unterhalb dieses ist der Gletscher immer leicht in Bewegung. Die Gletscherzunge (9) ist der Fortsatz des Gletschers und fliesst sehr langsam Richtung Tal. Aufgrund dieser Fliessbewegung entstehen auch Spalten. Randspalten (3) befinden sich am Rand der Gletscherzunge und reissen als Folge der grossen Reibung auf. Längsspalten (4) entstehen vor allem im oberen Teil des Gletschers wegen den Spannungen im Eis. Die Querspalten (5) hingegen treten auf, wenn der Gletscher über einen Fels fliesst. Da er über diese Schwelle schneller abfliesst, reisst das Eis auf. Der Gletscher führt immer viel Gestein und Geröll mit sich. Dieses lässt er auf der Seite der Gletscherzunge liegen. Diesen aufgeschichteten Wall nennt man Seitenmoräne (6). Stossen zwei Gletscherzungen zusammen, so werden deren Seitenmoränen zusammengelegt und es entsteht eine Mittelmoräne (7), die auf der Gletscherzunge als Geröllband erkennbar ist. Am Ende der Gletscherzunge entsteht das sogenannte Gletschertor (10), aus welchem der Gletscherbach (11) hinaus fliesst. An dieser Stelle ist der Gletscherbach weiss, da er ganz viel Gesteinsmehl führt. Dieses Wasser wird deshalb als Gletschermilch bezeichnet. Die Gletscherzunge fliesst heutzutage meist in einem Bergtal. Auf der Seite gibt die Trogwand (12) die Richtung vor. Der obere Teil, in dem sich die Schnee‐ und Firnfelder befinden, wird als Nährgebiet (13) bezeichnet. Der untere Bereich, in welchem der Gletscher gegen die Wärme ankämpft und an Substanz verliert, nennt man Zehrgebiet (14). Der Rückzug der Gletscher Heute finden wir in der Schweiz nur noch in den Bergen Gletscher vor. Während der Eiszeit aber waren die Gletscher überall. Die Schweiz, so wie wir sie heute kennen, war zu grössten Teilen von „ewigem Eis zugedeckt.2 Grösste Ausdehnung der Gletscher während der Eiszeit (vor ca. 20�00 Jahren) Heutiges vergletschertes Gebiet Die Gletscher haben also die Landschaften in der Schweiz nachhaltig geformt. So wurden zum Beispiel Berge und Hügel abgeschliffen oder Bäche von Schmelzwasser, die Täler in die Landstriche zogen. Im Mittelland wurden Tonnen von Geröll und Schutt abgelagert. Heute erinnert auf den ersten Blick nicht mehr vieles an die Eiszeit und die damalige Vergletscherung. Nur wer sich bewusst darauf achtet und das Wissen darüber hat, kann die typischen Erscheinungen deuten. So auch im Stammertal. Wie du auf der Karte siehst, war die Region um den Bodensee von Eis zugedeckt. Ungefähr vor 12�00 Jahren wurde es aber zu warm, so dass sich der Gletscher langsam zurück zog. Dieser Rückzug dauerte wieder mehrere Hundert Jahre. 2 Karte aus Robert C. Bachmann, Gletscher der Schweiz 1 2 4 5 2 Der Gletscher, der von Osten her im jetzigen Stammertal lag, zog sich gleichmässig zurück. Die Gletscherzunge ragte immer weniger weit nach Westen, obwohl die Eismassen andauernd westlich flossen. Der Gletscher transportierte also stets Geröll und Kies bis zum Ende seiner Zunge, wo er diesen schliesslich ablagern konnte. Daher entstand eine sehr flache und regelmässige Ebene vor Ober‐ und Unterstammheim (3), eine so genannte Schotterebene (1). Der Rückzug geriet aber ins Stocken, so dass das Ende der Gletscherzunge über mehrere Jahre hinweg an derselben Stelle war. Der Gletscher beförderte in dieser Zeit aber immer weiter Geröll und Kies, welches er jetzt am gleichen Ort anspülte und das sich langsam aufschichtete. So entstand eine Endmoräne (4), die das Stammertal heute teilt. Als sich der Gletscher wieder weiter Richtung Osten zurückzog, geschah dies so schnell, dass er Mulden hinterliess. Diese füllten sich mit Wasser und es entstanden die Seen, der Nussbaumer‐ und der Hüttwilersee. Diese Art von Seen werden Zungenbeckenseen (5) genannt. Begleitend während dem ganzen Rückgang des Gletschers wurde am Rande der Gletscherzunge auch Gestein, Kies und Geröll abgelagert und es entstanden die Seitenmoränen (2), die heute als ideale Rebhänge genutzt werden. Ein weiteres landschaftliches Überbleibsel der Vergletscherung sind die so genannten Drumlins. Es handelt sich dabei um relativ kleine, abgerundete Hügel, die einen tropfenförmigen Grundriss haben. Wenn man sich darauf achtet, findet man im Stammertal viele dieser Drumlins. Die Gletscher heute Auf der Karte hast du gesehen, dass es immer weniger Gletscher gibt. Vom Festland sind gerade mal no 10% der Fläche mit Gletschern bedeckt, so zu sagen alles, nämlich 98% davon befindet sich in den Polargebieten, also in der Antarktis und auf Grönland. Das Gebiet, das die Schweizer Gletscher abdecken, ist also verschwindend klein im Vergleich zum restlichen Festland und leider schrumpfen die Eisgiganten immer weiter. Folgende Bilder zeigen das auf eindrückliche und auch beängstigende Weise. Der Trientgletscher zum Beispiel verliert pro Jahr etwa 20 bis 50 Meter an Länge.3 Trientgletscher, Wallis: 1922 und 2006 Bisgletscher Randa, Weishorn: 1939 und 2005 3 Bilder von