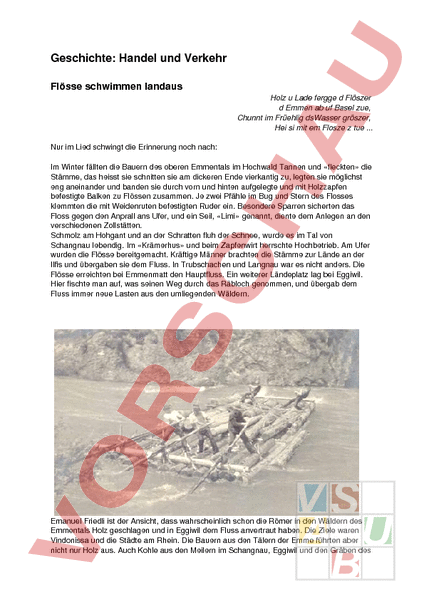Arbeitsblatt: Flösserei / Handelsstrassen
Material-Details
Verkehrsprobleme früher! Waghalsige Emmentaler exportieren ihre Erzeugnisse und verletzen die Interessen der Stadt Bern. Einsicht in die Produkte einer bäuerlichen Region. Verbindung zur weiten Welt durch Wasserstrassen.
Geschichte
Schweizer Geschichte
6. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
44781
1381
4
26.08.2009
Autor/in
Michael Brantschen
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Geschichte: Handel und Verkehr Flösse schwimmen landaus Holz Lade fergge Flöszer Emmen ab uf Basel zue, Chunnt im Früehlig dsWasser gröszer, Hei si mit em Flosze tue . Nur im Lied schwingt die Erinnerung noch nach: Im Winter fällten die Bauern des oberen Emmentals im Hochwald Tannen und «fleckten» die Stämme, das heisst sie schnitten sie am dickeren Ende vierkantig zu, legten sie möglichst eng aneinander und banden sie durch vorn und hinten aufgelegte und mit Holzzapfen befestigte Balken zu Flössen zusammen. Je zwei Pfähle im Bug und Stern des Flosses klemmten die mit Weidenruten befestigten Ruder ein. Besondere Sparren sicherten das Floss gegen den Anprall ans Ufer, und ein Seil, «Limi» genannt, diente dem Anlegen an den verschiedenen Zollstätten. Schmolz am Hohgant und an der Schratten fluh der Schnee, wurde es im Tal von Schangnau lebendig. Im «Krämerhus» und beim Zapfenwirt herrschte Hochbetrieb. Am Ufer wurden die Flösse bereitgemacht. Kräftige Männer brachten die Stämme zur Lände an der Ilfis und übergaben sie dem Fluss. In Trubschachen und Langnau war es nicht anders. Die Flösse erreichten bei Emmenmatt den Hauptfluss. Ein weiterer Ländeplatz lag bei Eggiwil. Hier fischte man auf, was seinen Weg durch das Räbloch genommen, und übergab dem Fluss immer neue Lasten aus den umliegenden Wäldern. Emanuel Friedli ist der Ansicht, dass wahrscheinlich schon die Römer in den Wäldern des Emmentals Holz geschlagen und in Eggiwil dem Fluss anvertraut haben. Die Ziele waren Vindonissa und die Städte am Rhein. Die Bauern aus den Tälern der Emme führten aber nicht nur Holz aus. Auch Kohle aus den Meilern im Schangnau, Eggiwil und den Gräben des Napfs schwamm vermutlich den Fluss hinunter. Ebenso im 17. Jahrhundert die «Müselen» und «Spälten», die als Brennstoff dienten. Solches Holz gelangte in grossen Mengen in die Eisenhütten des Wasseramtes. Im 18. Jahrhundert schwammen die Flösse bis nach Aarau und Rupperswil und wurden dort von den Holzhändlern in Empfang genommen. Sie trugen Bohlen und Bretter, Rieg und Rafenholz, besondere Hölzer für die Küfer und Wagner, allerhand Zaunholz und Latten, Stöcke für die Reben und Bohnenstichel, Kübler und Drechslerwaren. Neben diesen Transporten gelangten zudem Berge von Schindeln nach Basel und dem Elsass. Die Flösser führten ferner die Erzeugnisse der Emmentaler Alpwirtschaft mit sich. Mit schweren Lasten von Käse und Butter waren die berühmten «Molkenflosse» beladen. Aus den Büchern des Amtes Trachselwald erfährt man, dass sich die Metzger in Brugg, Baden und Basel Schlachtkälber bringen liessen. Die Obrigkeit sah diesen Handel nur ungern. Was der Boden hergab, sollte im Lande verbleiben. 1597 untersagte Bern alle Ausfuhr von Molken. Deren Verfrachtung, so hiess es, schmälere den Inlandmarkt und erhitze die Preise. Während des Dreissigjährigen Krieges hatte der «Ausverkauf» des Landes drohende Formen angenommen. Die Herren von Bern versuchten die Flösserei ganz zu unterbinden und fragten den Rat von Burgdorf an, ob er eine Kette über den Fluss spannen könne. Kein «Schiff» mehr landaus! Doch bald glitten die Flösse erneut an den Dörfern des Emmentals vorüber. 1641 wandte sich die Obrigkeit gegen das verantwortungslose Reuten und gegen das Veräussern des Holzes an die «Für» und «Aufkäufer». 1650 verboten die Gnädigen Herren die Ausfuhr von «Holz, wie auch Laden, Latten u. dgl.», denn dadurch würden die Hochwälder «erödet». Später machten sie das Holzflössen von einem Ausweis abhängig, den die Schaffner zu Trub und Langnau oder die Weibel im Eggiwil und im Schangnau ausstellen mussten, und übertrugen den Zöllnern längs der Emme die Kontrolle. An einzelnen Zollplätzen hatten die Flösser ihre Ware zu deklarieren. Schon bei der Schüpbachbrücke gab es eine solche Station. Manandate lösten einander ab, um die Flossfahrt in Schranken zu halten, doch man wusste sie zu umgehen. Handel und Wandel folgen eigenen Gesetzen. Das Flössen war kein ungefährlicher Beruf. Es bedurfte kräftiger Arme, um die oft bis zu 25 Meter langen, aus Bautannen gezimmerten Flösse heil durch alle Wendungen des Flusses, durch Schnellen und Engpässe zu steuern. Mit Stangen hielt die Mannschaft die Flösse vom Ufer ab. Als man das Flussbett verbaute, wurde «wegen der Flötzung . in mehreren Schwellen geklauset» mit andern Worten: man tiefte die Schwellen aus, um den Flössen einen ungehinderten Durchgang zu verschaffen. Um die Kunstbauten zu schonen, beschränkte die Obrigkeit 1766 die Länge der Flösse auf elf Meter. Gute Landestellen sollten das Anhalten und den Beschau der Flösse erleichtern. 1870 verbot die Regierung die Flösserei, die Eisenbahn übernahm die Transporte. Die Holzfrachten auf der Emme verschwanden, und mit ihnen ein Stück Romantik, das sie begleitet hatte. Arbeitsblatt 6. Kl. 1. Suche auf einer Bernerkarte • • die Ortschaften Langnau, Eggiwil, Schangnau den Hohgant und die Schrattenfluh • die Flüsse Ilfis und Emme • Wo begann die Fahrt eines Flosses? 2. Die Flösser führten viele Waren aus dem Emmental flussabwärts. 3. Erstelle von diesen eine Liste. Vielleicht vernimmst Du auch noch, wohin einzelne Produkte gebracht wurden. • Welchen Gewinn brachte die Flösserei den Emmentalen? Mit welchen Mitteln versuchte die Regierung, die Flösserei zu verhindern? • 5. • Warum sah die Regierung die Flösserei nicht gern? Stelle aus Ästen ein Modell eines Flosses her. Benutze dazu die Angaben, die am Anfang des Textes gemacht werden.