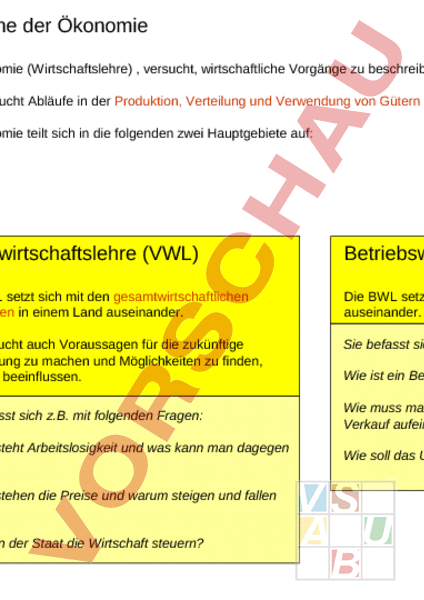Arbeitsblatt: Wirtschaftskunde
Material-Details
Powerpoint Präsentation mit verschiedenen Folien zur Wirtschaftkunde. Vom Wirtschaftskreislauf bis zurPreisbildung
Diverses / Fächerübergreifend
Anderes Thema
11. Schuljahr
33 Seiten
Statistik
44815
620
10
27.08.2009
Autor/in
raemsi (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Bereiche der Ökonomie Die Ökonomie (Wirtschaftslehre) versucht, wirtschaftliche Vorgänge zu beschreiben. Sie untersucht Abläufe in der Produktion, Verteilung und Verwendung von Gütern und Dienstleistungen. Die Ökonomie teilt sich in die folgenden zwei Hauptgebiete auf: Volkswirtschaftslehre (VWL) Betriebswirtschaftslehre (BWL) Die VWL setzt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Vorgängen in einem Land auseinander. Die BWL setzt sich mit den einzelnen Unternehmen auseinander. Sie versucht auch Voraussagen für die zukünftige Entwicklung zu machen und Möglichkeiten zu finden, diese zu beeinflussen. Sie befasst sich z.B. mit folgenden Fragen: Wie ist ein Betrieb zu organisieren? Sie befasst sich z.B. mit folgenden Fragen: Wie muss man Einkauf, Produktion, Lagerung und Verkauf aufeinander abstimmen? Wie entsteht Arbeitslosigkeit und was kann man dagegen tun? Wie soll das Unternehmen finanziert werden? Wie entstehen die Preise und warum steigen und fallen sie? Wie kann der Staat die Wirtschaft steuern? Bereiche der Ökonomie (2) Mikroökonomie Sie untersucht die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer Haushalte, Unternehmen, Staat Makroökonomie Sie betrachtet die Volkswirtschaft als Ganzes. Sie untersucht vor allem die Beziehungen zwischen den Märkten und den Wirtschaftsteilnehmern. Globalökonomie (Internationale Oekonomie) Sie betrachtet die Wirtschaftlichen Beziehungen weltweit. Sie untersucht die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Ländern. Das ökonomische Prinzip Wer statt mit einer kleinen Zahnbürste mit einem grossen Besen den Platz wischt, handelt ökonomisch. In der Wirtschaftslehre spricht man vom ökonomischen Prinzip. Man unterscheidet zwei verschiedene Prinzipien: Maximalprinzip Vorgegeben ist der Aufwand Das Ziel z.B. 10 Liter Benzin möglichst viele Kilometer Fahren Minimalprinzip Vorgegeben ist der Ertrag Das Ziel z.B. 100 km Fahren möglichst kleiner Aufwand (wenig Benzin verbrauchen) Ursachen des Wirtschaftslebens Einige Arbeitskollegen gestalten ihre Freizeit gemeinsam. Einer von ihnen hat für eine 600er Yamaha gespart. Damit erscheint er jeweils im Geschäft oder bei gemeinsamen Treffen. Empfinden eines Mangels Die Kollegen empfinden die eigenen Fahrzeuge als veraltet und demzufolge als Mangel. Der Wille zur Bedürfnisbefriedigung entsteht. Die Kollegen wünschen sich ein vergleichbares Verkehrsmittel. Ersparnisse Die Kollegen schränken ihre Ausgaben ein und sparen, um ihren Bedarf später zu decken. Auswahl und Kauf des Gutes Mit dem Ersparten kauft der eine eine 500er, der andere eine 750er Bedürfnis Bedarf Gut Empfinden eines Mangels, verbunden mit dem Willen, diesen Mangel zu beheben. Gütermenge, die es braucht, um die Bedürfnisse zu befriedigen Mittel zur Bedürfnisbefriedigung Die Einteilung der Bedürfnisse nach Dringlichkeit Die Bedürfnispyramide 5. Selbstverwirklichung 4. Bed. nach Achtung 3. Soziale Bedürfnisse 2. Sicherheitsbedürfnisse 1. Grundbedürfnisse Geistige Genüsse Geltung, Status, Prestige Partnerschaft, Freundschaft Versicherung, Vorsorge Nahrung, Wohnung, Kleidung Die Einteilung der Bedürfnisse nach Befriedigung Individualbedürfnisse Essen, Autofahren usw. Kollektivbedürfnisse Strassenbau, Versicherungen, Schwimmbäder, Spitäler Materielle Bedürfnisse Kleider, Möbel, Fernseher Immaterielle Bedürfnisse Liebe, Freiheit, Zugehörigkeit Die Güter Um unsere Bedürfnisse zu befriedigen brauchen wir Güter. Wir kaufen Lebensmittel oder einen Roller, wir gehen ins Kino, suchen einen Arzt oder Rechtsanwalt auf u.s.w. Wir unterscheiden folgende Arten von Gütern: Freie Güter Diese sind in der Natur praktisch unbeschränkt und unentgeltlich verfügbar Knappe Güter Sie sind nicht in beliebiger Menge verfügbar und haben deshalb einen bestimmten Preis. Sie heissen deshalb auch wirtschaftliche Güter. Konsumgüter Investitionsgüter Dienstleistungen Rechte Sie werden gebraucht oder verbraucht, danach existieren sie nicht mehr. Sie dienen zur Herstellung neuer Güter. Sie ermöglichen auch Dienstleistungen. Sie sind immaterielle Güter, nicht gegenständlich und sie können nicht auf Vorrat produziert werden. Ebenfalls immaterielle Güter, die ein Recht verkörpern. Nahrungsmittel, Genussmittel, Haushaltgeräte u.s.w. Maschinen, Fabriken, Fahrzeuge u.s.w. Dienstleistungen von Banken, Versicherungen, Ärzten u.s.w. Patente, Lizenzen, Urheberrechte Ergänzung zum Thema „Güter Das Patentrecht Was kann nicht patentiert werden? • Ideen, Konzepte, wissenschaftliche Theorien, Lernmethoden, organisatorische Abläufe usw. •Pflanzensorten und Tierarten Was kostet eine Patentanmeldung? •Je nach Aufwand zwischen 5000.- und 12000.-!!! Wie lange dauert der Patentschutz? •Der schweizerische Patentschutz besteht längstens 20 Jahre lang. •Ein Patent kann wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren vorzeitig erlöschen. •Nach Ablauf des Patents darf die Erfindung von jedermann benutzt werden. Das Urheberrecht Aus dem Bundesgestz über das Urheberrecht: Art. 29. Ein Werk ist urheberrechtlich geschützt, sobald es geschaffen ist, unabhängig davon, ob es auf einem Träger festgehalten ist oder nicht. Der Schutz erlischt: 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers für Computerprogramme. 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers für alle anderen Werke. Fragen und Antworten zum neuen Urheberrecht Darf ich weiterhin Kopien für den Privatgebrauch machen (CDs rippen etc.)? Ja, es ist zulässig, eine CD zum eigenen, persönlichen Gebrauch auf einen leeren Träger zu überspielen (Art. 19 Abs. 1 lit. URG). Dazu gehört auch der Gebrauch durch Familienangehörige und enge Freunde. Dafür sieht das Gesetz wie bisher eine Entschädigung auf Speichermedien vor. Darf ich Kopiersperren umgehen? Grundsätzlich dürfen wirksame technische Massnahmen (Zugangs- und Kopierkontrollen, Verschlüsselungs-, Verzerrungs- und andere Umwandlungsmechanismen) zum Schutz von Werken und anderen Schutzobjekten nicht umgangen werden. Das Gesetz sieht jedoch eine Ausnahme vor: Für die Erstellung von Privatkopien zum Eigengebrauch darf der Kopierschutz geknackt werden. Ist der Download nun illegal? Das Herunterladen von Werken über elektronische Bezahldienste bleibt legal und wird sogar von der gesetzlichen Vergütungspflicht für das Vervielfältigen zum Eigengebrauch ausgenommen. Die Frage, ob das Herunterladen von illegalen Quellen verboten ist, wurde noch nicht gerichtlich beantwortet. Die Meinungen gehen bei diesem Thema weit auseinander. Der Nationalrat hat in seinen Beratungen jedoch explizit auf ein Verbot des Downloads von illegaler Quelle verzichtet. Das Urheberrecht für den „Privatgebrauch Der Upload, das heisst das Anbieten von geschützten Werken im Internet ist nur mit Zustimmung des Urhebers erlaubt. Bei P2P Programmen also unbedingt die Freigabe von Musik auf der eigenen Festplatte sperren. Das downloaden ist in der Schweiz auch ohne Zustimmung des Urhebers erlaubt. In Deutschland ist das Herunterladen von offensichtlich illegalen Angeboten verboten. Brennen von CDs Erlaubt ist: • das Brennen von CDs für den eigenen, rein persönlichen Gebrauch. • das Brennen von CDs um diese Verwandten oder Freunden zu schenken. Verboten ist: • das Brennen von CDs zum Verkauf • das Brennen von CDs welche ausserhalb des Kreises von nahen Angehörigen und Freunden verschenkt werden Die Wirtschaftssektoren 1. Primärer Sektor (Landwirtschaftssektor) 3. Tertiärer Sektor (Dienstleistungssektor) Rohstoffgewinnung/Urproduktion, z.B. Landwirtschaft, Energiewirtschaft, Forstwirtschaft Es geht um die Gewinnung von Naturerzeugnissen. Dienstleistungen z.B. Banken, Handel, Versicherungen, Verwaltung, Verkehr, Gesundheitswesen, Bildung. Hier werden immaterielle Güter verbreitet. 2. Sekundärer Sektor (Industriesektor) Verarbeitung und Fabrikation, z.B. Industrie, Gewerbe (Maschinenbau, Chemie), Bauwirtschaft. Hier werden Güter verarbeitet und gefertigt. Die Entwicklung der Wirtschaftssektoren in der Schweiz 100% 80% 60% 3. Sektor 2. Sektor 40% 1. Sektor 20% 0% 1970 1980 1991 2000 2004 2005 Der einfache Wirtschaftskreislauf Bezahlung von Löhnen, Zinsen, Renten Produktionsfaktoren: Arbeit, Boden, Kapital VE Geldstrom Unternehmungen Güterstrom Haushalte BIP Güter und Dienstleistungen Zahlungen für für Güter Güter und und Dienstleistungen Dienstleistungen Zahlungen VE Volkseinkommen Summe aller Einkommen, die ein Volk im Laufe eines Jahres verdient BIP Bruttoinlandprodukt Wert aller Güter und Dienstleistungen, die innerhalb der Landesgrenzen im Laufe eines Jahres Produziert werden Zahlung der Exporte Der erweiterte Wirtschaftskreislauf Tourismus Exporte Zahlung der Importe Importe Auslandreisen Ausland Kapitalexporte Kapitalimporte Bezahlung von Löhnen, Zinsen, Renten Produktionsfaktoren: Arbeit, Boden, Kapital dit Kre arle e, Zi en Steu Au t räge vent io nen se Zinsen St ern Su arnis Zins nse Kredite, Darlehen Unternehmungen Ersp Banken Lö ern ne, lle zia S Staat Güter und Dienstleistungen Zahlungenfür fürGüter Güterund undDienstleistungen Dienstleistungen Zahlungen nge t i Haushalte Das Bruttoinlandprodukt Wachstum 400 350 300 250 200 150 1980 Nominelles BIP 1985 Teuerung 1990 Reales BIP 1995 1999 Die Produktionsfaktoren Bevor die Konsumentinnen und Konsumenten Güter und Dienstleistungen konsumieren können, müssen diese Produziert werden. Für die Herstellung dieser Güter und Dienstleistungen sind drei verschiedene Faktoren entscheidend: Boden Arbeit Kapital Der Boden schliesst alle natürlichen Ressourcen ein, die zur Herstellung von Gütern dienen. Sei es als Rohstofflieferant (Nahrungsmittel, Bodenschätze) oder als Produktionsstandort. Unter Arbeit versteht man die körperliche und geistige Tätigkeit des Menschen, die er braucht, um Güter und Dienstleistungen herzustellen Kapital beinhaltet Produktionsmittel, wie z.B. Geräte, Maschinen und Instrumente. Mit dem Einsatz von Kapital kann die Produktivität gesteigert werden. Wissen/Humankapital Unter diesem Produktionsfaktor versteht man die Fähigkeit, über bestimmte Dinge genaue Kenntnisse zu haben Wissen Know-how, Sachkompetenz Inflation Inflation und Deflation Eine Volkswirtschaft befindet sich im Gleichgewicht, wenn der Geldstrom und der Güterstrom gleich gross sind. Oder anders gesagt, wenn die Geldmenge dem Warenangebot entspricht. Nehmen die Geld- und die Gütermenge um den gleichen Betrag zu oder ab, bleibt die Wirtschaft im Gleichgewicht. Ändert sich nur die eine der beiden Seiten, ist das wirtschaftliche Gleichgewicht gestört. Inflation Der Geldstrom vergrössert sich – es kommt mehr Geld in Umlauf, ohne dass sich der Güterstrom verändert. Für den Kauf der gleichen Gütermenge steht nun mehr Geld zur Verfügung. Man ist bereit mehr zu bezahlen, um die Güter zu erhalten. Deflation Der Geldstrom verkleinert sich – es ist weniger Geld in Umlauf. Da nun weniger Geld zur Verfügung steht, sinkt die Nachfrage nach Gütern – es kommt zu einem Angebotsüberschuss. Die Ursachen einer Inflation Der Geldstrom wird grösser und/oder der Güterstrom wird kleiner Von der Geldseite her Von der Güterseite her Die SNB setzt übermässig viel Geld in Umlauf, zum Beispiel weil die Kantone wegen Geldmangel mehr Kredite brauchen. Arbeitszeitverkürzung ohne Erhöhung der Produktivität. Die Banken gewähren zu viel Kredite. Die Nachfrage ist so gross, dass die Preise steigen. Übermässiger Zufluss von Geld aus dem Ausland (Exportüberschuss). Preissteigerungen im Ausland (importierte Inflation) Streiks: Sie vermindern die Güterproduktion. – Lange Streiks schädigen die Volkswirtschaft. Naturkatastrophen, Missernten und Kriege. Die Ursachen einer Deflation Der Geldstrom wird kleiner und/oder der Güterstrom wird Grösser Von der Geldseite her Von der Güterseite her Übermässige Steuern – es bleibt weniger für den Konsum. Überproduktion in wichtigen Branchen. Man erwartet sinkende Preise und spart vorerst. Importüberschüsse und Rekordernten. Rückgang der privaten Investitionen. Falsche Marktbeurteilungen führen zu einem Überangebot. Der Staat hält mit Aufträgen zurück – er braucht weniger Kredite. Die Folgen einer Inflation Abnahme der Kaufkraft des Geldes – die Preise steigen. Entwertung der Geldguthaben der Gläubiger. Benachteiligung der Sparerinnen und Sparer. Bevorteilung der Schuldnerinnen und Schuldner. Die Schulden verlieren an Wert. Kapitalflucht: Das Geld wird angelegt in Sachwerte (Grundstücke, Kunstgegenstände, Gold ) Die grosse Nachfrage nach Gütern bringt eine Steigerung der Produktion und damit eine Erhöhung der Beschäftigung. Die Folgen einer Deflation Die Kaufkraft des Geldes nimmt zu. Die Preise sinken, die Löhne stagnieren oder schrumpfen. Aus Angst vor der wirtschaftlichen Zukunft wird mehr gespart, dadurch geht die Nachfrage zurück. Die Produktion sinkt und die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Wirtschaftsformen Als Wirtschaftsform wird die Art und Weise bezeichnet, in der Waren und Dienstleistungen produziert, gehandelt und verbraucht wird. In der Volkswirtschaftslehre unterscheidet man zwischen zwei theoretischen Grundformen. Die freie Marktwirtschaft Die zentrale Planwirtschaft Was konsumiert oder produziert werden soll wird von allen Beteiligten (Unternehmen und Haushalte) völlig frei entschieden. Was produziert werden soll, wird von einer staatlichen Planstelle koordiniert und gesteuert. Jeder will einen möglichst hohen Gewinn erzielen. Der Staat greift nicht ins wirtschaftliche Geschehen ein. Er soll die Freiheitsrechte garantieren und sich aufs wesentliche beschränken (Rechtssystem, stabile Währung, Sicherheit). Anreiz bilden nicht Gewinn und Nutzen, sondern Auszeichnung und Strafen. Planwirtschaften sind ineffizient. Es fehlen Anreize wie Eigeninitiative oder Aussicht auf Gewinne. Folgen sind Fehlplanungen, Ressourcenverschwendungen und Bürokratisierung. Die soziale Marktwirtschaft – Wirtschaftsordnung der Schweiz Die Steuerung der Wirtschaft erfolgt primär über den Markt. Das Gewinnstreben des einzelnen ist die treibende Kraft. Wo der Marktmechanismus versagt, greift der Staat ins Wirtschaftsgeschehen ein. Der freie Markt versagt zum Beispiel dort, wo eine Nachfrage vorhanden ist, aber für Anbieter kein Gewinn herausschaut (meist kollektive Bedürfnisse aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales). Eingriff bei Fehlentwicklungen Er greift dort ein, wo aufgrund des freien Wettbewerbs Fehlentwicklungen entstehen. – Naturschutz, Arbeitsrecht, Bodenmarkt. Schutz vor Missbrauch Er sorgt dafür, dass der Wettbewerb dort wieder herrscht, wo er eingeschränkt ist. Bereitstellung der Infrastruktur Er nimmt Verantwortung wahr, wenn es um die Bereitstellung der Infrastruktur geht. – Spitäler, Strassen, Schulen . Zollmassnahmen Der Staat greift ins Wirtschaftsgeschehen ein Über Zölle und Normen übt der Staat grossen Einfluss auf die Wirtschaft aus. Geldleistungen Direktzahlungen Wirtschaftliche eigentätigkeit Der Staat ist auch selber wirtschaftlich tätig. Er ist Teilhaber der Post und Besitzer der SBB. Wo die Erhaltung eines Wirtschaftszweiges im allgemeinen Interesse liegt, greift der Staat unterstützend ein Nachfrage Wie verändert sich die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt gleicher Qualität, wenn sich der Preis ändert? Verkaufe ich mein Produkt relativ teuer, z.B. für 4 Franken, wird die Nachfrage gering sein. Preis pro Stück in CHF X X Nachgefragte Menge 900 800 700 600 500 400 300 200 100 5.- 4.- 3.- 2.- 1.- Verkaufe ich mein Produkt relativ billig, z.B. für 1 Franken, wird die Nachfrage gross sein. Sinkende Preise erhöhen die Nachfrage. Steigende Preise senken die Nachfrage. Angebot Wie verändert sich das Angebot nach einem bestimmten Produkt gleicher Qualität, wenn sich der Preis ändert? Erzielt ein Produkt auf dem Markt kleine Preise, z.B. 1 Franken, lohnt es sich für die Produzenten nicht, viel herzustellen. Preis pro Stück in CHF X X Angebotene Menge 900 800 700 600 500 400 300 200 100 5.- 4.- 3.- 2.- 1.- Erzielt ein Produkt auf dem Markt einen guten Preis, z.B. 4 Franken, sind die Produzenten bereit, viel herzustellen. Steigende Preise erhöhen das Angebot. Sinkende Preise senken das Angebot. Marktpreis In unserem Wirtschaftssystem (Marktwirtschaft) übernimmt der Markt den Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage. Über den Preis werden Angebot und Nachfrage gesteuert: Der Preis steigt Der Preis sinkt Die Anbieter erhöhen die Menge ihrer Ware auf dem Markt, um damit mehr Geld zu verdienen. Es sind immer mehr Nachfrager an dem Produkt interessiert. Dagegen sind immer weniger Nachfrager bereit zu kaufen, wenn der Preis steigt. Die Anbieter reduzieren die Menge, da der Gewinn nun kleiner ist. Marktpreis Zeichnet man nun Angebot und Nachfrage in ein einziges Diagramm, sieht das folgendermassen aus: Preis Angebot Nachfrage Menge 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Gleichgewichtspreis 5.- 4.- 3.- 2.- 1.- Gleichgewichtsmenge Wo sich die Nachfragekurve und die Angebotskurve schneiden, befindet sich der Marktpreis oder Gleichgewichtspreis. Das heisst, Menge und Preis befinden sich im Gleichgewicht. Es werden genau soviele Produkte hergestellt, wie der Markt erträgt. Marktmechanismen Die Angebots- und Nachfragekurven gelten nur, sofern die Käufer und Verkäufer ihr Verhalten nicht ändern. Im Alltag können verschiedene Faktoren das Marktverhalten beeinflussen: Die Käufer (Nachfrager) Die Verkäufer (Anbieter) Höheres oder niedrigeres Einkommen Ernteschwankungen Änderung von Geschmack und Ansprüchen Konkurrenz durch neue Anbieter auf dem Markt. Sättigung des Bedarfs Steigerung der Produktivität Bei gleichbleibender Angebotskurve Preis Angebot Nachfrage Menge 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Gleichgewichtspreis 5.- 4.- 3.- 2.- 1.- Die Nachfrage nimmt ab – die Nachfragekurve verschiebt sich nach links Der Marktpreis sinkt! Bei gleichbleibender Angebotskurve Preis Menge 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Gleichgewichtspreis Angebot Nachfrage Gleichgewichtspreis 5.- 4.- 3.- 2.- 1.- Die Nachfrage nimmt ab – die Nachfragekurve verschiebt sich nach links Der Marktpreis sinkt! Die Nachfrage nimmt zu– die Nachfragekurve verschiebt sich nach rechts Der Marktpreis steigt! Bei gleichbleibender Nachfragekurve Preis Angebot Nachfrage Menge Das Angebot nimmt ab – die Angebotskurve verschiebt sich nach links 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Gleichgewichtspreis 5.- 4.- 3.- 2.- 1.- Der Marktpreis steigt! Bei gleichbleibender Nachfragekurve Preis Angebot Nachfrage Menge Das Angebot nimmt ab – die Angebotskurve verschiebt sich nach links 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Gleichgewichtspreis Gleichgewichtspreis 5.- 4.- 3.- 2.- 1.- Der Marktpreis steigt! Das Angebot nimmt zu– die Angebotskurve verschiebt sich nach rechts Der Marktpreis sinkt!