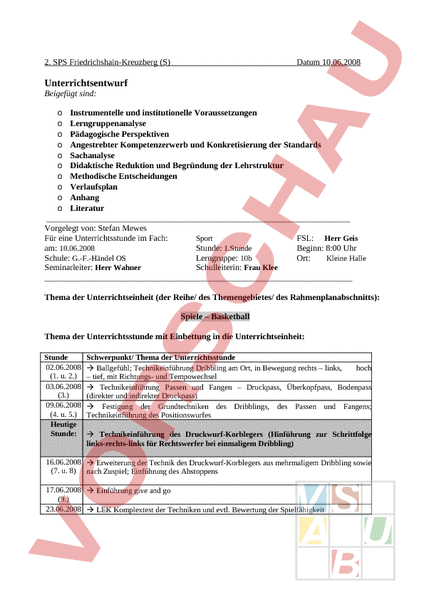Arbeitsblatt: Korbleger Basketball
Material-Details
Einführung des Korblegers in einer 10. Klasse Gymnasium
Bewegung / Sport
Anderes Thema
10. Schuljahr
14 Seiten
Statistik
45455
839
11
09.09.2009
Autor/in
Stefan Mewes
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
2. SPS Friedrichshain-Kreuzberg (S) Datum 10.06.2008 Unterrichtsentwurf Beigefügt sind: Instrumentelle und institutionelle Voraussetzungen Lerngruppenanalyse Pädagogische Perspektiven Angestrebter Kompetenzerwerb und Konkretisierung der Standards Sachanalyse Didaktische Reduktion und Begründung der Lehrstruktur Methodische Entscheidungen Verlaufsplan Anhang Literatur Vorgelegt von: Stefan Mewes Für eine Unterrichtsstunde im Fach: Sport FSL: Herr Geis am: 10.06.2008 Stunde: 1.Stunde Beginn: 8:00 Uhr Schule: G.-F.-Händel OS Lerngruppe: 10b Ort: Kleine Halle Seminarleiter: Herr Wahner Schulleiterin: Frau Klee Thema der Unterrichtseinheit (der Reihe/ des Themengebietes/ des Rahmenplanabschnitts): Spiele – Basketball Thema der Unterrichtsstunde mit Einbettung in die Unterrichtseinheit: Stunde 02.06.2008 (1. u. 2.) 03.06.2008 (3.) 09.06.2008 (4. u. 5.) Heutige Stunde: Schwerpunkt/ Thema der Unterrichtsstunde Ballgefühl; Technikeinführung Dribbling am Ort, in Bewegung rechts – links, hoch – tief, mit Richtungs- und Tempowechsel Technikeinführung Passen und Fangen – Druckpass, Überkopfpass, Bodenpass (direkter und indirekter Druckpass) Festigung der Grundtechniken des Dribblings, des Passen und Fangens; Technikeinführung des Positionswurfes Technikeinführung des Druckwurf-Korblegers (Hinführung zur Schrittfolge links-rechts-links für Rechtswerfer bei einmaligem Dribbling) 16.06.2008 Erweiterung der Technik des Druckwurf-Korblegers aus mehrmaligem Dribbling sowie (7. u. 8) nach Zuspiel; Einführung des Abstoppens 17.06.2008 Einführung give and go (9.) 23.06.2008 LEK Komplextest der Techniken und evtl. Bewertung der Spielfähigkeit (10. u. 11.) 1 Instrumentelle und institutionelle Voraussetzungen Ich habe für die Unterrichtsgestaltung nur eine kleine Halle zur Verfügung, d.h. der Raum für die Basketballausbildung ist begrenzt. In der Halle befinden sich sechs Basketballkörbe, zwei Hauptkörbe und vier Nebenkörbe. Alle Körbe sind relativ dicht an den Seitenwänden angeordnet. Die Körbe über den Handballtoren, welche fest installiert sind, schließen sehr dicht mit diesen ab, wodurch eine Verletzungsgefahr besteht, auf welche die Schüler besonders hingewiesen werden müssen. Weiterhin sind die Nebenkörbe relativ nah an den Hauptkörben angeordnet, sodass beim Übungsbetrieb in Gruppen an allen Körben besonders auf ein gut geordnetes organisatorisches Vorgehen geachtet werden muss. In der Halle (längs) ist nur ein Basketballfeld auf dem Boden aufgezeichnet. Für die Unterrichtsreihe stehen insgesamt 35 Basketbälle, 22 Volleybälle, 8 Langbänke, 17 Medizinbälle, 32 Pylonen, 24 Reifen, 20 Springseile, 18 Parteibänder, 10 Slalomstangen, 25 Handbälle und 5 Hocker zur Verfügung. 2 Lerngruppenanalyse Die Lerngruppe der Klasse 10b der Georg-Friedrich-Händel-OS besteht aus 19 Mädchen und 11 Jungen. Die Schüler1 besuchen das Gymnasium seit der 5. Klasse. Es handelt sich um eine Schule mit musikalischem Schwerpunkt. Seit Februar 2008 bin ich mit drei Wochenstunden für die Unterrichtsgestaltung in der Lerngruppe 10b verantwortlich. Der Unterricht findet montags von 08.00 – 09.40 Uhr sowie dienstags von 08.00 – 08.45 Uhr statt. Momentan nehmen alle Schüler am Sportunterricht teil, wobei gelegentlich auch Austauschschüler diese Möglichkeit nutzen. 1.1 Allgemeine Voraussetzungen Die soziale und personale Kompetenz ist in der Klasse 10b im Allgemeinen gut ausgeprägt. Es herrschen ein freundlicher Umgangston, eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ein guter Gemeinschaftssinn. Zwischen den Schülern treten i.d.R. keine Spannungen auf, was sich daran zeigt, dass sie sich in Übungsphasen gegenseitig helfen und eine große Einsatzbereitschaft zeigen. Die gesamte Gruppe ist bereit in leistungsheterogenen Gruppen zu arbeiten, wobei sich 1 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur der Begriff „Schüler gewählt. Dieser schließt jedoch immer die weibliche Form mit ein. 2 die Mädchen dann deutlich mehr bemühen. Die Motivation zur aktiven Bewegung in der Klasse ist hoch, da den meisten Schülern der Sportunterricht großen Spaß macht. Die Schüler waren in den letzten Wochen während der kognitiven Phasen etwas unruhig und unkonzentriert, was daran liegen kann, dass sie viele Prüfungen durch den MSA-Abschluss zu absolvieren hatten. Anweisungen zu Übungen oder Spielerläuterungen werden deswegen gelegentlich nicht richtig aufgenommen. Insgesamt muss man aber feststellen, dass die vereinbarten Kommunikationsregeln, wie z.B. jemanden ausreden lassen, von allen Schülern eingehalten werden. Die Schule hat einen musikalischen Schwerpunkt, weshalb viele Schüler wenig Zeit haben, sich in Sportvereinen zu betätigen bzw. Sport in ihrer Freizeit zu treiben. Die Probenintensität ist enorm hoch und reicht bis in die späten Nachmittagsstunden hinein. Zwar zeigen alle Schüler eine hohe Leistungsbereitschaft im Unterricht, doch insgesamt muss man die Klasse als relativ leistungsschwach einschätzen (vgl. Kap. 2.2). 1.2 Spezielle Voraussetzungen Im Laufe des Schuljahres haben die Schüler ihre Sachkompetenz in den Bereichen „Laufen, Springen, Werfen, „Bewegen an und mit Geräten, „Fitness und „Spiele erweitert. Im Bereich „Spiele wurde Volleyball vermittelt. Die motorischen Fähigkeiten der Schüler sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Im Bereich „Fitness absolvierten alle Schüler einen Fitness-Parcours an unterschiedlichen Stationen. Hier zeigten besonders die Jungen gute und sehr gute Leistungen, vor allem Sascha, Filipe und Alexander. Der überwiegende Teil der Mädchen war eher leistungsschwach. Die koordinativen Fähigkeiten der Klasse sind als heterogen einzuschätzen. Im Bereich „Bewegen an und mit Geräten hatten die Jungen große Probleme hinsichtlich der Körperspannung. Die Mädchen zeigten durchschnittliche bis gute Leistungen. Am Händel-Gymnasium wird der Bereich „Spiele zweimal im Laufe eines Schuljahres laut schulinternem Curriculum durchgeführt. In der 10. Klasse erfolgt neben der Volleyballausbildung auch eine Unterrichtseinheit zum Thema Basketball. Es wurden bisher allgemeine technische Grundlagen, wie z.B. das Passen und Fangen, das Dribbling sowie der Positionswurf vermittelt. Der Schritt- oder Parallelstopp wurden noch nicht eingeführt. 3 Im Bereich Methodenkompetenz haben die Schüler schon Erfahrungen mit Bewegungsbeschreibungen gesammelt. Da die Schüler immer bemüht sind, ihnen erteilte Arbeitsaufträge zu erfüllen, gehe ich davon aus, dass es ihnen im Rahmen eines Stationsbetriebes möglich ist, sich grundlegende Techniken, wie z.B. den Druckwurf-Korbleger, selbständig zu erarbeiten. 3 Pädagogische Perspektiven Der Schwerpunkt der heutigen Stunde liegt in der pädagogischen Perspektive Leistung (das Erfahren, Verstehen und Reflektieren des Leistens beim Sporttreiben). Als sekundäre Perspektive wird Kooperation (das Kooperieren, . und das Sich-Verständigen) geschult (RLP, S. 10). 1.3 Angestrebter Kompetenzerwerb Der angestrebte Kompetenzzuwachs der Unterrichtsstunde bezieht sich auf folgende Bereiche: 1. „Mit Sprache, Wissen und Können situationsangemessen umgehen Die Schüler sollen: sportmotorische Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie sportliches Können verbessern 2. „Selbständig Handeln Die Schüler sollen: Bewegungsabläufe beobachten und Fehlerkorrekturen durchführen Informationen von Bewegungsvorbildern, Bildvorlagen, Zeichnungen und Bewegungsbeschreibungen in Bewegungshandeln umsetzen (RLP, S. 11) 1.4 Konkretisierung der Standards Standards des RahmenLehrplans Die Schüler erlernen den Druckwurf-Korbleger aus dem Zweikontakt-Rhythmus nach mehreren Dribblings. (vgl. RLP, S. 39) Konkretisierung der Standards für die vorliegende Stunde Motorisch und kognitiv: Die Schüler sind in der Lage, den Druckwurf-Korbleger in der Grobform, aus einem bis zwei Angehschritten mit Ball auszuführen, und die wesentlichen Bewegungsmerkmale zu nennen und zu demonstrieren. 4 Abschlussstandards der Jahrgangsstufe 10: Die Schüler wenden spielspezifische Fertigkeiten im gemeinsamen Spiel an. Die Schüler sind nach der Unterrichtsreihe Basketball in der Lage, den Druckwurf-Korbleger in der Grobform durchzuführen und im Spiel anzuwenden. Individuelle Kompetenzentwicklung: Minimalstandard: Die Schüler sind in der Lage, die wesentlichen Bewegungsmerkmale des Druckwurf-Korblegers anhand der in der Unterrichtsstunde gezeigten Lehrerdemonstration und einer Bildreihe zu nennen (z.B. Lena). Regelstandard: Die Schüler sind in der Lage, den Druckwurf-Korbleger in der Grobform, aus einem bis zwei Angehschritten mit Ball, auszuführen, und die wesentlichen Bewegungsmerkmale zu nennen und zu demonstrieren (z.B. Alexander). Optimalstandard: Die Schüler sind in der Lage, den Druckwurf-Korbleger in der Grobform, aus einmaligem Dribbling, auszuführen und Korrekturhinweise bei Technikfehlern ihrer Mitschüler zu geben (z.B. Tom). 4 Sachanalyse Beim Druckwurf-Korbleger wird der Ball nach dem Abdrücken vom linken Bein im flachen Schrittsprung mit beiden Händen gefangen. Der erste Bodenkontakt nach der Ballannahme erfolgt mit rechts, der zweite mit links. Vom linken Bein erfolgt sogleich der Absprung zum Korb. Unmittelbar nach der Ballannahme geht der Blick zum Korb und löst sich erst nach dem Wurf. Der Schrittsprung von links nach rechts, bei dem die Ballannahme erfolgt, ist deutlich länger als der nächste Stemmschritt von rechts nach links, der bei tiefem Körperschwerpunkt aus der Horizontalbewegung in die Vertikalbewegung überleitet. Voraussetzung für einen optimalen Absprung möglichst steil nach oben ist dabei ein leichtes Zurücklegen des Oberkörpers vor und während der letzten Kontakte rechts-links und ein Aufsetzen und Abrollen der Füße von der Ferse zum Ballen. Der Absprung vom linken Bein wird unterstützt durch aktives Hochführen des gebeugten rechten Schwungbeins. Im Moment des Absprungs bzw. in der Aufwärtsbewegung wird der Ball schnell mit beiden Händen dicht am Körper nach oben geführt und über Kopfhöhe die rechte Wurfhand hinter bzw. unter den Ball gebracht. Kurz vor Erreichen der maximalen Sprunghöhe erfolgt die eigentliche Wurfbewegung durch völliges Strecken des Wurfarms im Ellbogengelenk, verbunden mit dem Lösen der linken Hand vom 5 Ball. Es folgt ein Strecken des Handgelenks mit Abklappen der Hand nach vorn-unten. Die Wurfhand sollte sich dabei zwischen Ring- und Zielbrett möglichst hoch in Ringnähe befinden. Der Ball wird in der Regel indirekt, d.h. mit Hilfe des Zielbretts, in den Korb geworfen. Zielpunkt ist hier wie beim Standwurf die obere innere Ecke des Zielvierecks. Die Landung erfolgt auf beiden Beinen. (vgl. Steinhöfer/Remmert, S. 89-92). 1.5 Fehler und Korrekturmaßnahmen Beobachtung/Fehler Falsche Fußstellung in der Grundstellung (Füße stehen zu dicht zusammen, Füße nicht parallel etc.) Die Wurfbewegung erfolgt zu spät – der Werfer muss sich mit dem Oberkörper nach hinten lehnen, verfehlt das Ziel oder wirft gegen den Korbring. Der Schüler springt vom „falschen Bein ab. Korrektur Sofort korrigieren und Bewegungsvorstellung. Schulung der Schon während des Dribblings auf das Ziel orientieren. Tempo anpassen. Auf keinen Fall auf den Ball schauen. Hohes rhythmisches Dribbeln mit Hand- und Beinrhythmuswechsel. Der Schüler springt nach vorn und nicht nach Beim letzten Schritt Oberkörper zurücklehnen oben. und Ferse zuerst aufsetzen. Landung unter dem Korb auf beiden Beinen. Das Schwungbein bleibt beim Sprung hängen Steigesprünge mit betontem Schwungbeinoder wird nach hinten gebeugt. Knie-Einsatz. Der Ball wird zu hart und unkontrolliert an Aus der Grundstellung Steigesprung im das Brett geworfen. richtigen Winkel vorwärts/aufwärts. Korbleger mit betonter Ellbogenführung und Fingerspitzenkontrolle. Zielpunkt ist die obere innere Ecke des Zielvierecks. 1.6 Didaktische Reduktion – Begründung der Lehrstruktur Der Druckwurf-Korbleger ist neben dem Positionswurf der wichtigste Basketball-Grundwurf für Anfänger. Zudem ist er neben dem Sprungwurf der erfolgreichste und am häufigsten verwendete Wurf. Der Korbleger ist eine sehr komplexe Bewegung, die aus Ballannahme (nach dem Zuspiel oder aus dem Dribbling), Zweikontakt-Rhythmus, Sprung, Wurf und Landung besteht. Unter den Elementen Zweier-Kontakt, Sprung und Landung nimmt der ZweikontaktRhythmus eine zentrale Stellung ein. Seine methodische Einführung bildet daher die Grundlage zum Erlernen der komplexen Korblegerbewegung. 6 Der Zweikontakt-Rhythmus wird zunächst beim Korbleger und erst später beim Zweitaktstopp erlernt, weil dieser Weg ein optimales Erlernen des Korblegers ermöglicht. Nach Steinhöfer und Remmert wird bei umgekehrtem Vorgehen der Anfänger häufig den Korbleger fehlerhaft ausführen, indem er den Fluss der Korblegerbewegung nach vorn durch ein unnötiges Tiefverlagern des Körperschwerpunkts unterbricht. Diese fehlerhafte Bewegungsausführung, hervorgerufen durch ein vorheriges Üben des Zweitaktstopps, lässt sich dann nur mühsam korrigieren. Zu früh eingeführt und geübt, wird er die Motivation zum Basketball eher störend als fördernd beeinflussen. „Informationen von Bewegungsvorbildern, Bildvorlagen, Zeichnungen und Bewegungsbeschreibungen in Bewegungshandeln umsetzen wurde in dieser Lerngruppe meines Wissens noch nicht explizit geschult. Es handelt sich bei dieser Klasse zwar um eine leistschwache Lerngruppe bezüglich der Ausführung technischer Grundelemente des Basketballspiels, doch sind es die Schüler aus anderen Fächern gewöhnt, sich grundlegende Sachverhalte selbständig zu erarbeiten. Zur Schulung der oben genannten Fähigkeit empfiehlt es sich daher, den Druckwurf-Korbleger mittels eines Stationsbetriebes einzuführen. Dabei handelt es sich nicht um einen Stationsbetrieb im engeren Sinn. Die sechs Gruppen durchlaufen nicht sechs Stationen, sondern bleiben an einer Station und haben dort Arbeitskarten, die verschiedene Schwierigkeitsstufen bzw. „Stationen beinhalten. Dort können sie sich entscheiden, ob sie der vorgegebenen methodischen Lernfolge folgen (vgl. Arbeitskarten) oder auf einer Lernstufe stehen bleiben und weiterüben. Aus meiner Sicht bietet sich diese Vorgehensweise aus vier Gründen an: 1. Aufgrund der Hallenbedingungen ist eine andere Vorgehensweise hinsichtlich eines effektiven Übungsbetriebes kaum möglich. 2. Die Schüler können ihren Lernfortschritt selbst bestimmen und sich ggf. untereinander helfen und korrigieren, um auf die nächste Lernstufe zu gelangen. 3. Die Anwendung einer modifizierten (auf die Lerngruppe zugeschnitten) methodischen Reihe zur Erlernung des Druckwurf-Korblegers ist i.d.R. unumgänglich. 4. Die intensive selbständige Beschäftigung (kognitiv und motorisch) führt meines Erachtens zu einem besseren Lernerfolg. Der Korbleger ist eine sehr komplexe Bewegung, welche, wenn sie die Schüler nicht 7 überfordern und somit schnell demotivieren soll, didaktisch reduziert werden muss. Die in der Sachanalyse beschriebenen Bewegungsmerkmale sollen schülergerecht auf vier wesentliche Bewegungsmerkmale reduziert werden: 1. Hinführung zum Zweikontakt-Rhythmus aus einmaligem Dribbling 2. Aktiver Schwungbeineinsatz 3. Streckung des Wurfarmes und Wurf mit Abklappen des Handgelenks 4. Landung auf beiden Beinen im Gleichgewicht Die prägnanteste Reduktion bezieht sich dabei auf die koordinatorische Ausführung des Zweikontakt-Rhythmus. In den bisherigen Unterrichtsstunden sind mir die koordinativen Schwächen der gesamten Lerngruppe hinsichtlich des Zweikontakt-Rhythmus aufgefallen. Somit liegt der Fokus dieser Unterrichtsstunde hauptsächlich auf der Hinführung zur richtigen Schrittkombination für die Ausführung eines Druckwurf-Korblegers. Dabei wird auf eine reine Rhythmusschulung verzichtet, um einerseits das Gelernte – Positionswurf – auch beim Druckwurf-Korbleger anzuwenden und andererseits die Lerngruppe nicht mit einer stupiden Rhythmusschulung zu demotivieren bzw. zu überfordern. Die Hauptlernaktion dieser Stunde liegt in der selbständigen Erarbeitung des DruckwurfKorblegers mit Schwerpunkt auf der Schrittfolge. Folgende Lernschrittfolge erscheint zweckmäßig: 1 Ein kognitiver Einschub zu Beginn der Stunde soll eine direkte Anknüpfung an die vorangegangene Stunde bieten. Die Schüler reaktivieren ihr Wissen bezüglich der für den Positionswurf wichtigen Bewegungsmerkmale, die sie beim Korbleger auch benötigen. 2 Die Erwärmung greift die Inhalte der letzten Unterrichtsstunden und des Stundeneinstieges auf. Die Schüler wiederholen die Grundtechniken Dribbeln, Passen und Fangen sowie die Technikausführung des Positionswurfes. 3 Die erste kognitive Phase dient der Erarbeitung der wesentlichen Bewegungsmerkmale des Korblegers. 4 In der Erarbeitungsphase eignen sich die Schüler selbständig mit Hilfe einer Bildreihe sowie einer Arbeitskarte die für die Ausübung des Druckwurf-Korblegers wesentlichen Merkmale auf dieser Lernstufe (Lernschritt) an und setzen diese in praktisches Bewegungshandeln um. 8 5 Die zweite kognitive Phase dient der Ergebnissicherung der wesentlichen Bewegungsmerkmale des Korblegers im Plenum mit Hilfe einer Schülerdemonstration. 6 In der Anwendungsphase erfolgt die praktische Umsetzung des Erlernten. 7 Abschließend erfolgt eine Reflexion über das Erarbeitete, insbesondere der methodischen Vorgehensweise. Aus der Lernschrittfolge ergeben sich folgende Phasenziele: Die Schüler sind in der Lage, 1. den Duckwurf -Korbleger nach einem Angehschritt aus einem Winkel von 45 bei Benutzung des Zielvierecks in der Grobform auszuführen. Indikator: Die Schüler führen den Druckwurf-Korbleger mit Ball und einem Angehschritt in der Grobform aus. 2. den Duckwurf -Korbleger nach zwei Angehschritten aus einem Winkel von 45 bei Benutzung des Zielvierecks in der Grobform auszuführen. Indikator: Die Schüler führen den Druckwurf-Korbleger mit Ball und zwei Angehschritten in der Grobform aus. 3. den Duckwurf -Korbleger nach einmaligem Dribbling und der Schrittfolge linksrechts-links aus einem Winkel von 45 bei Benutzung des Zielvierecks in der Grobform auszuführen. Indikator: Die Schüler führen den Druckwurf-Korbleger mit Ball nach einmaligem Dribbling in der Grobform aus. 4. die wesentlichen Bewegungsmerkmale des Druckwurf-Korblegers zu nennen. Indikator: Ein Schüler nennt die wesentlichen Bewegungsmerkmale des Druckwurf-Korblegers. Wenn Ergänzungen oder Korrekturen notwendig sind, helfen andere Schüler dabei und nennen diese. 5. den Druckwurf-Korbleger in der Grobform im Spiel unter vereinfachten Bedingungen anzuwenden. 9 Indikator: Die Schüler wenden den Druckwurf-Korbleger in der Grobform an, indem sie ihn im Spiel Turmball in der Grobform realisieren. 5 Methodische Entscheidungen Schüler, die nicht an der Unterrichtsstunde aktiv teilnehmen können, erhalten einen Beobachtungsbogen. Sie sind dadurch kognitiv bezüglich des Stundenschwerpunktes eingebunden und haben die Gelegenheit, soweit es ihnen möglich ist, Korrekturhinweise für aktiv teilnehmende Schüler zu geben. Ich habe mich entschieden, die Stunde mit einem kognitiven Einschub zu beginnen, um direkt an die vorangegangene Stunde anzuknüpfen und bereits Erarbeitetes zu wiederholen. In der Erwärmung sollen die bereits erlernten Grundtechniken des Dribbelns, Passen und Fangens, sowie des Positionswurfs reaktiviert werden. Die Schüler sollen das kognitiv Erarbeitete nun auch motorisch wiederholen und zugleich optimal auf die Anforderungen der Stunde vorbereitet werden. Dabei werden sie in sechs Gruppen eingeteilt. Jeweils drei Gruppen stehen sich sozusagen gegenüber und bilden Partnergruppen. Die jeweils ersten Schüler dribbeln durch einen Slalomparcours bis zur Markierung und passen sich einen Ball durch Brustpass zu. Danach laufen sie durch den Parcours zurück und übergeben den Ball zum nächsten Mitspieler. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals mit verschiedenen Aufgabenstellungen (Überkopfpass, Positionswurf, .). Diese Vorgehensweise dient der Vorentlastung des Druckwurf-Korblegers. In der Erwärmung wird auf eine genaue Ausführung des Abstoppens zunächst verzichtet, da die verschiedenen Stopparten noch nicht eingeführt wurden. Alternativ wäre es jedoch möglich, die Stunde nach einer kurzen Begrüßung mit einer anderen Erwärmung zu beginnen, wie z.B. einem „Kleinen Spiel (Zauberball, Parteiball o.ä.). Da die Schüler bei der Erarbeitung des Stundenschwerpunktes wenig konditionell belastet werden, werde ich auf eine Dehnphase verzichten. Ich habe mich für die oben beschriebene Variante entschieden, da einerseits eine kognitive und motorische Reaktivierung aus den vorangegangenen Stunden erfolgt und andererseits diese Planung eine Zeitersparnis ergibt, wodurch die Klasse eher und ausführlicher an den zu schulenden Standards arbeiten kann. 10 Die kognitive Phase wird im Plenum abgehalten, um die Vorschläge aller Schüler gebündelt aufgreifen zu können. Dabei sollen sie anhand der Lehrerdemonstration wesentliche Bewegungsmerkmale des Druckwurf-Korblegers erkennen und möglichst wiedergeben können. Der Lehrer führt die Demonstration aus, um sicherzustellen, dass alle wesentlichen Bewegungsmerkmale in der Grobform erkennbar sind und richtig ausgeführt werden. Zunächst erfolgt dabei eine Demonstration ohne Ball, sodass die Schüler sich wirklich auf die Bewegungsmerkmale konzentrieren und nicht dadurch abgelenkt werden, ob ein Korberfolg erzielt wurde oder nicht. Nachdem sie ihre Beobachtungen präsentiert haben, werden die wesentlichen Bewegungsmerkmale von mir anhand einer Bildreihe zusammengefasst. In der Erarbeitungsphase werden alle Basketballkörbe genutzt. Die zuvor in der Erwärmungsphase eingeteilten Gruppen verteilen sich auf die sechs Körbe, lesen sich die Arbeitsaufträge an den Stationen durch und orientieren sich an den jeweiligen Bildreihen. Während der einzelnen Übungsphasen werden keine Zusatzaufgaben zwischen der Wurfaktion und dem Anstellen in der Reihe gefordert, da sich die Schüler voll auf das Stundenthema konzentrieren sollen. Wenn jedoch einzelne Schüler alle drei Lernstufen in der Grobform erreicht haben, können sie die Bildreihe III erweitern und sich den Übungsablauf (DruckwurfKorbleger nach mehrmaligem Dribbling) erarbeiten und üben. Als Orientierung für den richtigen Bewegungsablauf, insbesondere der richtigen Schrittfolge, dienen „Fußabdrücke, die auf den Boden geklebt sind. Dabei kommt es mir erst einmal nicht auf die Schrittlänge an, sondern nur auf die richtige Schrittfolge. In dieser Stunde wird nur der indirekte DruckwurfKorbleger von einer Seite (Rechtswerfer von rechts und umgekehrt) geübt, da fast alle Schüler in dieser Lerngruppe ansonsten überfordert wären und die Aufgabe demotivierend sein könnte (Trefferwahrscheinlichkeit). Die Schüler sollen sich den Inhalt Druckwurf-Korbleger selbständig erarbeiten, da sie so kognitiv gefordert und motiviert werden. Jeder Schüler kann dabei das für ihn angemessene Lerntempo wählen. Alternativ könnte man den Druckwurf-Korbleger auch über eine vorgeschaltete Rhythmusschulung einführen. Ich habe mich aus genannten Gründen (vgl. Kap. 4.2) dagegen entschieden. Die methodische Übungsreihe ist aus den bisherigen Beobachtungen der Klasse meinerseits bewusst in der Form ausgewählt worden, da die Lerngruppe große koordinative 11 Probleme hinsichtlich der Rhythmisierungsfähigkeit aufweist und mit Übungen, wie z.B. Druckwurf-Korbleger nach Anreichen des Balles, meiner Meinung nach überfordert wäre. In der Sicherungsphase (kog. Phase II) nennen die Schüler (bevorzugt werden Schüler, die nicht an dieser Stunde aktiv teilnehmen können) die wesentlichen Bewegungsmerkmale des Druckwurf-Korblegers. Ein guter Schüler demonstriert anschließend den Druckwurf-Korbleger. In der Anwendungsphase wird Turmball unter modifizierten Bedingungen gespielt. Es bietet die Möglichkeit, im Hinblick auf die Spielfähigkeit bereits erlernte Techniken (Positionswurf sowie Passen und Fangen) unter vereinfachten Wettkampfbedingungen anzuwenden. Des Weiteren kann der Druckwurf-Korbleger ohne Behinderung und Zeitdruck, aber dennoch motivierend angewendet werden, indem erst durch einen erzielten Korb mittels DruckwurfKorbleger ein Punkt realisiert werden kann. Weiterhin stellt eine Spielform zum Stundenende einen freudbetonten Abschluss dar. Alternativ könnte auch ein Übungsform, wie z.B. „räumt den Kasten frei angewendet werden. Allerdings wären die äußeren Bedingungen u.U. für eine gerade erlernte Technik ungünstig (Zeitdruck), weswegen die fachgerechte Ausführung in der Grobform i.d.R. nicht mehr realisiert werden kann. Im Schlussteil (Reflexion) sollen die Schüler ihren Lernprozess reflektieren, insbesondere der methodischen Vorgehensweise. Anschließend werde ich einen Ausblick auf die nächste Stunde geben und verabschiede die Schüler in ihre wohlverdiente Pause. 12