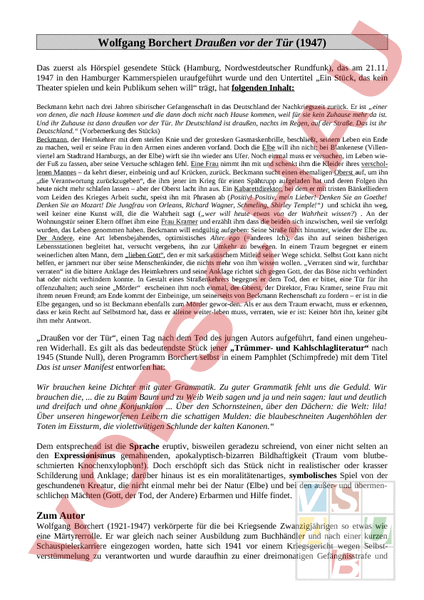Arbeitsblatt: Borchert "Draußen vor der Tür"
Material-Details
Merkblatt
Deutsch
Leseförderung / Literatur
10. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
45628
696
5
13.09.2009
Autor/in
Martina Frick
Land: Österreich
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Wolfgang Borchert Draußen vor der Tür (1947) Das zuerst als Hörspiel gesendete Stück (Hamburg, Nordwestdeutscher Rundfunk), das am 21.11. 1947 in den Hamburger Kammerspielen uraufgeführt wurde und den Untertitel „Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will trägt, hat folgenden Inhalt: Beckmann kehrt nach drei Jahren sibirischer Gefangenschaft in das Deutschland der Nachkriegszeit zurück. Er ist „einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen, nachts im Regen, auf der Straße. Das ist ihr Deutschland. (Vorbemerkung des Stücks) Beckmann, der Heimkehrer mit dem steifen Knie und der grotesken Gasmaskenbrille, beschließt, seinem Leben ein Ende zu machen, weil er seine Frau in den Armen eines anderen vorfand. Doch die Elbe will ihn nicht; bei Blankenese (Villenviertel am Stadtrand Hamburgs, an der Elbe) wirft sie ihn wieder ans Ufer. Noch einmal muss er versuchen, im Leben wieder Fuß zu fassen, aber seine Versuche schlagen fehl. Eine Frau nimmt ihn mit und schenkt ihm die Kleider ihres verschollenen Mannes – da kehrt dieser, einbeinig und auf Krücken, zurück. Beckmann sucht einen ehemaligen Oberst auf, um ihn „die Verantwortung zurückzugeben, die ihm jener im Krieg für einen Spähtrupp aufgeladen hat und deren Folgen ihn heute nicht mehr schlafen lassen – aber der Oberst lacht ihn aus. Ein Kabarettdirektor, bei dem er mit tristen Bänkelliedern vom Leiden des Krieges Arbeit sucht, speist ihn mit Phrasen ab (Positiv! Positiv, mein Lieber! Denken Sie an Goethe! Denken Sie an Mozart! Die Jungfrau von Orleans, Richard Wagner, Schmeling, Shirley Temple!) und schickt ihn weg, weil keiner eine Kunst will, die die Wahrheit sagt („wer will heute etwas von der Wahrheit wissen?) An der Wohnungstür seiner Eltern öffnet ihm eine Frau Kramer und erzählt ihm dass die beiden sich inzwischen, weil sie verfolgt wurden, das Leben genommen haben. Beckmann will endgültig aufgeben: Seine Straße führt hinunter, wieder der Elbe zu. Der Andere, eine Art lebensbejahendes, optimistisches Alter ego (anderes Ich), das ihn auf seinen bisherigen Lebensstationen begleitet hat, versucht vergebens, ihn zur Umkehr zu bewegen. In einem Traum begegnet er einem weinerlichen alten Mann, dem „lieben Gott, den er mit sarkastischem Mitleid seiner Wege schickt. Selbst Gott kann nicht helfen, er jammert nur über seine Menschenkinder, die nichts mehr von ihm wissen wollen. „Verraten sind wir, furchtbar verraten ist die bittere Anklage des Heimkehrers und seine Anklage richtet sich gegen Gott, der das Böse nicht verhindert hat oder nicht verhindern konnte. In Gestalt eines Straßenkehrers begegnet er dem Tod, den er bittet, eine Tür für ihn offenzuhalten; auch seine „Mörder erscheinen ihm noch einmal, der Oberst, der Direktor, Frau Kramer, seine Frau mit ihrem neuen Freund; am Ende kommt der Einbeinige, um seinerseits von Beckmann Rechenschaft zu fordern – er ist in die Elbe gegangen, und so ist Beckmann ebenfalls zum Mörder gewor-den. Als er aus dem Traum erwacht, muss er erkennen, dass er kein Recht auf Selbstmord hat, dass er alleine weiter-leben muss, verraten, wie er ist: Keiner hört ihn, keiner gibt ihm mehr Antwort. „Draußen vor der Tür, einen Tag nach dem Tod des jungen Autors aufgeführt, fand einen ungeheuren Widerhall. Es gilt als das bedeutendste Stück jener „Trümmer- und Kahlschlagliteratur nach 1945 (Stunde Null), deren Programm Borchert selbst in einem Pamphlet (Schimpfrede) mit dem Titel Das ist unser Manifest entworfen hat: Wir brauchen keine Dichter mit guter Grammatik. Zu guter Grammatik fehlt uns die Geduld. Wir brauchen die, . die zu Baum Baum und zu Weib Weib sagen und ja und nein sagen: laut und deutlich und dreifach und ohne Konjunktion . Über den Schornsteinen, über den Dächern: die Welt: lila! Über unseren hingeworfenen Leibern die schattigen Mulden: die blaubeschneiten Augenhöhlen der Toten im Eissturm, die violettwütigen Schlunde der kalten Kanonen. Dem entsprechend ist die Sprache eruptiv, bisweilen geradezu schreiend, von einer nicht selten an den Expressionismus gemahnenden, apokalyptisch-bizarren Bildhaftigkeit (Traum vom blutbeschmierten Knochenxylophon!). Doch erschöpft sich das Stück nicht in realistischer oder krasser Schilderung und Anklage; darüber hinaus ist es ein moralitätenartiges, symbolisches Spiel von der geschundenen Kreatur, die nicht einmal mehr bei der Natur (Elbe) und bei den außer- und übermenschlichen Mächten (Gott, der Tod, der Andere) Erbarmen und Hilfe findet. Zum Autor Wolfgang Borchert (1921-1947) verkörperte für die bei Kriegsende Zwanzigjährigen so etwas wie eine Märtyrerrolle. Er war gleich nach seiner Ausbildung zum Buchhändler und nach einer kurzen Schauspielerkarriere eingezogen worden, hatte sich 1941 vor einem Kriegsgericht wegen Selbstverstümmelung zu verantworten und wurde daraufhin zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe und anschließender Frontbewährung verurteilt. Die Jahre bis zum Kriegsende verbrachte er in Strafbataillonen, in Gefängnissen, in die er wegen „Wehrkraftzersetzung und Erzählen politischer Witze eingeliefert wurde und in Krankenhäusern. Sein dem Umfang nach schmales Werk, die Kurzgeschichten-Sammlung Die Hundeblume und An diesem Dienstag, sein Drama Draußen vor der Tür, eine Reihe von Gedichten und weiteren Kurz-geschichten, ist in der kurzen Zeit zwischen dem Eintritt in die akute Phase seiner Krankheit (Gelbsucht) 1946 und seinem Tod entstanden. Die wirkungsgeschichtlichen Hauptwerke können kaum die Orientierung Borcherts an expressionistischen Vorbildern verleugnen. Borchert selbst sah sich selbst immer nur als Teil der so genannten „Generation ohne Abschied, der gewissermaßen stellvertretend formulierte, was alle empfanden. Sein Werk gestaltet Emotionen, drückt Stimmungen aus und ruft kollektive (gemeinschaftliche) Erlebnisse wach. Ihm fehlt aber die über den Eindruck der Stunde hinausgehende Perspektive. Pläne und Programme für die Zukunft, wie sie etwas bei den um den „Ruf und „Ende und Anfang versammelten Autoren gemacht wurden, gibt es bei Borchert nicht (was vielleicht auch mit seinem frühen Tod zusammenhängt). Er beschreibt die Mächtigkeit des Kriegeselends mit der hemmungslosen Erleichterung eines Menschen, der dem Krieg gerade noch einmal entgangen ist und ohne die bei anderen Autoren zentrale Diskussion über die Ursachen, die zum Krieg führten. Am stärksten wirken allerdings weder die pathetischen Ausrufe noch die grotesken Szenen des Heimkehrerdramas, sondern manche der knappen, parabelhaften Kurzgeschichten, in denen das Kriegsgeschehen in verfremdeter Sicht dargeboten wird. Eine Parallele ist zwischen Borchert und den Kurzgeschichten von Heinrich Böll (geb. 1917) zu sehen, von dem besonders einige der in dem Band „Wanderer, kommst du nach Spa. (1950) in ähnlicher Weise wirken. Zum expressionistischen Drama („Ekstatisches Theater – ca. 1910-1920) Das expressionistische Theater setzt sich deutlich von seinem Vorgänger, dem naturalistischen Theater ab. Der innere Ausdruck ist wiederum wichtiger als die äußere Nachahmung von Wirklichkeit, deshalb oft Verfremdung von äußerer Wirklichkeit. Deshalb wird der Raum auch oft abstrakt dargestellt (auch im Film), Bühne ist relativ leer, es gibt kaum Requisiten, es wird mehr mit Licht (Scheinwerfer, Projektionen) als mit Kulissen gearbeitet. Der Bühnenraum ist eher Ideenraum als Handlungsraum, d. h. die Figuren sind Medien zur Äußerung von Ideen, nicht so sehr Charaktere. Personen werden der „Welt gegenüber gestellt, welche als Bedrohung und Gefährdung des Einzelnen empfunden wird. Sie sind Typen und dienen oft als Sprachrohr des Dichters, dem es um den Ausdruck von Ideen geht. Häufig haben die Figuren keine Namen („Der Mann, „Die Frau, „Der junge Mensch) oder reduzieren sich auf oberflächliche Merkmale (Gelbfiguren, Blaufiguren). Die Personen auf der Bühne appellieren an das Publikum, sprechen es auch direkt an (Aufbruch der inneren Geschlossenheit des traditionellen Dramas) Die Handlung, das Geschehen ist oft abrupt und unlogisch, auch unchronologisch, und die Entwicklung einer Figur ist oft nicht psychologisch (Ablehnung der Psychologie). Wichtiger als eine schlüssige, logische Handlung ist die Darstellung von Phantastisch-Visionärem, einer Idee, einem Gefühl. Eine typische Form: das „Stationendrama, in dem z. B. der Lebensweg einer Figur in nur lose zusammenhängenden symbolischen Einzelbildern dargestellt wird. Die Sprache ahmt keine natürliche Sprache nach, sondern ist stilisiert, typisiert, oft auch großer Hang zum Pathos (feierlich-getragen, verkündigend). Dialoge treten zugunsten von Monologen, die zum Teil an Opernarien erinnern, zurück. Nebeneinander von Vers und Prosa üblich. Humor und Komik ist kaum vertreten (höchstens unfreiwillige Komik aus heutiger Sicht oder auf sehr groteske Art), dazu nehmen sich die DichterInnen (und auch oft ihre Figuren) dieser Generation zu ernst, haben wenig Distanz zu der Welt, die sie umgibt, auch wenn sie diese ablehnen, sind emotional zu verstrickt, um die nötige Distanz für Humor und Komik zu entwickeln. Deshalb herrscht Ernst, Pathos, Feierlichkeit als Rededuktus (Art zu sprechen) vor. Auch in Wolfgang Borcherts Stück „Draußen vor der Tür (1947) sind die Einflüsse des expressionistischen Dramas noch spürbar. Welche?