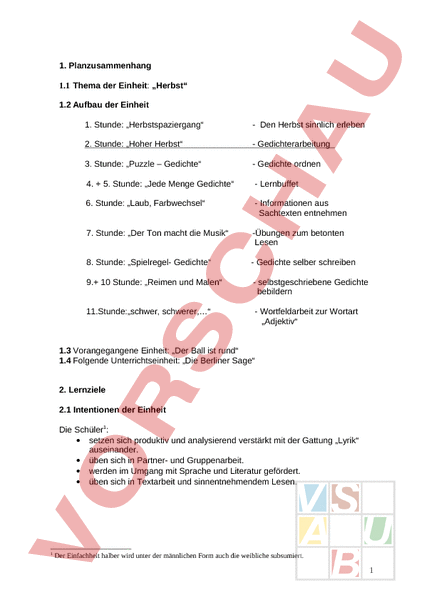Arbeitsblatt: herbstgedicht
Material-Details
herbstgedicht
Deutsch
Texte schreiben
5. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
45629
1340
6
13.09.2009
Autor/in
Nadine Hofmann
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
1. Planzusammenhang 1.1 Thema der Einheit: „Herbst 1.2 Aufbau der Einheit 1. Stunde: „Herbstspaziergang Den Herbst sinnlich erleben 2. Stunde: „Hoher Herbst Gedichterarbeitung 3. Stunde: „Puzzle – Gedichte Gedichte ordnen 4. 5. Stunde: „Jede Menge Gedichte Lernbuffet 6. Stunde: „Laub, Farbwechsel Informationen aus Sachtexten entnehmen 7. Stunde: „Der Ton macht die Musik -Übungen zum betonten Lesen 8. Stunde: „Spielregel- Gedichte Gedichte selber schreiben 9. 10 Stunde: „Reimen und Malen selbstgeschriebene Gedichte bebildern 11.Stunde:„schwer, schwerer, Wortfeldarbeit zur Wortart „Adjektiv 1.3 Vorangegangene Einheit: „Der Ball ist rund 1.4 Folgende Unterrichtseinheit: „Die Berliner Sage 2. Lernziele 2.1 Intentionen der Einheit Die Schüler1: • setzen sich produktiv und analysierend verstärkt mit der Gattung „Lyrik auseinander. • üben sich in Partner- und Gruppenarbeit. • werden im Umgang mit Sprache und Literatur gefördert. • üben sich in Textarbeit und sinnentnehmendem Lesen. 1 Der Einfachheit halber wird unter der männlichen Form auch die weibliche subsumiert. 1 2.2 Stundenziel: Die Schüler erarbeiten den Inhalt des Gedichts „Hoher Herbst, indem sie für die Strophen Überschriften finden und ihr Entscheidungen begründen können. 3.Sachdarstellung a) Zum Autor Karl Krolow wurde am 11.03.1915 in Hannover geboren und starb am 21.6.1999 in Darmstadt. Er lebte als freier Schriftsteller in Darmstadt und gehört zu „den bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Schriftstellern2. Karl Krolow tritt vor allem als Lyriker hervor. Seine frühen Gedichte zeichnen sich durch surrealistische Elemente aus. In den Naturgedichten vertritt er die Traditionslinie von der Klassik bis zum Expressionismus. Sein literarisches Schaffen mündete stets in dem Bemühen um Objektivität. Doch gerade im Umgang mit Landschaften und Jahreszeiten tritt oft ein sehr sensibles Subjekt in den Vordergrund, dass ein zentrales Motiv seiner Gedichte ist. b) Zu der Interpretation einzelner Strophen Das Gedicht besteht aus vier Strophen mit jeweils vier Zeilen. In jeder Strophe reimen sich die zweite und die vierte Zeile, wobei die Reime jedoch nicht rein sind und so nicht von einem (reinen) umarmendem Reimschema gesprochen werden kann. Das Gedicht beginnt mit einem verkürzten Satz, in dem ähnlich wie bei dem Ruf „Baum fällt! bei der Waldrodung, die Fallbewegung verdeutlicht wird. In der zweiten Zeile findet man einen ersten Verweis auf die Verbindung von Herbst und Ernte. Der Walnussbaum wird geschlagen, so dass die Nüsse zu Boden fallen. Das Obst nass, vom morgendlichen Tau oder vom Regen, wird in Körben heimgetragen. Weder die Menschen, die hier ernten noch das Obst wird hier näher beschrieben. Die zweite Strophe beginnt wieder mit einem Bild, dass diesmal das Wetter näher beschreibt. Der Westwind und der Regen treiben das Laub zusammen. In den nächsten Zeilen wird der Wind näher umrissen, denn nur stärker und stürmischer Wind kann Äste brechen. Die dritte Strophe ist ein Ausblich auf das kommende Wetter. Grau wird als tote und traurige Farbe verstanden. Im Herbst sind die Wolken und der Nebel grau und bestimmen die Farbe des nahenden Winters. Doch das Wort „Kühle verdeutlicht, dass noch kein Winter ist, denn sonst hieße es „Kälte. Die Vögel jedoch sind auch der Kühle ausgeliefert. In der vierten Strophe wird das Vogelmotiv erneut aufgegriffen. Ein Rabe, als großer schwarzer Vogel als Sinnbild des Todes, schreit im leeren Wald. Der leere Wald bezieht sich sowohl auf die Menschenleere, als auch auf die Tatsache, dass die Blätter von den Bäumen gefallen sind. Die Menschen sind nun nicht länger im Wald, sondern sitzen am Kartoffelfeuer und wärmen sich, wobei der rauch beißend aufsteigt. c) Zur Aussage des Gedichts 2 Brockhaus, S. 258 2 Gäbe man jeder Strophe eine Überschrift, so würden diese lauten: Ernte II,III Veränderung der Natur durch das Wetter IV menschliche Reaktionen auf die veränderte Jahreszeit Krolow zeigt zwei Seiten des Herbstes. Die Ernte als Ergebnis der Saat, also als positives Produkt menschlicher Arbeit. Die Strophen drei und vier beschreiben eher ein düsteres Bild vom Herbst. Die Natur verändert sich zum Schlechten. Parallelen zum menschlichen Denken und Fühlen werden sichtbar. So sind Trauer, Einsamkeit und das Gefühl des Verlorenseins eher mit dem Herbst als beispielsweise mit dem Sommer verbunden. Die vierte Strophe benennt aber wieder auch positive Dinge. Die Menschen sitzen warm am Feuer und müssen nicht wie der Vogel die Kühle hinnehmen. Dies ist möglicherweise auch ein Ausblick auf einen neuen Frühling und so die Möglichkeit zur Besinnung. Die Überschrift „Hoher Herbst lässt ebenfalls darauf schließen, dass Krolow dem Herbst eher eine positive Konnotation gibt. Denn das Wort „hoch ist im Gegensatz zu dem Wort „niedrig oder „tief eher positiv besetzt. 3. Didaktische Überlegungen 3.1 Lernvoraussetzungen Ich unterrichte die Klasse seit dem neuen Schuljahr vier Stunden wöchentlich im Fach Deutsch, wobei zwei Stunden davon eine Doppelsteckung ist. Hier wird je nach Einheit in geteilt, so dass die DAZ- Schüler weitere Förderung bekommen oder es findet eine innere Differenzierung innerhalb der Klasse statt. Ist dies der Fall wird im Team unterrichtet. Zusätzlich unterrichte ich die Klasse noch eine Stunde in der Woche im Fach Bildende Kunst. Die Klasse besteht aus 14 Schülern, sieben Mädchen und sieben Jungen. Die Klasse lässt sich als aufgeschlossen und freundlich beschreiben. Das Arbeitsverhalten der Gruppe lässt sich als angemessen beschreiben. Die meisten Schüler sind recht motiviert und interessiert am Deutschunterricht. .und haben beide ADS, was jedoch grundsätzlich keine Probleme hervorruft. Im Arbeitsverhalten problematisch lässt sich .beschreiben. Er bemüht sich meistens, ist aber schnell abgelenkt und wird schnell aggressiv. Das Sozialverhalten der Klasse ist recht gut. Die Gruppe steht Neuem und Ungewohnten grundsätzlich offen gegenüber. Die Schüler pflegen einen härteren, aber auch herzlichen Umgangston miteinander. Durch die angehende Pubertät sind Differenzen zwischen Jungen und Mädchen vorprogrammiert. Noch nehmen diese aber keinen allzu großen Rahmen ein. Die Gruppe hat einen recht guten Gruppenzusammenhalt, der gerade Schülern wie Sarah, Jessica und David zu Gute kommt. 3 Das Leistungsniveau der Schüler bietet ein großes Spektrum. Viele Schüler erbringen durchaus gute Leistungen. ist ein sehr leistungsstarker Schüler und gehört mit und auch in die Gruppe der Leistungsstärkeren. Schwächere Schüler wie haben vor allem Probleme beim Schreiben. Sie können dem Unterricht meistens recht gut folgen, scheitern aber am schriftlichen Fixieren eigener Gedanken oder Aufgaben. 3.2 Zur Begründung des Unterrichtsgegenstandes Die geplante Stunde steht am Anfang der Unterrichtseinheit „Herbst. Die Schüler erfahren ein Beispiel für die Herangehensweise an lyrische Bilder in der Lyrik. Diese Unterrichtsreihe beschäftigt sich zum ersten Mal in der Hauptschule mit Gedichten. Deshalb wurde die Behandlung von Gedichten eingebettet in eine Einheit, in der vor allem produktiv und handelnd mit Gedichten umgegangen wird. Die thematische Anlehnung an die Jahreszeit „Herbst ergibt sich aus der Tatsache, dass diese Jahreszeit gerade vorherrscht als auch aus der Tatsache, dass ich im Kunstunterricht ebenfalls das Thema „Herbst mit den Schülern bearbeite. Die Schüler lernen in dieser Einheit viele Gedichte zum „Herbst kennen. Ich habe dieses Gedicht für den Einstieg in die eigentliche Unterrichtseinheit gewählt, weil die verwendeten Wörter einfach sind, es nicht zu lang ist und der Inhalt nicht allzu schwer zu erschließen ist. Ich erwarte, dass auch die Schüler nicht-deutscher Herkunftssprache zumindest den Großteil aller Wörter verstehen. So sollen die Schüler nicht gleich zu Beginn der Einheit Lyrik als eine anstrengende und schwer zu verstehende Gattung erleben, sondern Freude am Sprachspiel und an den lyrischen Bildern entwickeln. Um dies möglich zu machen ist ein Gedicht nötig, dessen Wörter leicht verständlich sind. 3.3 Rahmenplanbezug Der Rahmenplan für die Berliner Schuler sieht für die Sekundarstufe vor, in der siebten Klasse Gedichte unterschiedlicher Art kennen zu lernen und diese zu erschließen. Der Schwerpunkt liegt bei den Erzählgedichten und bei den Balladen. Sprachliche Mittel und Formelemente sollen neben anderen Inhalten wie Lesevortrag und die Berücksichtigung des historischen Hintergrundes Lerninhalte sein. Das Einbetten der Gedichte in themenorientierten Unterricht ist durch die Anlehnung an den „Herbst ebenfalls erfolgt. 4. Methodisch- didaktische Grundkonzeption Die Thematik um das Thema „Gedichte bietet vielfältige Möglichkeiten der Erschließung und der Bearbeitung. Hinsichtlich des neuen Unterrichtsgegenstandes muss eine Reduktion erfolgen. Im Zentrum der geplanten Stunde stehen die eigene Auseinandersetzung und die inhaltliche Erschließung des Gedichts anhand von Oberbegriffen. Dies soll den Schülern im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit 4 weiteren Gedichten eine Möglichkeit aufzeigen, Gedichte inhaltlich zu fassen. Die Verwendung der lyrischen Bilder soll nicht im Zentrum der Stunde stehen, wird aber durch die abschließende Zuordnung von Bildern zu den einzelnen Strophen des Gedichts einen Ausblick auf die folgenden Stunden geben. 1. Phase: Einstieg Der Einstieg der Stunde erfolgt über ein Worträtsel, bei dem die Schüler die fehlenden Buchstaben ersetzen müssen. Aus den fehlenden Buchstaben ergibt sich dann das Wort „Herbstgedicht, womit das Thema der Stunde bekannt gegeben wird. Diese Art von Stundeneinstieg ist den Schülern bekannt und führt bei den meisten Schülern zu einer gesteigerten Motivation. Durch die Tatsache, dass die Schüler diese Form des Einstieges von mir kennen, wird das Rätsel als stummer Impuls einfach auf dem OH-Projektor präsentiert. Nachdem die Schüler das Rätsel entschlüsselt haben, gibt die Lehrerin den Arbeitsplan für heute bekannt. Der Plan steht an der Tafel und ist nach einzelnen Phasen so gegliedert, dass die Schüler zu jedem Zeitpunkt der Stunde wissen was bearbeitet wird du was als nächstes folgt. Diese Form der Offenlegung des Unterrichtsgeschehens kennen die Schüler ebenfalls aus meinem Unterricht und die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Methode gerade schwächeren Schülern hilft dem Unterricht zu folgen. Phasenziel Die Schüler können ein Worträtsel durch hinzufügen der fehlenden Buchstaben lösen. 2. Phase: Hinführung Die Schüler erhalten nun ein auseinander geschnittenes Herbstgedicht, dass sie in Partnerarbeit zusammen setzen sollen. Wichtig dabei ist nicht, dem Original möglichst nahe zu kommen, sondern die eigene Version begründen zu können. Die Schüler müssen auf diese Art und Weise das Gedicht lesen und den Inhalt schon einmal grob erfassen. Nachdem die Schüler zu eigenen Lösungen gekommen sind, werden zwei Schülerversionen vorgelesen. Ebenso werden die Schüler aufgefordert ihre Entscheidungen zu begründen. Den Schülern wird nun das Original ausgeteilt und vorgelesen. Nachdem dies passiert ist, wird der Inhalt des Gedichts in groben Zügen geklärt und eventuell unverstandene Wörter besprochen. Phasenziel Die Schüler können die Gedichtteile zusammensetzen und ihre Entscheidung begründen. 3.Phase: Erarbeitung 2 Sicherung Die Schüler sollen nun Oberbegriffe für die einzelnen Strophen des Gedichts erarbeiten. Dies soll zur inhaltlichen Klärung führen und den Schülern einen Ausblick 5 auf lyrische Bilder vermitteln, die in den weiteren Stunden eine Rolle spielen. Um den Schülern eine Hilfestellung zu geben, gibt es eine Auswahl von Oberbegriffen für jede Strophe. Die Schüler sollen nun Gruppenweise in Partnerarbeit klären, welchen Oberbegriff sie für anmessen halten und warum. Die Schüler benennen in der Begründung für ihre Auswahl die Wörter an denen sie ihre Entscheidung festmachen. Aus dem Oberbegriff und den genannten Wörtern entsteht Schritt für Schritt ein Tafelbild. Die Schüler setzen sich in dieser Phase intensiv mit dem Gedicht auseinander und erarbeiten sich den Inhalt als auch die Verwendung von lyrischen Bildern durch die Impulsgebung von der Lehrerseite. Das entstandene Tafelbild wird von den Schülern abgeschrieben. Phasenziel Die Schüler können aus einer Auswahl von Oberbegriffen für jede Strophe eine heraussuchen und ihre Entscheidung anhand der wichtigsten Wörter in jeder Strophe (Nomen) benennen. Die Schüler schreiben das Tafelbild ab. Die folgende Phase findet dann statt, wenn alle Schüler das Tafelbild übernommen haben und noch Zeit verbleibt. 4. Phase: Übertragung Die Schüler sollen in dieser Phase jeder Strophe ein von mir mitgebrachtes Bild zuordnen und ihre Entscheidung begründen. In dieser Phase wird deutlich, dass Gedichte oft Bilder vermitteln und diese vom Leser auch erkannt werden. Sollte die Zeit diese Phase nicht mehr zulassen, ist dies der Einstieg in die nächst Stunde. Phasenziel Die Schüler können den einzelnen Strophen Bilder zuordnen und ihre Entscheidung belegen. 6 Zeit/ Phase Geplantes Lehrerverhalten Erwartetes Schülerverhalten Aktions- Sozialform Medien, Material Didaktischer Kommentar 8.45 -8.50 Uhr Einstieg L. gibt stummern Impuls per OH-Folie Die Schüler lösen das Worträtsel. Frontaler Einstieg mit Schülerbeteiligung OH-Folie Die Schüler werden durch das Rätsel motiviert und entschlüsseln das Stundenthema. 8.50-9.00 L. verteilt die Die Schüler setzen das PA Uhr Gedichtteile und bittet Gedicht zusammen und Hinführung die Schüler in begründen ihre Meinung. Partnerarbeit das Gedicht wieder zusammen zu setzen. Gedichtteile, Die Schüler setzen sich so intensiv inhaltlich mit dem Gedicht auseinander. 9.00- 9.20 Uhr Erarbeitun Gedicht von Karl Krolow, Oberbegriffe, Tafel Die Schüler lernen so eine Technik kennen, mit der man sich den Inhalt eines Gedichtes erschleißen kann. L. verteilt das Original Gedicht und liest es vor. Anschließend sollen die Schüler für jede Strophe Oberbegriffe finden. Eine Auswahl steht ihnen zur Verfügung. Die Ergebnisse werden an der Tafel festgehalten. Die Schüler lesen das PA Original mit und ordnen anschließend jeder Strophe einen Oberbegriff zu. Sie begründen ihre Meinung. 7 L. fordert die Schüler 9.20. – auf das Tafelbild zu 9.30 Uhr übernehmen und anschließend jeder Sicherung Strophe ein passendes Bild zuzuordnen. Die Schüler schreiben das Tafelbild ab und ordnen anschließend jeder Strophe ein Bild zu und begründen ihre Meinung. EA g.UG Tafelbild, Papier, Stift, Bilder Die Abschrift dient der Sicherung der Ergebnisse. Die Bilder dienen der Übertragung auf eine visuelle Ebene. 8 Literatur • Brenner, Gerd. 2003. Fundgrube für den Deutschunterricht. Cornelsen: Berlin • Fröchling, Jürgen. 1997. Herbst- Eine Gedicht – Anthologie für die Sekundarstufe und II. In: Praxis Deutsch: Friedrich Verlag. Seelze. • Grell, Jochen und Monika. 1999. Unterrichtsrezepte. Beltz: Weinheim • Grimm, Sonja. 2004. Praxishandbuch Deutsch. Cornelsen: Berlin • Senator für Schulwesen Berlin (Hrsg.) (1991): Rahmenpläne für Unterricht und Erziehung in der Berliner Schule (Hauptschule). Deutsch. Berlin • Schuster, K. 1999. Einführung in die Fachdidaktik Deutsch. Hohengehren. 9 Geplantes Tafelbild Ernte Kastanie Walnuss Obst Körbe II,III Das Wetter verändert die Natur Wind, Regen schweres Wetter Nebel Kühle IV Verhalten der Menschen Menschen sind nicht mehr im Wald. Sie wärmen sich am Feuer. 10