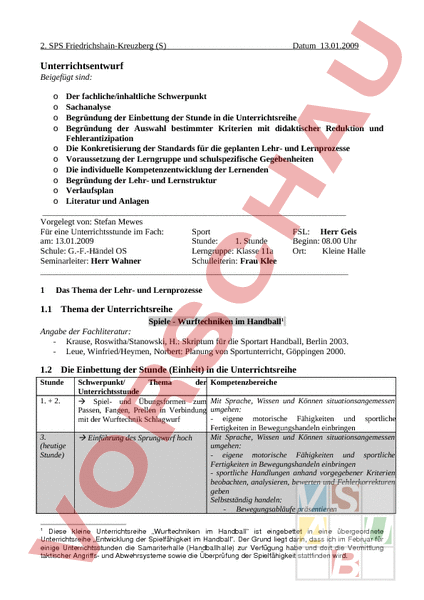Arbeitsblatt: Sprungwurf hoch
Material-Details
Einführung Sprungwurf hoch in einer 11. Klasse
Bewegung / Sport
Anderes Thema
11. Schuljahr
16 Seiten
Statistik
45687
1200
9
14.09.2009
Autor/in
Stefan Mewes
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
2. SPS Friedrichshain-Kreuzberg (S) Datum 13.01.2009 Unterrichtsentwurf Beigefügt sind: Der fachliche/inhaltliche Schwerpunkt Sachanalyse Begründung der Einbettung der Stunde in die Unterrichtsreihe Begründung der Auswahl bestimmter Kriterien mit didaktischer Reduktion und Fehlerantizipation Die Konkretisierung der Standards für die geplanten Lehr- und Lernprozesse Voraussetzung der Lerngruppe und schulspezifische Gegebenheiten Die individuelle Kompetenzentwicklung der Lernenden Begründung der Lehr- und Lernstruktur Verlaufsplan Literatur und Anlagen Vorgelegt von: Stefan Mewes Für eine Unterrichtsstunde im Fach: Sport FSL: Herr Geis am: 13.01.2009 Stunde: 1. Stunde Beginn: 08.00 Uhr Schule: G.-F.-Händel OS Lerngruppe: Klasse 11a Ort: Kleine Halle Seminarleiter: Herr Wahner Schulleiterin: Frau Klee o o 1 Das Thema der Lehr- und Lernprozesse 1.1 Thema der Unterrichtsreihe Spiele Wurftechniken im Handball1 Angabe der Fachliteratur: Krause, Roswitha/Stanowski, H.: Skriptum für die Sportart Handball, Berlin 2003. Leue, Winfried/Heymen, Norbert: Planung von Sportunterricht, Göppingen 2000. 1.2 Die Einbettung der Stunde (Einheit) in die Unterrichtsreihe Stunde 1. 2. 3. (heutige Stunde) 1 Schwerpunkt/ Thema der Unterrichtsstunde Spiel- und Übungsformen zum Passen, Fangen, Prellen in Verbindung mit der Wurftechnik Schlagwurf Einführung des Sprungwurf hoch Kompetenzbereiche Mit Sprache, Wissen und Können situationsangemessen umgehen: eigene motorische Fähigkeiten und sportliche Fertigkeiten in Bewegungshandeln einbringen Mit Sprache, Wissen und Können situationsangemessen umgehen: eigene motorische Fähigkeiten und sportliche Fertigkeiten in Bewegungshandeln einbringen sportliche Handlungen anhand vorgegebener Kriterien beobachten, analysieren, bewerten und Fehlerkorrekturen geben Selbstständig handeln: Bewegungsabläufe präsentieren Diese kleine Unterrichtsreihe „Wurftechniken im Handball ist eingebettet in eine übergeordnete Unterrichtsreihe „Entwicklung der Spielfähigkeit im Handball. Der Grund liegt darin, dass ich im Februar für einige Unterrichtsstunden die Samariterhalle (Handballhalle) zur Verfügung habe und dort die Vermittlung taktischer Angriffs- und Abwehrsysteme sowie die Überprüfung der Spielfähigkeit stattfinden wird. Stunde Schwerpunkt/ Unterrichtsstunde Thema der Kompetenzbereiche 4. Festigung des Sprungwurf hoch und Mit Sprache, Wissen und Können situationsangemessen dessen Anwendung in Übungsformen umgehen: (nach Zuspiel, aus dem Prellen heraus) eigene motorische Fähigkeiten und sportliche Fertigkeiten in Bewegungshandeln einbringen sportliche Handlungen anhand vorgegebener Kriterien beobachten, analysieren, bewerten und Fehlerkorrekturen geben Selbstständig handeln: Bewegungsabläufe präsentieren 5. 6. Festigung des Sprungwurf hoch Einführung des Sprungwurf weit Festigung beider Sprungwurfvarianten und dessen Anwendung in Übungsformen (nach Zuspiel und aus dem Prellen heraus) Mit Sprache, Wissen und Können situationsangemessen umgehen: eigene motorische Fähigkeiten und sportliche Fertigkeiten in Bewegungshandeln einbringen sportliche Handlungen anhand vorgegebener Kriterien beobachten, analysieren, bewerten und Fehlerkorrekturen geben Selbstständig handeln: Bewegungsabläufe präsentieren 7. 8. Überprüfung gewählter Techniken Mit Sprache, Wissen und Können situationsangemessen umgehen: eigene motorische Fähigkeiten und sportliche Fertigkeiten in Bewegungshandeln einbringen sportliche Handlungen anhand vorgegebener Kriterien beobachten, analysieren, bewerten und Fehlerkorrekturen geben Selbstständig handeln: Bewegungsabläufe präsentieren 2 2 Der fachlich/inhaltliche Schwerpunkt 2.1 Sachanalyse Das Ziel im Handballspiel besteht darin, möglichst viele Tore zu erzielen. Aus diesem Hintergrund hat sich im modernen Handballspiel der Sprungwurf in all seinen Ausführungsvariationen zu einem der wichtigsten Würfe entwickelt und ist somit der am meisten angewendete Wurf. Zudem gehört er zu den spektakulärsten aber auch schwierigsten Würfen im Handballsport. Im Vergleich zum Schlagwurf bietet der Sprungwurf mehrere Vorteile: Er ist in fast allen Situationen des Angriffspiels als Torwurf anwendbar. Durch den Absprung in die Höhe vor der Abwehr und dem Überwerfen des Abwehrspielers vermindert sich die Chance der Abwehrspieler, Mann und Ball durch Blocken abzuwehren. Im Tempogegenstoß oder nach gelungenen 1:1-Aktionen wird durch den Absprung in die Weite die Distanz zwischen Tor und Werfer verringert, was eine Reduzierung der Reaktionszeit des Torhüters und somit bessere Erfolgsausichten für den Werfer bedeutet. Die Sprung- und Wurfverzögerung ermöglichen eine bessere Beobachtung des Torhüters und seines Abwehrverhaltens. Mit einer Torwurftäuschung werden eine Reihe von Abspielmöglichkeiten eröffnet, die als Vorteil gegenüber den Abwehrspielern genutzt werden können. Für die Außenspieler ist ein guter Absprung vor allem wichtig um Raum und damit einen besseren Wurfwinkel zu gewinnen. Aus den eben beschriebenen Vorteilen des Sprungwurfes geht hervor, dass es verschiedene Sprungwurfvariationen gibt. Man unterscheidet Sprungwürfe aus dem Rückraum (Fernwurfzone), von den Außenpositionen und als Abschluss nach einem Tempogegenstoß. Dabei zeigen sich Unterschiede durch die Sprungausführung in die Höhe (aus dem Rückraum), in die Weite (nach einem Tempogegenstoß) oder in die Weite mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Fallbewegung (von den Außenpositionen). Alle Sprungwurfvariationen sind azyklische Bewegungen, die sich in drei Phasen2 unterteilen lassen: die Anlaufphase (entspricht der Vorbereitungsphase), die Wurfphase (entspricht der Hauptphase) und die Landephase (entspricht der Endphase). 2 In der von mir durchgesehenen Handballliteratur wird selten eine Phasenunterteilung vorgenommen. Eine gängige Phasenunterteilung ist Folgende: Vorbereitungsphase, Hauptphase und Endphase. Um eine größere Transparenz für die Schüler zu schaffen, habe ich die Phasen in Anlaufphase, Wurfphase und Landephase umbenannt. 3 Für diese Unterrichtsstunde ist die Phasenstruktur des Sprungwurf hoch von Bedeutung. Anlaufphase: Zu Beginn der Anlaufphase nimmt der Spieler die Ausgangsstellung mit Ball ein. Der Ball wird mit beiden Händen vor der Brust gehalten. Der Anlauf erfolgt in einem Winkel von 45 zum Tor im Drei-Schritt-Rhythmus links-rechts-links (Rechtshänder). Der Oberkörper ist leicht nach vorn geneigt. Angelaufen wird mit „normalen Laufschritten, wobei der letzte Schritt verlängert ist (Amortisation Absenken des KSP). Die Ausholbewegung beginnt mit dem Rückführen des Balles zur Wurfarmschulter, die „Nichtwurfhand löst sich vom Ball. Der Ellbogen bleibt in der Ausholphase in Höhe der Wurfarmschulter. Es erfolgt ein kräftiger Absprung mit links (Rechtshänder). Mit dem Absprung wird in die Wurfphase übergeleitet. Wurfphase: Der Absprung vom linken Bein (Rechtshänder) wird unterstützt durch aktives Hochführen des gebeugten rechten Schwungbeins, d.h. das Schwungbein wird gleichzeitig mit dem Absprung vorhochgezogen, um die Schwungbewegung zu begünstigen. Gleichzeitig mit dem Absprung in die Höhe wird die Wurfarmschulter weiter nach hinten-oben geführt und die Gegenschulter kommt nach vorn. Die Hüfte (Beckenachse) bleibt vorn, sodass die Schulterachse und die Beckenachse mindestes einen Winkel von ca. 45 bilden. Im höchsten Punkt der Steigung wird der ganze Körper gestreckt. Der Abwurf erfolgt im höchsten Punkt des Sprunges. Die Beugung des Schwungbeins wird aufgegeben. Dabei kommt es zur Auflösung der Oberkörperverwringung. Es erfolgt ein schlagartiger Armzug (Wurfarm ist i.d.R. nicht vollständig gestreckt) am Kopf vorbei nach vorn. Die Bewegung verläuft über die Kette Hüfte-Schulter-Arm-Nachklappen des Handgelenks. Die Hand bleibt hinter dem Ball. Landephase: Die Endphase beginnt mit dem Verlassen des Balles der Hand. Es erfolgt eine Bremsbewegung des Wurfarmes und die beidbeinige Landung. (vgl. Krause/ Stanowski 2003, S. 84/85; Trosse 2001, S. 132/133) 4 5 2.2 Begründung der Einbettung der Stunde in die Unterrichtsreihe Diese Doppelstunde ist die zweite der Unterrichtsreihe „Wurftechniken im Handball. Diese kleine Unterrichtsreihe „Wurftechniken im Handball ist eingebettet in eine übergeordnete Unterrichtsreihe „Entwicklung der Spielfähigkeit im Handball. Der Grund liegt darin, dass ich im Februar für einige Unterrichtsstunden die Samariterhalle (Handballhalle) zur Verfügung habe und dort die Vermittlung von ausgewählten Elementen individual-, gruppen- und mannschaftstaktischen Maßnahmen im Handballspiel sowie die Überprüfung der Spielfähigkeit stattfinden wird. Damit ist nicht gemeint, dass ich das Erlernen des Sportspiels Handball nur über die Vermittlung technischer Grundformen durchführe. In der kleineren Händel-Halle führe ich das Handballspiel natürlich auch in spielerischer Form (spielerische Übungsformen) ein, aber aufgrund des Platzangebotes können überwiegend nur individualtaktische Angriffshandlungen, wie z.B. Finten vermittelt werden. Das Zielspiel ist nur in der Formation 4:4 und evtl. 5:5 möglich. Die Außenpositionen können beispielsweise nicht besetzt werden. Das Zielspiel 7:7 ist leider nicht möglich. Die Anwendung der vermittelten Wurftechniken erfolgt in der Händel-Halle in vereinfachter spielerischer Form. Ein Zusammenspiel im Handball gelingt nur dann, wenn die wesentlichen Grundtechniken Prellen, Passen (in erster Linie der Schlagwurfpass) und Fangen in der Grobform (Schulsport) ausgeführt werden können. Die elementaren Bewegungsstrukturen dieser Techniken ermöglichen einerseits eine gute Ballannahme (Fangen) und Ballabgabe (Passen) und fördern dadurch in gutes Zusammenspiel. Die Schüler3 sollen eine gewisse Sicherheit in diesen Grundtechniken erfahren und die Bälle möglichst platziert in Brusthöhe am Ort und in der Bewegung zuspielen und fangen können. Diese Grundlagen wurden in der ersten Doppelstunde wiederholt und geübt bzw. gefestigt. 3 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur der Begriff „Schüler gewählt. Dieser schließt jedoch immer die weibliche Form mit ein. 6 Der Sprungwurf (hoch) gehört zu den am häufigsten angewendeten Würfen im Handball. Ich habe mich dafür entschieden zuerst den Sprungwurf hoch einzuführen. Er ist zwar schwieriger zu erlernen, doch den Schülern fällt der Transfer vom Sprungwurf hoch zum Sprungwurf weit nach meinen Erfahrungen leichter als bei der umgekehrten Lehrfolge. Ein wesentlicher Grund liegt darin, dass bei der Ausführung des Sprungwurf hoch zunächst ein kräftiger Absprung in die Höhe erfolgt und die Schüler mehr Zeit haben (im Lernprozess durch methodische Hilfsmaßnahmen unterstützt), sich auf die Rückführung des Wurfarmes und der Wurfarmschulter zu konzentrieren. Weiterhin sollen die Schüler durch das Erlernen des Sprungwurf hoch „[.] ihre Spielfähigkeit weiterentwickeln. (RLP, S. 18) 2.3 Begründung der Auswahl bestimmter Kriterien 2.3.1 Didaktische Reduktion Wurftechniken im Handball sollen den Schülern helfen, bestimmte Situationen und Bewegungsaufgaben möglichst zweckmäßig und ökonomisch zu lösen. Weiterhin bietet das Erlernen dieser Technik den Schülern eine weitere Möglichkeit, dem Ziel des Handballspiels, möglichst viele Tore zu erzielen, näher zu kommen. Der Sprungwurf hoch ist anfangs eine sehr schwierig zu erlernende Wurftechnik. Um die Schüler in dieser Unterrichtsstunde nicht zu überfordern, führe ich den Sprungwurf hoch durch den Einsatz verschiedener Hilfsmaßnahmen ein. Im Vordergrund steht (neben des Erlernens des Drei-Schritt-Rhythmus) dabei die Erhöhung der Absprungstelle durch ein Kastenoberteil, welches den Schülern helfen soll, sich bewusst auf die Bewegungsausführung durch den Zeitgewinn zu konzentrieren. So können sie sich eine optimale Wurfauslage verschaffen und auch die Tendenz, die Rückführung der Wurfarmschulter und des Wurfarmes zu verkürzen, entfällt. Weiterhin müssen die Ausführungskriterien der Wurftechnik Sprungwurf hoch didaktisch reduziert werden. Die in der Sachanalyse beschriebenen Bewegungsmerkmale werden schülergerecht auf die wesentlichen Bewegungsmerkmale je Phase reduziert. a) Vorbereitungsphase: Drei-Schritt-Anlauf (links-rechts-links für Rechtshänder) Rückführen des Wurfarmes und der Wurfarmschulter nach hinten-oben (Oberkörperverwringung) Ellbogen in Höhe der Wurfarmschulter 7 kräftiger Absprung mit dem linken Bein (Rechtshänder) und Schwungbein-Einsatz b) Hauptphase: Auflösen der Oberkörperverwringung schlagartiger Armzug am Kopf vorbei nach vorn (Schulter-Ellbogen-Hand) Abwurf im höchsten Punkt des Sprunges c) Endphase: Ball verlässt die Hand Bremsbewegung des Wurfarmes Landung erfolgt beidbeinig Die Hauptlernaktion dieser Stunde liegt in der Erarbeitung des Sprungwurf hoch. Folgende Lernschrittfolge erscheint zweckmäßig: 1 Ein Spiel zu Beginn der Stunde soll die Schüler spezifisch erwärmen und motivieren. 2 Die kognitive Phase dient der Erarbeitung der wesentlichen Bewegungsmerkmale der Wurftechnik Sprungwurf hoch hinsichtlich der drei Phasen – Anlaufphase, Wurfphase und Landephase. Weiterhin wird durch ein gelenktes Unterrichtsgespräch die Anwendung dieses Wurfes thematisiert. 3 In der Erarbeitung wird der Sprungwurf hoch schrittweise erlernt. Verschiedene Hilfen sollen allen Schülern einen möglichst großen Lernerfolg ermöglichen. 4 Eine Zwischensicherung dient der Wiederholung der Bewegungskriterien und ermöglicht eine Selbsteinschätzung der Schüler, um dann gezielt weiter zu arbeiten. 5 In der Erarbeitung II wird entsprechend der in der ZS erfahrenen Schwächen geübt oder weiter gearbeitet. 6 Abschließend erfolgt eine Reflexion über das Erarbeitete, insbesondere der methodischen Vorgehensweise. Aus der Lernschrittfolge ergeben sich folgende Phasenziele: Die Schüler 1. erwärmen sich spezifisch. Indikator: Die Schüler sind spezifisch erwärmt. 8 2. erarbeiten gemeinsam die wesentlichen Bewegungsmerkmale des Sprungwurf hoch hinsichtlich der Anlaufphase, Wurfphase und Landephase sowie deren Anwendung im Spiel. Indikator: Die Schüler nennen die wesentlichen Bewegungsmerkmale des Sprungwurf hoch. 3. . begreifen anhand des Überlaufen von Bänken den Drei-Schritt-Rhythmus und üben diesen. Indikator: 4. Die Schüler überlaufen Bänke im Drei-Schritt-Rhythmus. . führen verschiedene methodische Schritte zum Erlernen der richtigen Technik beim Sprungwurf hoch aus. Indikator: Die Schüler erreichen durch einen kräftigen Absprung in die Höhe die Voraussetzung, um genügend Zeit zu haben, die Wurfarmschulter und den Wurfarm zurückzuführen. 5. wiederholen die Bewegungsmerkmale des Sprungwurf hoch. Zwei Schüler demonstrieren ihre Technik. Indikator: Die Schüler wiederholen die Bewegungsmerkmale des Sprungwurf hoch. Zwei Schüler demonstrieren ihre Technik. 6. . wählen entsprechend ihres Übungsbedarfs neue, weiterführende oder wiederholende, bekannte Übungen. Indikator: Die Schüler wählen entsprechend ihres Übungsbedarfs neue, weiterführende oder wiederholende, bekannte Übungen. 7. . reflektieren die Stunde, insbesondere die methodische Vorgehensweise. Indikator: Die Schüler begründen die methodische Vorgehensweise der Stunde. 2.3.2 Fehlerantizipation Beobachtung/Fehler Sprungwurf a) Anlaufphase Falsche Schrittfolge (Rechtshänder). Korrektur links-rechts-links Vorbereitende Übungen zum Erlernen des Dreischrittrhythmus mit Hilfe von Bänken, Matten oder Markierungen, d.h. Überlaufen von Hindernissen. Akustische Unterstützung des Anlaufrhythmus bei Betonung des 3. Schrittes. Anlauf ist zu steil zur Absprungstelle. Hinweis durch Lehrkraft und Vorgabe der Anlaufrichtung (45 zur Wurfrichtung)) durch Markierungen. Länge der Anlaufschritte stimmt nicht – zu Hinweis durch Lehrkraft und evtl. große Schritte und dadurch Fehlen der schülergerechte Vorgabe der Anlauflänge durch Dynamik des Sprungwurfes. Markierungen. 9 Falsches Absprungbein. Vorgeben der Schrittfolge links-rechts-links (Rechtshänder) durch Markierungen oder akustische Signale. Kein kräftiger Absprung in die Höhe. Vorbereitende Übungen aus dem Lauf-ABC, wie beispielsweise Hopserlauf. Hinweise durch die Lehrkraft und vorbereitende Sprungübungen. Zuhilfenahme einer Zauberschnur. Absprung- und Landungssektor vorgeben und auf kräftigen Fußeinsatz achten. Rückführung des Wurfarmes und der Hinweise durch die Lehrkraft. Wurfarmschulter (Oberkörperverwringung) zu gering bzw. fehlt. b) Wurfphase Schwungbeineinsatz zu gering bzw. fehlt. Vorbereitende Übungen aus dem Lauf-ABC, wie beispielsweise Hopserlauf mit betontem Einsatz des Schwungbeines. Fehlende Auflösung der Hinweise durch die Lehrkraft. Oberkörperverwringung. Abwurf erfolgt nicht im höchsten Punkt des Hinweise durch die Lehrkraft und Einsatz von Sprunges. Höhenorientierer, beispielsweise einer Zauberschnur. Beobachtung/Fehler Korrektur c) Landephase Landung erfolgt nicht beidbeinig. Hinweise durch die Lehrkraft und vorbereitende Übungen zum Absprung und beidbeiniger Landung. 3 Die Konkretisierung der Standards für die geplanten Lehr- und Lernprozesse 3.1 Der Schwerpunkt der Kompetenzbereiche Der primäre Schwerpunkt wird auf den Kompetenzbereich „Mit Sprache, Wissen und Können situationsangemessen umgehen gelegt. Die Schülerinnen und Schüler sollen Bewegungen und sportliche Handlungen sowohl praktisch handelnd begreifen als auch theoriegeleitet sprachlich darstellen. (RLP, S. 11). Der sekundäre Schwerpunkt wird auf den Kompetenzbereich „Selbstständig handeln gelegt, indem die Schülerinnen und Schüler Informationen von Bewegungsvorbildern [], Bildvorlagen und Bewegungsbeschreibungen in Bewegungshandeln umsetzen sollen. (RLP S. 12). Schwerpunkt wird vor allem auf die pädagogische Perspektive „Leistung gelegt. Insbesondere das Leisten und Leistung beim Sporttreiben erfahren, verstehen und reflektieren (RLP, S. 9). Aber auch die Körpererfahrung wird in dieser Stunde angesprochen, insbesondere das Erweitern der Bewegungserfahrung (RLP, S. 9). 3.2 Die Abschlussstandards am Ende der Qualifikationsphase 10 Die Schülerinnen und Schüler gehen mit Sprache, Wissen und Können situationsangemessen um, indem sie Eigene motorisch Fähigkeiten und sportliche Fertigkeiten in Bewegungshandeln einbringen Fachsprache themenfeldspezifisch anwenden. (RLP, S. 14) 3.3 Die themen- bzw. bewegungsfeldbezogene Standards der Qualifikationsphase Bewegungsfeld der Qualifikationsphase: Sportspiele – Handball Inhalte: technische Fertigkeiten der Ballabgabe (RLP, S. 18): Sprungwurf hoch 3.4 Die Ausgangsstandards der Schülerinnen und Schüler Eingangsvoraussetzungen: Die Schülerinnen und Schüler wenden spielspezifische Fertigkeiten in den gewählten Spielsportarten an. 3.5 Die Abschlussstandards der Unterrichtseinheit Die Schülerinnen und Schüler können die Wurftechniken Schlagwurf mit Stemmschritt, Sprungwurf hoch sowie den Sprungwurf weit in der Grobform unter Beachtung der jeweils erarbeiteten Hauptbewegungsmerkmale ausüben. Sie können dabei die Techniken aus der jeweiligen Ausgangsstellung (Mindestniveau), aus dem Prellen heraus (Regelniveau) und nach Zuspiel (Höchstniveau) regelgerecht anwenden. 3.6 Die Abschlussstandards der Unterrichtsstunde Die Schülerinnen und Schüler können den Sprungwurf hoch motorisch in der Grobform ausführen und die wesentlichen Bewegungsmerkmale der einzelnen Phasen nennen. 4 Voraussetzungen der Lerngruppe und schulspezifische Gegebenheiten 4.1 Instrumentelle und institutionelle Voraussetzungen Der Sportunterricht in der Lerngruppe 11a findet i.d.R. in der kleinen Halle auf dem Schulhof statt. Im Februar steht mir voraussichtlich die Samariterhalle (große Halle) für ca. vier bis sechs Unterrichtsstunden für die Unterrichtseinheit „Entwicklung der Spielfähigkeit im Handball zur Verfügung. Für die Unterrichtsgestaltung stehen mir 2 Handballtore, 25 Handbälle (Größe 1 und 2), 8 Langbänke, 32 Pylonen, 24 Reifen, 25 Springseile, 25 Parteibänder, 10 Slalomstangen, 6 Hocker, 4 Hochsprungständer, 20 Turnmatten, 4 Kastenoberteile und 12 Softbälle zur Verfügung. 11 4.2 Allgemeine Voraussetzungen Die Lerngruppe 11a der Georg-Friedrich-Händel-OS besteht aus 18 Mädchen und 6 Jungen. Die Schüler besuchen das Gymnasium seit der 5. Klasse. Es handelt sich um eine Schule mit musikalischem Schwerpunkt. Seit Beginn des Schuljahres 2008/ 2009 bin ich mit zwei Wochenstunden für die Unterrichtsgestaltung in dieser Lerngruppe verantwortlich. Der Unterricht findet dienstags in der 1. und 2. Unterrichtstunde statt. Die soziale und personale Kompetenz ist in dieser Lerngruppe relativ gut ausgeprägt. Die Schüler gehen freundlich miteinander um. Des Weiteren herrschen ein freundlicher Umgangston, ein guter Gemeinschaftssinn und eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Zwischen den Schülern treten i.d.R. keine Spannungen auf, was sich daran zeigt, dass sie sich in Übungsphasen gegenseitig helfen und überwiegend eine große Einsatzbereitschaft zeigen. Die Jungen sind sehr motiviert (teilweise übermotiviert) und haben einen großen Bewegungsdrang. Dies führt häufig dazu, dass sie bei Erläuterungen des Lehrers (Aufgabenstellung, Bewegungsausführungen, Übungsansagen etc.) zunächst einmal nicht zuhören und dann „fragend schauend nicht wissen, was sie tun sollen. Sie müssen häufiger direkt angesprochen werden, erledigen aber dann an sie gestellte Aufgaben umgehend. Einschränkungen muss man bei Friedrich machen. Er wurde aufgrund seiner schulischen Leistungen zwei Klassen höher gestuft und ist hinsichtlich seiner konstitutionellen und motorischen Voraussetzungen gegenüber den anderen Jungen benachteiligt. Die Mädchen in dieser Klasse kann man hinsichtlich der Motivation und Einstellung zum Sportunterricht in zwei Gruppen einteilen. Julia A., Sara, Friederike, Luca haben beispielsweise kaum Interesse am Sporttreiben. Sie müssen i.d.R. extra motiviert werden, um sich überhaupt zu bewegen. Ihnen muss immer wieder bewusst gemacht werden, dass man sich im Sportunterricht bewegen muss. Dies führt (ähnlich wie bei den Jungen) dazu, dass sie bei Erläuterungen des Lehrers (Aufgabenstellung, Bewegungsausführungen, Übungsansagen etc.) zunächst einmal nicht zuhören und dann auch „fragend schauend nicht wissen, was sie tun sollen. Sara und Friederike haben eine ärztliche Bescheinigung, dass sie bis zum 28.02.2009 bzw. 17.01.2009 nur eingeschränkt Lauf- und Sprungübungen ausführen können. Ich habe mit ihnen vereinbart, dass sie versuchen, soweit es ihnen möglich ist, zunächst alle Übungen mitzumachen. Wenn es ihnen nicht möglich ist, erhalten sie andere Aufgaben von mir, die sie ausführen können. Zu der zweiten Gruppe kann man Ada, Antonia, Isabell und Johanna zählen. Sie sind aufmerksam und immer bestrebt, so gut wie möglich mitzumachen sowie sich zu verbessern. 12 4.3 Spezielle Voraussetzungen Die Sachkompetenz der Schüler bezogen auf Handball ist mittelmäßig, obwohl sie sich (oder gerade deswegen) eine Unterrichtseinheit Handball gewünscht haben. Ein Grund liegt vielleicht auch darin, dass in der G.-F.-Händel OS Handball nur alle 2 Jahre im Unterricht vermittelt (Klasse 5, 7 und 9) wird. Es muss wiederum zwischen Mädchen und Jungen unterschieden werden. Bei den Jungen muss man hinsichtlich der Leistungsfähigkeit eine Dreiteilung vornehmen. Florian (spielt aktiv Handball in der Landesliga in Fredersdorf) kann die Grundtechniken Passen, Fangen und Prellen sowie die Wurftechnik Schlagwurf mit und ohne Stemmschritt meines Erachtens, mit ein paar kleinen Abstrichen, in der Feinform ausführen. Die Ausführung nach dem Prellen, nach Zuspiel etc. bereitet ihm keine Schwierigkeiten. Friedrich kann die genannten Grundtechniken, nach seinen Möglichkeiten, nur annähernd in der Grobform ausführen. Die Ballannahme am Ort (beidhändiges Fangen) brusthoch zugespielter Bälle bereitet ihm im Gegensatz zu halbhoch bis tief zugespielter Bälle wenig Schwierigkeiten. Größere Schwierigkeiten hat er mit der Ballannahme in der Bewegung. Die Ballabgabe (Schlagwurf im Stand als Zuspiel) gelingt ihm in der Grobform, die Ausführung in der Bewegung und als Zuspiel in die Laufbewegung eines Mitspielers bereitet ihm noch größere Schwierigkeiten. Der Schlagwurf mit Stemmschritt aus dem Stand (Torwurf) kann er ebenfalls annähernd in der Grobform ausführen, nach Zuspiel und vorangehendem Prellen gelingt ihm dies kaum (vgl. Kap. 4.2). Die anderen Jungen können alle genannten Techniken in der Grobform ausführen. Innerhalb der Mädchen ist die Leistungsfähigkeit als homogen „mittelmäßig einzuschätzen, wobei der Unterschied zu den Jungen hinsichtlich der dynamischen Ausführung recht groß ist. Alle Mädchen können die Grundtechniken Passen (Schlagwurf im Stand und in der Bewegung als Zuspiel), Fangen (brusthoch zugespielter Bälle im Stand und in der Bewegung) und Prellen (mit Handwechsel) in der Grobform nach den erlernten bzw. wiederholten Hauptbewegungsmerkmalen ausführen. Den Schlagwurf mit Stemmschritt als Torwurf (aus dem Stand und aus der Bewegung) können sie größtenteils in der Grobform ausführen. Deren Anwendung nach Zuspiel bzw. nach vorangehendem Prellen bereitet einem geringen Teil der Mädchen noch einige Schwierigkeiten. Ihnen muss immer wieder die Schrittfolge und die Bedeutung des Stemmschrittes verdeutlicht werden. Die konditionellen Fähigkeiten (Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit) sind altersund entwicklungsgemäß ausgeprägt, wobei die Mädchen in dieser Hinsicht etwas schwächer einzustufen sind als die Jungen. Im Coopertest erreichten die Schüler, bis auf wenige Ausnahmen, gute bis sehr gute Leistungen. 13 Die kognitiven Fähigkeiten der Schüler bezüglich verbaler und visueller Informationsverarbeitung sind in dieser Klasse gut ausgeprägt, d.h. sie sind in der Lage, ausgewählte Bewegungsmerkmale sportlicher Bewegungsabläufe mittels visueller Informationsquellen (Demonstration durch den Lehrer oder Bildreihen) aufzunehmen, zu verbalisieren und entsprechend ihrer Fähigkeiten umzusetzen. Die Kommunikation in den kognitiven Phasen verlief am Anfang des Schuljahres sehr schleppend. Einigen Schülern, vor allem den Mädchen, war nicht bewusst, dass diese Phase für den Lernprozess unabdingbar ist, um die Ausführung bestimmter Techniken zu erlernen bzw. in der Praxis umzusetzen. Die koordinativen Fähigkeiten sind in dieser Klasse hinsichtlich der Handballausbildung als eher mittelmäßig einzuschätzen. Im Bereich der Methodenkompetenz haben die Schüler in unserem bisherigen gemeinsamen Handballunterricht verschiedene handballtypische Übungsformen hinsichtlich der Grundtechniken Passen, Fangen, Prellen kennen gelernt. 5 Die individuelle Kompetenzentwicklung der Lernenden hoch mittel niedrig motorisch Kognitiv Die Schülerinnen und Schüler können den Sprungwurf hoch aus dem Prellen heraus bzw. nach Zuspiel in der Grobform ausführen. (Florian) Die Schülerinnen und Schüler können den Bewegungsablauf des Sprungwurf hoch beobachten, Fehler erkennen und benennen sowie Korrekturhinweise geben. (Florian) Die Schülerinnen und Schüler kennen und benennen die Hauptbewegungsmerkmale des Sprungwurf hoch. (Isabell) Die Schülerinnen und Schüler kennen den Sprungwurf hoch als Wurftechnik, dessen Anwendung aus dem Rückraum im Spiel zum Torerfolg führen kann. (Alexander) Die Schülerinnen und Schüler können den Sprungwurf hoch in der Grobform ausführen. (Fabian) Die Schülerinnen und Schüler können den Sprungwurf hoch mit Hilfsmitteln (z.B. Absprunghilfe) in der Grobform ausführen. (Antonia) 14 6 Die Begründung der Lehr- und Lernstruktur Die Unterrichtsstunde beginnt um 8.00 Uhr. Während der Erwärmung zu Beginn der Stunde sollen die Schüler spezifisch auf den Stundeninhalt vorbereitet werden. Zur Erwärmung wird die Klasse in 4 Teams eingeteilt und das Spiel „Hütchentorball (eigentlich als Stangentorball bekannt, aber aus Gründen des Fehlens Stangen, zum Hütchentorball modifiziert) auf zwei Spielfeldern gespielt. Die Gruppeneinteilung geschieht mittels Abzählens. Die Spielregeln werden kurz erklärt (Abstand zum Gegner eine Armlänge, 3-Schritte-Regel, kein Prellen, Torerfolg bei Aufsetzerball durch Tor und Fangen des Balls durch einen Mitspieler, nach Torerfolg Ballbesitzwechsel, bei Aus: Einwurf durch die nicht das Aus verursachende Mannschaft). Während des Spiels wird evtl. eine Variationen vorgegeben, die darin besteht, dass Torwürfe nur im Sprung durchgeführt werden dürfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Sprung und die Landung ein- oder beidbeinig ausgeführt werden. Diese Aufgabe ist sicherlich koordinativ nicht einfach, zumal sie in einer Spielsituation eingesetzt werden soll, andererseits ist durch keine weitere Einschränkung, wie der Sprung aussehen soll, den Schülern sehr viel Freiraum bei der Durchführung gegeben. Dennoch wird ein elementares Merkmal des Sprungwurfs – der Wurf während der Flugphase – getrennt von den sonstigen spezifischen Merkmalen auf spielerische Art erfahren. Alternativ zu einem Spiel wäre es möglich, die Schüler durch verschiedene Übungsformen (Passen, Fangen und Werfen) in Staffelform ausführen zu lassen. Da diese Stunde jedoch sehr technikorientiert ist und es am Ende zu keiner Spielphase kommen wird, sollen die Schüler durch eine Spielphase zu Beginn der Stunde motiviert werden. In der kognitiven Phase sollen die Schüler eine Bewegungsvorstellung entwickeln, indem sie die Bewegungsmerkmale des Sprungwurf hoch anhand einer Bildreihe erarbeiten und den Phasen dieser Technik zuordnen können. Eine Bildreihe eignet sich, da dadurch mit wenig Aufwand die komplizierte Technik erläutert werden kann. Die Bildreihe bleibt während der gesamten Stunde hängen. Somit können die Schüler selbstständig nachsehen, wenn sie Probleme mit einer bestimmten Phase haben. Ein Video als Alternative hätte diesen Vorteil nicht. Beide Medien zusammen würden die Stunde überfrachten. In dieser Phase sind auch die vom Sport befreiten Schüler gefordert mitzuarbeiten. Sie sollen die Technik ebenfalls verstehen und mit Hilfe der Bildreihe sowie einem Beobachtungsbogen anhand der wesentlichen Bewegungsmerkmale den übenden Schülern später Bewegungskorrekturen geben. Die Beobachter sollen sich dabei immer nur auf eine Phase konzentrieren und auch nur ein Merkmal korrigieren, um die Spieler nicht zu überfordern. Die Beobachtungsschwerpunkte können je nach Lerntempo beibehalten oder gewechselt werden. 15 Die erste Übung der Erarbeitungsphase I, das Überlaufen von Bänken im Drei-Schritt-Rhythmus (LuA2), dient im ersten Schritt als Übung, um das bewusste Erlernen des Anlaufes zu vereinfachen. Ich habe dazu Bänke gewählt, da sich die Schüler mehr auf den Rhythmus zwischen den Bänken konzentrieren können und müssen. Das Überlaufen erfolgt an je 4 Langbänken, d.h. jeweils 2 Gruppen überlaufen 4 Langbänke. Mir ist bewusst, dass es evtl. zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Abstände bei 24 Schülern (koedukativ) kommen kann, sodass man evtl. innerhalb dieser Phase Korrekturen vornehmen muss. Alternativen bestehen im Überlaufen von Laufbahnen mit Schrittund Absprungmarkierungen, im Überlaufen von Kastenmattenbahnen, der Hinzunahme von Reifen als Schrittorientierung, das Überlaufen von kleinen Kästen mit Sprung auf Kastenoberteilen oder Klebestreifen mit Pylonen als Absprungmarkierung. Der Nachteil bei Laufbahnen besteht meines Erachtens darin, dass die Schüler zwar die Schrittfolge ausführen, sich jedoch nicht bewusst darauf konzentrieren und der Effekt des Erlernens des Drei-Schritt-Rhythmus verpufft. Alle anderen Alternativen bergen meiner Ansicht nach mehr Verletzungsgefahren in sich, ohne einen besseren Lernerfolg zu garantieren. Ich verzichte auch bewusst auf Matten als Landestelle, da diese Option eine weitere Quelle von Verletzungen darstellt, zumal es im Handballspiel auch keine Matten als Landeoption gibt. Die zweite Übung der Erarbeitungsphase I, das Überlaufen von Bänken mit kräftigem Absprung in die Höhe und folgender beidbeiniger Landung, dient einerseits der Festigung des Drei-SchrittRhythmus und andererseits der Bewusstmachung eines kräftigen Absprung und dem Einsatz des Schwungbeines sowie der beidbeinigen Landung. Für beide Übungen könnte man die Bänke auch sternförmig aufstellen, sodass die Schüler mehr oder weniger den Drei-Schritt-Rhythmus fortlaufend im Kreis ausführen könnten. Anhand der verschiedenen Abstände zwischen den Bänken wäre eine Differenzierung nach den konstitutionellen Voraussetzungen der Schüler möglich. Ich habe mich gegen diese Alternative entschieden, da der Anlauf geradlinig erfolgen soll und nicht „bogenförmig. Weiterhin könnte man die Gruppen noch weiter differenzieren, um den konstitutionellen Voraussetzungen der Schüler gerecht zu werden. Leider stehen mir nicht genügend Hilfsmittel, wie weitere Langbänke oder Hocker etc. zur Verfügung. In LuA3 lernen die Schüler nun die Koordination der Sprung- und Wurfbewegung. Dazu sollen sie zunächst im Angehen aus ein bis zwei Schritten mit dem letzten Schritt von einer erhöhten Absprungstelle abspringen und den Sprungwurf hoch imitieren. Der Hintergrund dieser Übung liegt darin, dass sie aufgrund der verlängerten Flugphase, mehr Zeit für die Rückführung der Wurfarmschulter und des Wurfarmes zur Verfügung haben, um eine bessere Wurfauslage zu erhalten. Mir ist bewusst, dass die Phase der Anwendung von Imitationen nicht zu sehr ausgeweitet werden darf. Gelingt Ihnen die Übung in der Grobform, erfolgt die Ausführung mit Ball. Eine Differenzierungsmöglichkeit ist die Benutzung von Softbällen. Der Grund besteht darin, dass es vor 16 allem einigen Mädchen leichter fallen wird, den Ball besser in der Hand zu halten als bei der Anwendung von Handbällen. Ein weiterer Schritt ist die eben genannte Ausführung aus dem DreiSchritt-Anlauf. Alternativ könnte man die Schüler zunächst an eine Zauberschnur springen lassen, um diese dann zu berühren. Ich habe mich gegen diese Variante entschieden, da sich die Schüler dann wahrscheinlich mehr auf das Berühren der Schnur konzentrieren. Diese Variante wird in den nächsten Stunden, nach dem Beherrschen der Grobform seitens der Schüler, zur Anwendung kommen. Weiterhin könnte man eine Kastentreppe verwenden. Diese Variante würde einen enorm hohen Zeitaufwand mit sich bringen, um diese aufzubauen, der nicht gerechtfertigt werden kann. Außerdem würde die Übungseffektivität darunter leiden. Ich habe mich für die Aufteilung in 4 Gruppen entschieden. Mir ist klar, dass dadurch eine permanente Bewegungskorrektur seitens der Lehrkraft für alle Schüler nicht möglich ist. Alternativ hätte man nur zwei Gruppen á 12 Schüler einteilen können. Mir ist aber die Übungseffektivität in dieser Stunde wichtiger, zumal ich mich bemühen werde, möglichst viele Schüler zu korrigieren. In einer nun folgenden Zwischensicherung werde ich überprüfen, ob den Schülern die Bewegungskriterien bewusst sind und ob sie diese umsetzen können. In zwei Schülerdemonstrationen sollen eine gute und eine weniger gute Bewegungsausführung gezeigt werden. Daran können die Bewegungsmerkmale wiederholt werden. Auch eignet sich eine Zwischensicherung an dieser Stelle, da ich den Schülern anhand der zwei Beispiele empfehlen kann, wie sie weiter üben sollen. Der folgende Schritt beinhaltet dazu eine Differenzierungsmöglichkeit. Schüler deren eigene Leistung der des besseren Bewegungsbeispieles entspricht, können mit der nächsten Übung fortfahren und den Sprungwurf hoch ohne Absprunghilfe und aus dem Prellen heraus bzw. nach Zuspiel erarbeiten. Schüler, die sich in der weniger guten Demonstration wieder erkennen, sollen den zuletzt geübten Lernschritt weitere Male wiederholen, bevor sie zu LuA4 übergehen. Die Zwischensicherung wird eingeschoben, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, ihren Übungsstand zu überprüfen und mit den Bewegungskriterien abzugleichen, die zu Beginn der Stunde erarbeitet wurden. Darüber hinaus ermöglicht diese Phase ein konzentriertes Weiterarbeiten an den individuellen Schwachstellen jeden Schülers mit der entsprechenden Übung. Wie soeben erklärt erfolgt nun in der Erarbeitung II entweder die Erarbeitung weiterer Übungen, oder die Wiederholung bekannter Übungen, um das bisher Erlernte zu stabilisieren. Auch in dieser Phase werde ich die Schüler beraten und ggf. korrigieren. Mein Schwerpunkt wird dabei darauf liegen, ob die Schüler sich richtig eingeschätzt haben und die passende Übung für ihren Leistungsstand gewählt haben. In der Auswertungsphase möchte ich abschließend noch einmal die wesentlichen Bewegungsmerkmale sichern. Auf eine weitere Demonstration werde ich an dieser Stelle verzichten 17 sichern, da dies bereits in der Zwischensicherung erfolgte. Darüber hinaus wird die Technik dann weiter erarbeitet, indem sie in verschiedenen Spielformen zur Anwendung kommt. 18