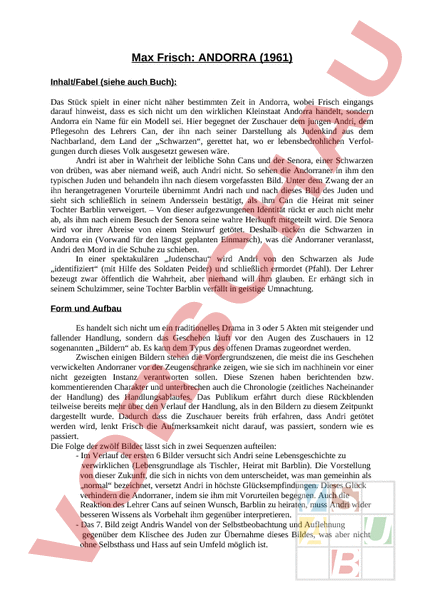Arbeitsblatt: Frisch "Andorra" Merkblatt
Material-Details
Auf dem Niveau von 14/15-Jährigen verfasstes Merkblatt zum als Klassenlektüre gelesenen Stück "Andorra" von Max Frisch
Deutsch
Leseförderung / Literatur
9. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
46046
1004
6
20.09.2009
Autor/in
Martina Frick
Land: Österreich
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Max Frisch: ANDORRA (1961) Inhalt/Fabel (siehe auch Buch): Das Stück spielt in einer nicht näher bestimmten Zeit in Andorra, wobei Frisch eingangs darauf hinweist, dass es sich nicht um den wirklichen Kleinstaat Andorra handelt, sondern Andorra ein Name für ein Modell sei. Hier begegnet der Zuschauer dem jungen Andri, dem Pflegesohn des Lehrers Can, der ihn nach seiner Darstellung als Judenkind aus dem Nachbarland, dem Land der „Schwarzen, gerettet hat, wo er lebensbedrohlichen Verfolgungen durch dieses Volk ausgesetzt gewesen wäre. Andri ist aber in Wahrheit der leibliche Sohn Cans und der Senora, einer Schwarzen von drüben, was aber niemand weiß, auch Andri nicht. So sehen die Andorraner in ihm den typischen Juden und behandeln ihn nach diesem vorgefassten Bild. Unter dem Zwang der an ihn herangetragenen Vorurteile übernimmt Andri nach und nach dieses Bild des Juden und sieht sich schließlich in seinem Anderssein bestätigt, als ihm Can die Heirat mit seiner Tochter Barblin verweigert. – Von dieser aufgezwungenen Identität rückt er auch nicht mehr ab, als ihm nach einem Besuch der Senora seine wahre Herkunft mitgeteilt wird. Die Senora wird vor ihrer Abreise von einem Steinwurf getötet. Deshalb rücken die Schwarzen in Andorra ein (Vorwand für den längst geplanten Einmarsch), was die Andorraner veranlasst, Andri den Mord in die Schuhe zu schieben. In einer spektakulären „Judenschau wird Andri von den Schwarzen als Jude „identifiziert (mit Hilfe des Soldaten Peider) und schließlich ermordet (Pfahl). Der Lehrer bezeugt zwar öffentlich die Wahrheit, aber niemand will ihm glauben. Er erhängt sich in seinem Schulzimmer, seine Tochter Barblin verfällt in geistige Umnachtung. Form und Aufbau Es handelt sich nicht um ein traditionelles Drama in 3 oder 5 Akten mit steigender und fallender Handlung, sondern das Geschehen läuft vor den Augen des Zuschauers in 12 sogenannten „Bildern ab. Es kann dem Typus des offenen Dramas zugeordnet werden. Zwischen einigen Bildern stehen die Vordergrundszenen, die meist die ins Geschehen verwickelten Andorraner vor der Zeugenschranke zeigen, wie sie sich im nachhinein vor einer nicht gezeigten Instanz verantworten sollen. Diese Szenen haben berichtenden bzw. kommentierenden Charakter und unterbrechen auch die Chronologie (zeitliches Nacheinander der Handlung) des Handlungsablaufes. Das Publikum erfährt durch diese Rückblenden teilweise bereits mehr über den Verlauf der Handlung, als in den Bildern zu diesem Zeitpunkt dargestellt wurde. Dadurch dass die Zuschauer bereits früh erfahren, dass Andri getötet werden wird, lenkt Frisch die Aufmerksamkeit nicht darauf, was passiert, sondern wie es passiert. Die Folge der zwölf Bilder lässt sich in zwei Sequenzen aufteilen: Im Verlauf der ersten 6 Bilder versucht sich Andri seine Lebensgeschichte zu verwirklichen (Lebensgrundlage als Tischler, Heirat mit Barblin). Die Vorstellung von dieser Zukunft, die sich in nichts von dem unterscheidet, was man gemeinhin als „normal bezeichnet, versetzt Andri in höchste Glücksempfindungen. Dieses Glück verhindern die Andorraner, indem sie ihm mit Vorurteilen begegnen. Auch die Reaktion des Lehrer Cans auf seinen Wunsch, Barblin zu heiraten, muss Andri wider besseren Wissens als Vorbehalt ihm gegenüber interpretieren. Das 7. Bild zeigt Andris Wandel von der Selbstbeobachtung und Auflehnung gegenüber dem Klischee des Juden zur Übernahme dieses Bildes, was aber nicht ohne Selbsthass und Hass auf sein Umfeld möglich ist. Vom 8. bis zum 12. Bild vollzieht sich in langsam die Katastrophe, die durch das Auftauchen der Senora scheinbar noch aufgehalten werden könnte. Ironischerweise beschleunigt der Besuch seiner leiblichen Mutter das Ende, das jedoch schon lange angebahnt ist. Was die Andorraner schon lange durch ihre Vorurteile und die Ausgrenzung Andris vorbereitet haben, wird nun von den Schwarzen unter Beihilfe der Andorraner vollzogen. Der Sündenbock wird nun zum sichtbaren Opfer. Das Grundelement des Aufbaus, das sich auch in der Form widerspiegelt, ist also die oben analysierte Begegnung zwischen den Andorranern und Andri. Diese Begegnung ist auf der Seite der Andorraner bestimmt durch ihre Geisteshaltung, die sich im Sagen und Denken, aber auch in Formen von Gewalt (seelischer und körperlicher) äußert. Gleichzeitig nutzen sie die Außenseiterposition Andris als vermeintlichen Juden für ihre eigenen Zwecke aus. Die einzelnen Bilder stellen exemplarisch diese Formen von Gewalt und Machtmissbrauch dar. Interpretationsansätze Eine zentrale Thematik des Stücks ist der Gegensatz zwischen Wirklichkeit und Vorstellung. Die Andorraner beurteilen Andri nicht danach, was sie mit ihm erleben und erfahren, sondern machen sich ein Bild von ihm, das stärker und wirklicher ist als die Wahrheit (siehe Szene mit Tischler!!) und dem Andri letztlich nicht entrinnen kann. Auf der moralischen Ebene zeigt das Werk natürlich auf, wohin uns Vorurteile (hier gegen Juden, Antisemitismus) führen können und dass diese in letzter Konsequenz bis zur Zerstörung eines Individuums führen, das nie als solches anerkannt wurde (Andri wird nicht als der Mensch gesehen, der er ist, sondern immer nur als „Jude, wobei dieses Bild des Juden sich aus kritiklos übernommenen Klischees über Juden zusammensetzt. Bezeichnenderweise treten im ganzen Stück keine „echten Juden auf). Ein weiterer Themenkomplex ist der der Identitätssuche. Andri versucht herauszufinden, wer er wirklich ist bzw. ob er so ist, wie die anderen ihn sehen. Sein Selbstbild entspricht zwar anfangs nicht dem Fremdbild (Bild der Andorraner von ihm), doch in der Praxis siegt im Stück (und oft auch in der Realität) das Bildnis, das sich die anderen von ihm gemacht haben. Das Bibelzitat „Du sollst dir kein Bildnis machen (Priester) ist als Aufforderung zu verstehen, diese unmenschliche und auch unchristliche Haltung zu ändern, um Schicksale wie die Andris zu vermeiden. Die historische Anspielung auf die Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten im Dritten Reich ist offensichtlich. Erste Notizen und eine Prosafassung des Stoffes sind bereits in Tagebüchern Frischs von 1946-49 zu finden. Dass Frisch von den „Schwarzen spricht und nicht konkret auf die Deutschen Bezug nimmt, zeigt, dass es dem Autor um die Kritik an einem allgemeinen Verhalten geht und nicht nur um die deutsche Geschichte. Dass die Deutschen nicht die Sündenböcke sind, denen man die alleinige Schuld an der Judenvernichtung geben kann, wird auch dadurch deutlich, dass er sich vielmehr für das Verhalten der Andorraner interessiert, die nicht so weiß (unschuldig) sind, wie sie glauben. Die wahre Bedrohung kommt von innen, von Haltungen, die den Angriff von außen erst ermöglichen. Dass Max Frisch damit auch auf die Schweiz anspielt, die gerne ihre Nichtbeteiligung am II. Weltkrieg als Unschuldsbeweis hervorkehrt, gleichzeitig aber auf verschiedenen Ebenen mit den Nationalsozialisten kollaborierte, ist eine weitere Ebene des Stückes, die aber absichtlich nicht in den Vordergrund gespielt wird.