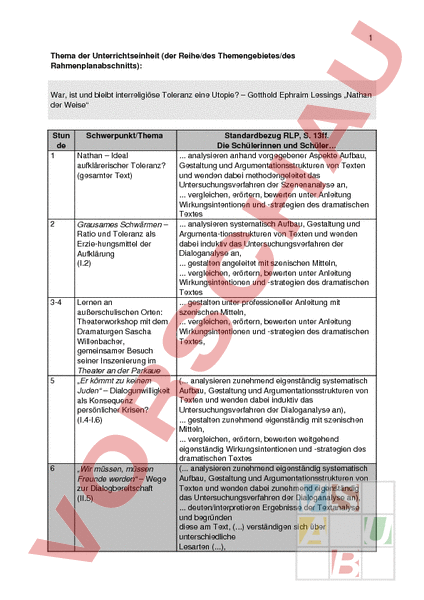Arbeitsblatt: Nathan und der Tempelherr
Material-Details
Unterrichtsentwurf für eine Examensstunde zu Nathan der Weise - Oberstufe, Jg 12
Deutsch
Textverständnis
12. Schuljahr
16 Seiten
Statistik
46418
1759
12
29.09.2009
Autor/in
hkatja25 (Spitzname)
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
1 Thema der Unterrichtseinheit (der Reihe/des Themengebietes/des Rahmenplanabschnitts): War, ist und bleibt interreligiöse Toleranz eine Utopie? – Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise Stun Schwerpunkt/Thema de 1 Nathan – Ideal aufklärerischer Toleranz? (gesamter Text) 2 Grausames Schwärmen – Ratio und Toleranz als Erzie-hungsmittel der Aufklärung (I.2) 3-4 Lernen an außerschulischen Orten: Theaterworkshop mit dem Dramaturgen Sascha Willenbacher, gemeinsamer Besuch seiner Inszenierung im Theater an der Parkaue „Er kömmt zu keinem Juden – Dialogunwilligkeit als Konsequenz persönlicher Krisen? (I.4-I.6) 5 6 „Wir müssen, müssen Freunde werden – Wege zur Dialogbereitschaft (II.5) Standardbezug RLP, S. 13ff. Die Schülerinnen und Schüler . analysieren anhand vorgegebener Aspekte Aufbau, Gestaltung und Argumentationsstrukturen von Texten und wenden dabei methodengeleitet das Untersuchungsverfahren der Szenenanalyse an, . vergleichen, erörtern, bewerten unter Anleitung Wirkungsintentionen und -strategien des dramatischen Textes . analysieren systematisch Aufbau, Gestaltung und Argumenta-tionsstrukturen von Texten und wenden dabei induktiv das Untersuchungsverfahren der Dialoganalyse an, . gestalten angeleitet mit szenischen Mitteln, . vergleichen, erörtern, bewerten unter Anleitung Wirkungsintentionen und -strategien des dramatischen Textes . gestalten unter professioneller Anleitung mit szenischen Mitteln, . vergleichen, erörtern, bewerten unter Anleitung Wirkungsintentionen und -strategien des dramatischen Textes, (. analysieren zunehmend eigenständig systematisch Aufbau, Gestaltung und Argumentationsstrukturen von Texten und wenden dabei induktiv das Untersuchungsverfahren der Dialoganalyse an), . gestalten zunehmend eigenständig mit szenischen Mitteln, . vergleichen, erörtern, bewerten weitgehend eigenständig Wirkungsintentionen und -strategien des dramatischen Textes (. analysieren zunehmend eigenständig systematisch Aufbau, Gestaltung und Argumentationsstrukturen von Texten und wenden dabei zunehmend eigenständig das Untersuchungsverfahren der Dialoganalyse an), . deuten/interpretieren Ergebnisse der Textanalyse und begründen diese am Text, (.) verständigen sich über unterschiedliche Lesarten (.), 2 7 8 9 10 11. . gestalten weitgehend eigenständig mit szenischen Mitteln, . vergleichen, erörtern, bewerten eigenständig Wirkungsintentionen und -strategien des dramatischen Textes Dialogbereitschaft als (. analysieren weitgehend systematisch Aufbau, Konsequenz der Gestaltung und Argumentationsstrukturen von Texten Bewältigung persönlicher und wenden dabei weitgehend eigenständig das Krisen? Untersuchungsverfahren der Dialoganalyse an), (III-V) . deuten/interpretieren Ergebnisse der Textanalyse und begründen diese am Text, (.) verständigen sich über unterschiedliche Lesarten (.), . gestalten eigenständig mit szenischen Mitteln, . vergleichen, erörtern, bewerten eigenständig Wirkungsintentionen und -strategien des dramatischen Textes Saladin und die Frage nach . analysieren systematisch Aufbau, Gestaltung und der wahren Religion Argumenta-tionsstrukturen von Texten und wenden (III.7) dabei eigenständig das Untersuchungsverfahren der Dialoganalyse an, . deuten/interpretieren Ergebnisse der Textanalyse und begründen diese am Text, (.) verständigen sich über unterschiedliche Lesarten (.), . gestalten eigenständig mit szenischen Mitteln, . vergleichen, erörtern, bewerten eigenständig Wirkungsintentionen und -strategien des dramatischen Textes Der Patriarch – . analysieren systematisch Aufbau, Gestaltung und Stammvater der Intoleranz? Argumenta-tionsstrukturen von Texten und wenden dabei eigenständig das Untersuchungsverfahren der Dialoganalyse an, . vergleichen, erörtern, bewerten eigenständig Wirkungsintentionen und -strategien des dramatischen Textes . verstehen unter Anleitung lineare und nicht lineare „Die gute böse Daja – Texte unterschiedlicher Art in ihren Aussagen, Intoleranz als normatives Absichten und formalen Strukturen und ordnen sie in Muster der Christenheit? einen größeren, sinnstiftenden Zusammenhang ein, (gesamter Text) . deuten/interpretieren unter Anleitung Ergebnisse der Textanalyse und begründen diese am Text, erkennen die Mehrdeutigkeit von Texten und verständigen sich über unterschiedliche Lesarten, kennen grundlegende wissenschaftliche Fragestellungen und Methoden der Literaturbetrachtung Klosterbruder und Al Hafi – . verstehen zunehmend lineare und nicht lineare Texte individuelle vs. normative unterschiedlicher Art in ihren Aussagen, Absichten und Konzepte von Toleranz formalen Strukturen und ordnen sie in einen größeren, (gesamter Text) sinnstiftenden Zusammenhang ein, 3 12. 13 . deuten/interpretieren zunehmend eigenständig Ergebnisse der Textanalyse und begründen diese am Text, erkennen die Mehr-deutigkeit von Texten und verständigen sich über unterschiedliche Lesarten, kennen grundlegende wissenschaftliche Fragestellungen und Methoden der Literaturbetrachtung Toleranz – ein notwendiger . verstehen weitgehend lineare und nicht lineare Texte Begriff im interreligiösen unterschiedlicher Art in ihren Aussagen, Absichten und Dialog? formalen Strukturen und ordnen sie in einen größeren, sinnstiftenden Zusammenhang ein, . deuten/interpretieren weitgehend eigenständig Ergebnisse der Textanalyse und begründen diese am Text, erkennen die Mehr-deutigkeit von Texten und verständigen sich über unterschiedliche Lesarten, kennen grundlegende wissenschaftliche Fragestellungen und Methoden der Literaturbetrachtung, . argumentieren logisch, überzeugend, differenziert und text-gestützt sowie entfalten schlüssig Begründungszusammenhänge und nehmen begründet Stellung War, ist und bleibt . verstehen lineare und nicht lineare Texte interreligiöse Toleranz eine unterschiedlicher Art in ihren Aussagen, Absichten und Utopie? formalen Strukturen und ordnen sie in einen größeren, sinnstiftenden Zusammenhang ein, . deuten/interpretieren eigenständig Ergebnisse der Textanalyse und begründen diese am Text, erkennen die Mehrdeutigkeit von Texten und verständigen sich über unterschiedliche Lesarten, kennen grundlegende wissenschaftliche Fragestellungen und Methoden der Literaturbetrachtung, . argumentieren logisch, überzeugend, differenziert und text-gestützt sowie entfalten schlüssig Begründungszusammenhänge und nehmen begründet Stellung 1. Lerngruppenanalyse Allgemeines und Besonderheiten: Den Grundkurs Deutsch der Gabriele-von-Bülow-Oberschule, der sich aus 9 Schülerinnen und 8 Schülern zusammensetzt, unterrichte ich seit Beginn des Schuljahres. Das (fast) ausgewogene Verhältnis der Zusammen-setzung ermöglicht das Arbeiten in einer ruhigen Atmosphäre, die jedoch besonders in Unterrichtsgesprächen bislang von den Schülerinnen dominiert wird. Aufgrund zahlreicher außerschulischer Aktivitäten seitens der Schülerinnen und Schüler (Uni-Tage, Exkursionen etc.) war konstanter Unterricht mit der gesamten 4 Lerngruppe nur bedingt möglich. Der gemeinsame Theaterbesuch brachte allerdings ein erhöhtes Maß an Motivation und die Bereitschaft, sich auf Text und Methode einzulassen. Fachkompetenzen Bei der Analyse literarischer Texte haben die Schülerinnen und Schüler im vergangenen Schuljahr ihre Kenntnisse über sprachlich-ästhetische Mittel und deren Wirkungsabsichten vertieft. Sie haben im ersten Semester vertieftes Wissen über die methodische Vorgehensweise der Analyse dramatischer Texte erworben, vertiefen diese derzeit am neuen Text, können jedoch bislang erarbeitete Phänomene nur ansatzweise in einen größeren sinnstiftenden Zusammenhang überführen. Die Methode der Dialoganalyse wurde zu Beginn der laufenden Unterrichtseinheit induktiv erarbeitet und befindet sich derzeit in einem Strukturierungsprozess. Deshalb bedarf es in Erarbeitungen noch einer stärkeren Steuerung durch die Lehrperson mittels gezielter Erarbeitungsschwerpunkte. Aufgrund eines verstärkten Interesses an historisch-politischen Kontexten konnten sich die Schülerinnen und Schüler bislang weitgehend erfolgreich zum Angebot jeweiliger Autoren in Beziehung setzen (z. B. Weltsichten oder Handlungen) und zunehmend eigene Positionen zu den Angeboten literarischer Texte entwickeln. Im Rahmen der laufenden Unterrichtseinheit steht die Erarbeitung von Verhaltensweisen literarischer Figuren und den daraus resultierenden Beziehungsgefügen im Mittelpunkt, die von der Lerngruppe erschlossen und in Ansätzen bereits kritisch bewertet wurde. Methodische Kompetenzen Die Grundannahme, ein Drama müsse gespielt werden, erfordert den Einsatz von Methoden des szenischen Interpretierens literarischer Werke. Zunächst wurde dafür ein grundsätzliches Rollenverständnis für Regie und Dramaturgie angebahnt, das von einigen Schülerinnen und Schülern in einem gemeinsam besuchten Theaterworkshop vertieft wurde. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse finden nun zunehmend auch Umsetzung in Form szenischer Lesungen1. Dabei zeigen sich bislang noch deutliche Schwierigkeiten in der sprachlichen Ausgestaltung von Textstellen, weshalb noch verstärkt mimische und gestische Mittel in die Gestaltung einfließen. Dies lassen sich insgesamt auf die oben beschriebene allgemeine Unterrichtssituation zurückführen. Im Zentrum der Erarbeitung steht in dieser Stunde die Arbeit in Kleingruppen. In dieser Lerngruppe war bislang auffällig, dass die Schülerinnen und Schüler verstärkt den individuellen Austausch bereits in der Erarbeitung 1 lit. Grundlage: Scheller, Ingo: Szenische Interpretation. Theorie und Praxis eines handlungs- und erfahrungsbezogenen Literaturunterrichts in Sekundarstufe und II, Seelze-Velber 2004. 5 suchen, um sich der Richtigkeit des eigenen Textverständnisses zu versichern und möglichen Peinlichkeiten bei der Präsentation vorzubeugen. Daher sind die Schülerinnen und Schüler in der Erarbeitung von Inhalten über den Austausch mit mehreren Mitschülern erprobt und erzielen damit oft verlaufsdienlichere Ergebnisse. Auch ist eine zunehmende Beteiligung an Unterrichtsgesprächen festzustellen, wenngleich leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler nach wie vor nur ansatzweise daran teilnehmen. Die allgemein rege Schülerbeteiligung während des Unterrichts wird in der heutigen Stunde möglicherweise geringer als üblich ausfallen, da dem Großteil der Lerngruppe die Situation einer Examensprüfung fremd ist. Einteilung in Lernniveaus: Die Schülerinnen und Schüler des Grundkurses können entsprechend den Anforderungsbereichen der Einheit-lichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Deutsch2 in drei verschiedene Lernniveaus eingeteilt werden: 1) leistungsstärker – (Anforderungsbereich III) Diese Schülerinnen und Schüler zeigen eine hohe Bereitschaft, über Lesen, Hören, An- und Zuschauen die Vielfalt von Texten wahrzunehmen, Textsorten in ihren Varianten und Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen und ihre Strukturmerkmale in deren Funktion zu analysieren. Sie beherrschen verschiedene Lesetechniken und wenden Strategien zum Leseverstehen selbstständig an. Zunehmend bauen sie eine problematisierende Haltung zu Texten auf, entwickeln und belegen verstärkt eigene Deutungen des Textes und können sich mit anderen darüber verständigen. Immer häufiger gelingt ihnen dabei das Verarbeiten komplexerer Gegebenheiten und sie gelangen zunehmend zu eigenständigen Lösungen, die sie ansatzweise auch in umfassendere problembezogene oder theoretische Zusammenhänge einordnen können. In Erarbeitungsphasen dominieren und koordinieren sie weitgehend die Arbeit mit dem Partner bzw. in der Gruppe und stellen sich auch gern zur Vorstellung der Ergebnisse im Plenum zur Verfügung, die sie bereits gut selbst steuern bzw. moderieren können. 2) mittleres Leistungsniveau – Anforderungsbereich II Schülerinnen und Schüler dieses Leistungsniveaus gelingt die eigenständige 2 Vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Deutsch (EPA). Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 i. d. F. vom 24.05.2002, S. 13. 6 Organisation des Arbeitsprozesses der Analyse und Interpretation immer besser. Sie beteiligen sich aktiv an Unterrichtsgesprächen, tragen aber bislang noch zu wenig zum progressiven Verlauf der Stunde bei. Sie beherrschen diverse Lesetechniken, wenden Strategien zum Leseverstehen oftmals selbstständig an und erarbeiten sich auf diese Weise inhaltliche und strukturelle Ebenen von Texten. Der Schritt zur Deutung gestaltet sich für sie noch schwierig, da sie noch nicht ausreichend anwenden und abstrahieren können. Sie zeichnen sich allerdings durch ein hohes Interesse an den Deutungsversuchen der Mitschüler aus und beteiligen sich auch verstärkt in derartigen Unterrichtsphasen. 3) leistungsschwach – Anforderungsbereich Diese Schülerinnen und Schüler haben noch Schwierigkeiten sich auf Texte einzulassen, die nicht aus dem persönlichen Erfahrungshorizont heraus verstanden werden. Sie können grundsätzlich Inhalte von Texten eigenständig wiedergeben sowie Textart, Aufbau und Strukturelemente erkennen. Ihnen gelingt die Anwendung geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in begrenzten Gebieten und in wiederholenden Zusammenhängen. Dementsprechend sind sie in Erarbeitungsphasen neuer Kontexte eher zurückhaltend. Aufgrund der nur mäßig vorhandenen Grundlagen an Wissen und Können fällt es ihnen meist schwer, eigene Deutungen zu Texten zu entwickeln und mit anderen darüber zu diskutieren. In Unterrichtsgesprächen treten sie daher bislang nur vereinzelt in Erscheinung. Selbst Präsentationen übernehmen sie nur, wenn die erarbeiteten Ergebnisse mehrfach vorab gesichert wurden. Ein Großteil dieser Schüler hat mich bereits vorab darüber informiert, dass eine Wiederholung der 12. Klasse geplant sei. Dieser Umstand zeigte sich in vergangenen Stunden durch unregelmäßige Teilnahme am Unterricht, weshalb diese Schüler in der heutigen Stunde auf keinerlei Vorwissen aufbauen können. Insgesamt handelt es sich um eine deutlich leistungsheterogene Lerngruppe, die jedoch ‚aus der Not eine Tugend gemacht hat. Es hat sich eine von den Schülerinnen und Schülern selbst initiierte Rollenzuweisung ergeben, die sowohl Lernklima als auch Leistungsfähigkeit positiv beeinflusst und somit von mir nicht reglementiert, sondern vielmehr ergänzt wird. So sind Lisa V. und Susanne beispielsweise Schülerinnen, auf deren genaue Texterarbeitung sich die Lerngruppe verlassen kann. Tim und Christoph steuern aufgrund eines gesteigerten historischen und politischen, aber auch religiös motivierten Interesses gern nützliches 7 Kontextwissen bei bzw. verifizieren diesbezügliche Aussagen der Lerngruppe meist fachlich korrekt. Bei Deutungsversuchen und in Transferphasen übernehmen oft Lisa D. und Jan die Gesprächsführung, wobei sich gerade in dieser Konstellation Reibungspunkte aufgrund unterschiedlicher Lesarten ergeben, die allerdings die Aufmerksamkeit des Plenums befördern und zunehmend auch gemeinsam in größerer Runde diskutiert werden. Einordnung der Stunde in die Einheit und spezielle Voraussetzungen Grundlegendes Wissen und Verständnis für das Zusammenspiel des dramatischen Personals hat die Lerngruppe in der vorherigen Sequenz im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex „Aufklärung und Aufklärungskritik erworben. Seit Beginn der laufenden Unterrichtseinheit vertieft die Lerngruppe ihr Wissen über Regie und Dramaturgie, indem sie immer wieder diese Rollen übernimmt und darüber wesentliche Wirkungsmöglichkeiten von Sprache, Mimik, Gestik und Kostüm vergleicht. Dies wurde in der ersten Stunde an Nathan als Hauptfigur erprobt und wird seitdem kontinuierlich weiterverfolgt. In der zweiten Stunde lernten die Schülerinnen und Schüler Nathan als weisen Erzieher seiner Adoptivtochter Recha kennen und diskutierten hierbei die Rationalität seiner Argumentation in Bezug auf den Wunderglauben und der Schwärmerei Rechas. In einem Theaterworkshop hatte ein Teil der Lerngruppe die Möglichkeit, die bereits erworbenen Kenntnisse zu Regie und Dramaturgie mit einem Fachmann zu besprechen. Dabei wurde unter professioneller Anleitung in die Methode des szenischen Lesens eingeführt. Im Anschluss daran besuchten die Schülerinnen und Schüler auch die Aufführung im Theater an der Parkaue und überprüften kritisch die im Workshop gewonnenen Erkenntnisse. Bei der heutigen Stunde handelt es sich um die sechste innerhalb der geplanten Unterrichtseinheit. Zu deren Vorbereitung haben die Schülerinnen und Schüler anhand der Szenen I.4 bis I.6 die Figurencharakterisierung des Tempelherrn erschlossen und ihn aufgrund seiner Identitätskrise als intoleranten Christen gedeutet. Dessen dogmatische Figurenanlage interpretierte die Lerngruppe als notwendige Orientierung innerhalb gesellschaftlicher und religiöser Weltanschauungen und als Ausdruck für das Überwinden des vermeintlichen Identitätsverlusts. Kritische Haltung übernahmen die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Rettung Rechas durch den Tempelherrn, die unter diesen Voraussetzungen eher als Suizid denn als tolerante, menschliche Handlung gedeutet wurde. Dass die Figur trotzdem über ein grundsätzliches Potential an Toleranz verfüge, interpretierten sie explizit anhand der Szene I.5. 8 2. Angestrebter Kompetenzerwerb/-zuwachs Laut den Anforderungen der EPA wird im Deutschunterricht in der gymnasialen Oberstufe dem Erschließen von literarischen Texten vorrangige Bedeutung beigemessen, denn das Verstehen literarischer Texte eigne sich als Muster des Verstehens überhaupt. Dabei sind laut EPA insbesondere Verfahren des textinternen wie des textexternen Erschließens anzuwenden.3 Diesem Anspruch wird die geplante Unterrichtseinheit insofern gerecht, als dass ein textinternes Erschließen mittels der Dialoganalyse und der szenischen Interpretation ins Zentrum der Erarbeitung gestellt und vertiefte Kenntnisse diesbezüglich angebahnt werden. Die im Abitur an die Lerngruppe gestellten Anforderungen werden im Berliner Rahmenlehrplan4 in Kompetenz-bezügen konkretisiert und sind über die darin formulierten Standards besonders zu fördernde Schwerpunkte im Unterricht. Im Rahmen der Fachkompetenz wird u.a. das „Lesen, Erschließen und Bewerten literarischer und pragmatischer Texte5 als Kompetenz benannt und z.B. über folgende Standards konkretisiert, denen die Planung der heutigen Stunde zugrunde liegt: Die Schülerinnen und Schüler • • • „deuten/interpretieren Ergebnisse der Textanalyse und begründen diese am Text, erkennen die Mehrdeutigkeit von Texten und verständigen sich über unterschiedliche Lesarten(.), gestalten mit szenischen Mitteln, vergleichen, erörtern, bewerten Wirkungsintentionen und -strategien von Texten6. 3. Konkretisierung der Standards für diese Stunde Für die heutige Stunde lassen sich die ausgewählten Standards wie folgt konkretisieren: Standards gemäß RLP 3 Standardkonkretisierung Nach EPA, S. 5f. Vgl. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin (Hrsg.): Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Deutsch, Berlin 2006. 5 A.a.O., S. 13. 6 Ebd. 4 9 Die Schülerinnen und Schüler Die Schülerinnen und Schüler deuten/interpretieren Ergebnisse der Textanalyse und begründen diese am Text, erkennen die Mehrdeutigkeit von Texten und verständigen sich über unterschiedliche Lesarten(.), gestalten mit szenischen Mitteln deuten/interpretieren die Ergebnisse ihrer Dialoganalysen von Gesprächsausschnitten der Szene II.5 und verständigen sich über unterschiedliche Lesarten vergleichen, erörtern, bewerten Wirkungsintentionen und -strategien von Texten wenden zur Kennzeichnung ihrer Interpretation des Beziehungswandels zwischen den Figuren das Verfahren des szenischen Lesens an vergleichen, erörtern, bewerten Wirkungsintentionen und -strategien der ausgewählten Szene, indem sie zu deren Relevanz für heutige Leser und Zuschauer begründet Stellung nehmen 4. Begründung der Themenwahl – Inhaltlicher Schwerpunkt Im Berliner Rahmenlehrplan der gymnasialen Oberstufe wird für das zweite Semester der Themenkreis „Aufklärung und Aufklärungskritik als ein Schwerpunkt im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Literatur und Sprache im 17./18. Jahrhundert als semi-verbindlich angegeben. Unter Berücksichtigung der ethnischen Zusammensetzung der Lerngruppe, deren gesteigertem Interesse an aktuell-politischen Fragen und natürlich auch in Absprache mit ihr wurde Lessings „Nathan der Weise als Grundlage des Erschließens gewählt. Die aktuell-politische Relevanz des Dramas ergibt sich grundsätzlich aus der Betrachtung internationaler Krisen und Konflikte, die unsere Zeit prägen und auch in der Lerngruppe nicht unbemerkt bleiben. Ethnische und soziale Konflikte innerhalb von Staaten, also im weitesten Sinne Bürgerkriege, haben zugenommen. Dazu kommen die Gefahren der Ausbreitung von Massenvernichtungswaffen und des internationalen Terrorismus. Gerade religiöse Motive befördern kriegerische Auseinandersetzungen7, die in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Anlass trauriger Nachrichtenmeldungen waren. Jedes Jahr werden dabei weltweit eine halbe Million Menschen mit Kleinwaffen und anderen konventionellen Waffen getötet – 7 Verwiesen sei an dieser Stelle zunächst auf den israelisch-arabischen Konflikt. Man sieht schon bei flüchtigem Hinsehen, dass nahezu alle Menschheitsfragen in diesem Konflikt – mehr indirekt als direkt – eine Rolle spielen. Sie begründen jedenfalls den ‚scharfen Aufprall unterschiedlicher Weltanschauungen, der sich im Nahen Osten, räumlich lokalisiert, auftut und die Welt immer wieder erschüttert. Auch der Konflikt zwischen den beiden südostasiatischen Staaten Indien und Pakistan kann angeführt werden, der sich um den Kampf der fundamentalistischen Hindus in Indien und Moslems aus Pakistan dreht. Prägnantestes Beispiel bleibt jedoch die Auseinandersetzung zwischen den USA und den Taliban. 1996 haben diese Rebellengruppen Afghanistan vollständig eingenommen und einen rein islamistischen Staat ausgerufen, der den Rechtsvorschriften der Scharia unterliegt. Der Konflikt eskalierte in den Terroranschlägen am 11. September 2001 und wird seitdem militärisch ausgetragen. 10 jede Minute ein Mensch. Notwendig scheint angesichts dieser Darstellung die Wiederaufnahme und Förderung interreligiöser Verständigung.8 Im Rahmen der Erarbeitung des ausgewählten Dramas kommt dem Erschließen der Figur des Tempelherrn innerhalb einer Kurzsequenz eine besondere Bedeutung zu, die sich grundsätzlich schon mit der Figurenzeichnung durch Lessing begründen lässt: Für den Leser und Zuschauer dürfte diese Figur deshalb so interessant sein, weil es sich hier nicht um eine idealisierte Figur wie Nathan handelt und sie gerade wegen ihrer Widersprüchlichkeit und Lebendigkeit ein besonders hohes Potential der Identifikation bietet.9 Der junge Tempelherr, wie ihn Lessing zu Beginn des Dramas einführt, stellt sich zunächst als die personifizierte Intoleranz und Ignoranz dar. Trotzig verweigert er jede menschliche Annäherung, von welcher Seite auch immer, höhnisch lehnt er jede angebotenen Hilfeleistung, jeden Dank aus dem Hause Nathans für die Rettung Rechas vor dem sicheren Flammentod ab. Was er für die Tochter Nathans getan habe, hätte er gemäß den Ordensvorschriften für jeden anderen auch getan, selbst wenn es sich „nur um eine Jüdin gehandelt hätte. Diese, seine gute Tat (neben der Ablehnung des Mordanschlags auf Saladin; I.5), ist es zunächst allein, die Zeugnis über sein im Kern besseres Wesen ablegt, jedoch in eklatantem Widerspruch zu dessen Worten und religiösem Fanatismus steht. 8 So erklärte auch Barack Obama, amtierender Präsident der USA, am 4. Juni 2009 in Kairo: „10I10c10h10 10b10i10n10 10n10a10c10h10 10K10a10i10r10o10 10g10e10k10o10m10m10e10n10,10 10u10m10 10e10i10n10e10n10 10N10e10u10a10n10f10a10n10g10 10z10w10i10s10c10h10e10n10 10d10e10n10 10V10e10r10e10i10n10i10g10t10e10n10 10S10t10a10a10t10e10n10 10u10n10d10 10d10e10n10 10M10u10s10l10i10m10e10n10 10ü10b10e10r10a10l10l10 10a10u10f10 10d10e10r10 10W10e10l10t10 10z10u10 10b10e10g10i10n10n10e10n10.10 10E10i10n10e10n10 10N10e10u10a10n10f10a10n10g10,10 10d10e10r10 10a10u10f10 10g10e10m10e10i10n10s10a10m10e10n10 10I10n10t10e10r10e10s10s10e10n10 10u10n10d10 10g10e10g10e10n10s10e10i10t10i10g10e10r10 10A10c10h10t10u10n10g10 10b10e10r10u10h10t10 10u10n10d10 10a10u10f10 10d10e10r10 10W10a10h10r10h10e10i10t10,10 10d10a10s10s10 10d10i10e10 10V10e10r10e10i10n10i10g10t10e10n10 10S10t10a10a10t10e10n10 10u10n10d10 10d10e10r10 10I10s10l10a10m10 10d10i10e10 10j10e10w10e10i10l10s10 10a10n10d10e10r10e10 10S10e10i10t10e10 10n10i10c10h10t10 10a10u10s10g10r10e10n10z10e10n10 10u10n10d10 10a10u10c10h10 10n10i10c10h10t10 10m10i10t10e10i10n10a10n10d10e10r10 10k10o10n10k10u10r10r10i10e10r10e10n10 10m10üs10s10e10n10.10 10S10t10a10t10t10d10e10s10s10e10n10 10üb10e10r10s10c10h10n10e10i10d10e10n10 10s10i10c10h10 10b10e10i10d10e10 10u10n10d10 10h10a10b10e10n10 10g10e10m10e10i10n10s10a10m10e10 10G10r10u10n10d10s10ä10t10z10e10 1010G10r10u10n10d10sä10t10z10e10 10d10e10r10 10G10e10r10e10c10h10t10i10g10k10e10i10t10 10u10n10d10 10d10e10s10 10F10o10r10t10s10c10h10r10i10t10t10e10s10,10 10d10e10r10 10T10o10l10e10r10a10n10z10 10u10n10d10 10d10e10r10 10W10ür10d10e10 10a10l10l10e10r10 10M10e10n10s10c10h10e10n10.10 9 Nach Diekhans, Johannes (Hg.)/Schünemann, Luzia: Gotthold Ephraim Lessing „Nathan der Weise. Unterrichtsmodell (EinFach Deutsch), Paderborn 2003, S. 79. 11 Nathan, der die vorurteilsbehafteten Äußerungen herunterspielt oder überhört und entschuldigt, will dennoch wissen, ob er etwas für den gefangenen Tempelherrn tun könne. Doch wird er auch damit im Kern zurückgewiesen, wenngleich der Tempelherr einräumt, bei der Anschaffung eines neuen Mantels auf ihn zurückzukommen. Seit seiner Rettungstat ist dieser nämlich an einer Stelle versengt, was Nathan zum Anlass nimmt, den Mantel an dieser Stelle zu küssen. Erstmals muss der Tempelherr erkennen, dass ihn die emotionale Rührung Nathans betroffen gemacht hat. Er räumt er ein, dass Nathan offenbar genau wisse, nach welchen Grundsätzen die Tempelherrn zu handeln hätten. Als Nathan dagegen einwendet, diese Grundsätze seien allen „guten Menschen gemeinsam, will der Tempelherr von dieser Gleichmacherei zunächst nichts wissen. Auch Nathans Bild, das ihm das Miteinander verschiedener Bäume im Wald vor Augen führt, kann ihm seine religiösen Vorurteile und seine Vorbehalte gegen die von den Juden eingeführte religiöse Intoleranz nicht nehmen. Genau diese „fromme Raserei stehe hier in Jerusalem wie an keinem anderen Ort der Welt auf der Tagesordnung. Als er sich zum Gehen wendet, bietet ihm Nathan seine Freundschaft an, da er erkennt, dass ihnen die Ablehnung von Intoleranz gemeinsam ist. Der Tempelherr gibt zu, sich in Nathan getäuscht zu haben und nimmt die Freundschaft an. Gleichzeitig kann er sich nun auch zu seinen verdrängten Gefühlen für Recha bekennen, die er unbedingt wiedersehen will. Die Beziehung der beiden Gesprächsteilnehmer ist vor Beginn und zu Beginn des Gesprächs vom Vorwissen voneinander und den unterschiedlichen Merkmalen ihrer persönlichen und sozialen Lage geprägt. Beides lässt zunächst für den Verlauf des Gesprächs nichts Positives erwarten. Im ersten Teil des Gesprächs versucht der Tempelherr die Kommunikation zu dominieren und seiner schon andernorts gegenüber Daja bekundeten Ablehnung einer Dankesgeste Nachdruck zu verleihen. So gelingt es dem Tempelherrn zunächst, die Kommunikation komplementär zu gestalten: Seine Gesprächsanteile überwiegen und sein ungeduldig und unbeherrscht wirkendes Unterbrechungsverhalten im Gespräch unterstreicht seine Absichten. Dabei wird dieser Gesprächsverlauf vordergründig durch Nathans nachsichtige, sehr zurückhaltende Worte gestützt. Da Nathan wegen des Brandmals betroffen ist und seine Gefühle authentisch wirken, kann auch der Tempelherr echte Gefühle zeigen, die ihn zu einer Neudefinition der Beziehung zu Nathan veranlassen. Diese wird markiert durch den Wechsel von der herabsetzend wirkenden Kollektivanrede „Jud zur Anrede Nathans mit seinem Namen. Im nachfolgenden Gesprächsausschnitt – durch die nun auf beide Dialogpartner 12 gleichermaßen verteilten Gesprächsanteile ausgedrückt – verläuft die Kommunikation zwischen Nathan und dem Tempelherrn also symmetrisch, d.h. sie basiert auf der von beiden akzeptierten Gleichberechtigung des Gegenübers. Die Beharrlichkeit, aber auch emotionale Offenheit, mit der Nathan, ohne verärgert von dannen zu ziehen, die geringen Chancen für ein gutes Ende der Begegnung nutzt, lässt Raum für die situationsangemessene Klärung der Beziehung. Diese – und dies führt dieser Dialog beispielhaft vor – ist die Voraussetzung für die erfolgreiche Kommunikation. Diese Entwicklung ist, wenn man die konfliktträchtige Ausgangssituation und den Beginn des Gesprächs der beiden betrachtet, nicht unbedingt zu erwarten. Neben der affektiv vorhergehenden Neudefinition der Beziehung beider Figuren zueinander, spielt dabei die Erkenntnis einer gemeinsamen Grundüberzeugung – unabhängig jeglicher religiöser Konventionen respektive Ordensregeln – die entscheidende Rolle. 5. Didaktische Reduktion/Begründung der Lehrstruktur Zentraler Unterrichtsgegenstand ist in der heutigen Stunde die Erörterung am Text belegbarer Effekte im interreligiösen Dialog zwischen Nathan und dem Tempelherrn. Neben der Tatsache, dass interreligiöser Dialog offensichtlich funktionieren kann, ließe sich anhand der ausgewählten Szene auch das Konzept aufklärerischer Erziehung erschließen: Diese dürfe gemäß ihrer allgemeinen Grundsätze der Welt nichts hinzufügen, sondern, nach Lessings eigener Formulierung, nur Vorgegebenes verwirklichen: „Erziehung, heißt es in Lessings Erziehung des Menschengeschlechts, „giebt dem Menschen nichts, was er nicht auch aus sich selbst haben könnte; sie giebt ihm das, was er aus sich selbst haben könnte, nur geschwinder und leichter.10 Ich habe mich gegen eine Fokussierung des Erziehungsprozesses entschieden, da es hierbei lediglich um den Nachvollzug einer Entwicklung ginge, deren Resultat von Anbeginn an feststeht: Wie auch immer die Analyse des Dialogs ausfiele, käme sie nicht um das Verdikt herum, dass der Effekt der rhetorischen Begabung Nathans eben die Verwirklichung der Gesellschaftsfähigkeit des Tempelherrn ist. Oben genannte Belege (S. 7ff.) sprechen im Rahmen der heutigen Stunde eher für eine Fokussierung des interreligiösen Dialogs als Schwerpunkt der Stunde. Die Lerngruppe hat diese Problematik bereits bei der Aufführung des Stückes im Theater an der Parkaue erfasst und vertieft sie im Rahmen der Unterrichtseinheit. Zur Vorbereitung der heutigen Stunde haben die Schülerinnen und Schüler die gesamte 10 Vgl. Lessing, G.E.: Erziehung des Menschengeschlechts. In: ders., Werke, Bd. 8, München 1970. Hier §4 der Schrift. 13 Szene II.5 gelesen und vertiefend jeweils einen vorgegebenen Gesprächsausschnitt hinsichtlich kommunikationspsychologischer Aspekte untersucht. Bei der Verteilung der einzelnen Texte wurde unter Berücksichtigung der Leistungs-heterogenität ein binnendifferenziertes Vorgehen gewählt. Dabei erhielten die leistungsschwächsten Schüler die erste Replik, die aufgrund der gesicherten Kenntnisse über den Tempelherrn keine Neudefinition der Beziehung zwischen den Figuren eröffnet, sondern lediglich alt bekannte Muster vertiefend darlegt.11 Die übrigen Gruppen sind aufgrund der Sitzordnung in der vergangenen Stunde in sich leistungsheterogen. Bei der Zuordnung des Materials wurde darauf Wert gelegt, dass Gruppen mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten heute ihre Kompetenzen im szenischen Gestalten vertiefen sollen. Diese erschließen daher die zweite und die letzte Replik, die aufgrund der dargestellten Beziehungsebene der Figuren differenzierte Anforderungen an die sprachliche, mimische und gestische Ausgestaltung stellen. Die, in Bezug auf die Analysekompetenz der Lernenden anspruchsvollste, dritte Replik erhielten Schülerinnen, die aufgrund ihrer kreativen Zugänge möglichst ein für alle Leistungsniveaus transparentes Ergebnis ihrer Interpretation bieten sollen. Ihre analytischen Fähigkeiten werden dabei in besonderem Maße herausgefordert, während die kreative Komponente nicht vernachlässigt wird. Den Auftakt der Stunde bildet die Reaktivierung des Vorwissens aus der vorangegangenen Stunde, in der die Lerngruppe den Tempelherrn anhand der Szenen I.4-I.6 charakterisiert und dessen mangelnde Dialogbereitschaft in Beziehung zu Daja/(Nathan) gesetzt hat. Dies soll mit einer geplanten Visualisierung rekapituliert und veranschaulicht werden, wobei sofort die Übertragung der Erkenntnisse zu Daja auf Nathan gefordert wird. Dazu werden Szenenbilder der Figuren aus der gemeinsam besuchten Aufführung genutzt, mit denen die Lerngruppe sehr positive Erinnerungen verbindet und somit schnell eine ‚persönliche Beziehung zum Thema aufbauen kann. Funktional und Gewinn bringend erscheint mir der Einsatz der Szenenbilder vor allem aufgrund der motivierenden und schüleraktivierenden Wirkung, welche die Lerngruppe zu einer Problem- und Fragehaltung anregt und somit für die Hauptlernaktion fokussiert. Um Verifikationen durch das Plenum zu ermöglichen, sind die Bilder ‚beweglich. Die Problematisierungsphase dient dem Erfassen der Prozesshaftigkeit im Beziehungswandel beider Figuren. Über die Eröffnung des Dramenausgangs sollen die Schülerinnen und Schülern dieser Wandel vor Augen geführt und der Weg als Untersuchungsgegenstand der heutigen Stunde eröffnet werden. Ich habe mich hierbei für 11 Dazu zählt für die heutige Stunde auch Christoph, der in der vergangenen Stunde nicht anwesend war und somit nur unzureichend mit der Textgrundlage vertraut sein wird. 14 die konkrete Steuerung entschieden, da aufgrund des inkonsequenten Unterrichtsbesuchs seitens der Schülerinnen und Schüler kaum von einem Problematisierungspotenzial ausgegangen werden kann. In der Erarbeitungsphase steht daher zunächst der Vergleich der individuell erarbeiteten Analyseergebnisse der vorgegebenen Gesprächsausschnitte im Zentrum. Dazu arbeitet die Lerngruppe arbeitsteilig an den vorgegebenen Texten, die in der Hausaufgabe12 bereits vertieft gelesen und hinsichtlich der Dialogstruktur untersucht wurden. Da das analytische Verfahren bislang noch erprobt wird, behalte ich mir derzeit noch das Recht zur Intervention vor, indem die Ergebnisse der einzelnen Gruppen von mir in Einzelgesprächen kontrolliert und ggf. gemeinsam verifiziert werden. Der Austausch der Lernenden untereinander während der Erarbeitung dezentriert jedoch insgesamt die Funktion der Lehrperson und ermöglicht eine höhere Aktivität der Schülerinnen und Schüler. Die Auswertung des gemeinsamen Theaterbesuchs hat ergeben, dass die Mehrheit der Lerngruppe dramatur-gische Entscheidungen und die Inszenierung insgesamt als zu aggressiv und zu bedrohlich kritisierte. In den ihr seit Reihenbeginn bekannten Rollen als Regisseure bzw. Dramaturgen sollen sie seitdem Verbesserungen vornehmen, ohne dabei die Grundlage des Textes zu missachten. Übungen dieser Vorgehensweisen lassen für die heutige Stunde die Möglichkeit zur Selbstorganisation des Arbeitens. Hilfestellungen bei Unsicherheiten schließt dies allerdings nicht aus. Die Ergebnissicherung erfolgt zunächst über die Präsentation der einzelnen Textabschnitte mittels der Methode des szenischen Lesens. Um das Plenum mit einzubeziehen, wird es nach jeder Präsentation aufgefordert die Beziehung der Figuren neu zu bewerten, indem diese entsprechend der vorgetragenen Replik im Tafelbild zueinander positioniert werden. Die Regisseure der vortragenden Gruppe leisten dabei ggf. Hilfestellungen, indem sie dramaturgische Entscheidungen ggf. genauer erläutern und mit Textbelegen argumentieren. Vertiefend fasst die Lerngruppe anhand ihrer erworbenen Kenntnisse die Wegbeschreibung Lessings von der ‚Ablehnung zur ‚Freundschaft zusammen. Dabei ist die Kombination sämtlichen Wissens Voraussetzung für ein Gelingen dieses Vorhabens. Mögliche Argumentationsansätze der Schülerinnen und Schüler ergeben sich dabei aus den Erkenntnissen aus der Hausarbeit, dem Vorwissen über die Figuren und der Szene im gesamten Handlungsverlauf. Die Transferphase soll Gelegenheit bieten, die Inhaltsebene des Textes zu verlassen Lessings Wirkungsintention zu diskutieren. Dies erfolgt über die Offenlegung des 12 Da sich die Lerngruppe die Vorgehensweise bei einer Dialoganalyse noch induktiv erschließt, wurden in der Hausaufgabe ausführlichere Arbeitsaufträge formuliert. 15 kommunikativen Ziels, Verständigung zwischen den Religionen zu schaffen. Dazu wurde eine Erläuterung des Begriffes „interreligiöser Dialog gewählt, die von der Lerngruppe in Bezug zum Text gesetzt werden soll. Dabei wäre der Erfolg der Gesprächsführung durch Nathan besondere Bedeutung beizumessen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Ergebnisse an der Tafel im Unterrichtsgespräch, damit alle Lernenden einbezogen werden und gemeinsam die Wirkungsintention diskutiert werden kann. Die Transparenz der gewonnenen Erkenntnisse wird durch deren Fixierung unter dem vorhandenen Tafelbild gewährleistet. Die Transparenz erleichtert zusätzlich den nachfolgenden Transfer, der den leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler bislang nur schwer gelingt. Indem die Schülerinnen und Schüler anschließend aktuelle Bezüge zur Handlung im Text herstellen, sollen sie insbesondere die heutige Relevanz des Stückes diskutieren. Dabei können sie sowohl auf die dramaturgische Gestaltung im Theater als auch auf die Inhalte des Theaterworkshops sowie im Unterricht behandelte Schwerpunkte zurückgreifen und anhand derer persönlich Stellung beziehen. In der abschließend zu erteilenden Hausaufgabe soll das Ergebnis der heutigen Stunde im späteren Handlungsverlauf weiter untersucht werden. Die Vorgabe der Schwerpunktszenen innerhalb der Lerngruppe resultiert in erster Linie im Interesse der Schülerinnen und Schüler sowie aus zeitökonomischem Interesse für die kommenden Unterrichtsstunden. Die zufällige Auswahl der zu erarbeitenden Szenen mittels Briefumschlägen löst die bisherige Binnendifferenzierung auf und leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler werden zunehmend zur Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten aufgefordert. Aufgrund der Textfülle findet zugunsten der Schaffung von Kontrollgruppen ein Wechsel der Sozialform zur Partnerarbeit statt, welche die Schülerinnen und Schüler ggf. bereits in den nachfolgenden Freistunden durchführen können. Sollte nach dem hier dargelegten Programm noch Zeit bleiben, ist als alternativer Stundenausgang eine genauere Reflexion der angewendeten Methode vorgesehen. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler die Durchführung kritisch reflektieren, auch ihre positiven Erfahrungen bzw. persönlichen Schwierigkeiten mit dem Verfahren erläutern und daraus ggf. Handlungsalternativen für kommende szenische Umsetzungen formulieren. 6. Begründung der methodischen Entscheidungen Den Einstieg der Stunde bildet die Zusammenfassung der Erkenntnisse zur Figur des 16 Tempelherrn aus der vorangegangenen Stunde und die Darstellung der daraus resultierenden Beziehung der Figuren Nathan und Tempelherr bis zur Szene II.5. Dazu wird eine Schülerin aufgefordert, die Figuren in ein vorbereitetes Koordinatensystem einzuordnen und dies unter Verwendung von Textbelegen zu begründen. Lernende, die in der vergangenen Stunde nicht anwesend waren, werden dadurch in die Thematik eingeführt, dagewesene können über die Visualisierung Ergebnis und Weg rekonstruieren. In der Problematisierungsphase wird die Lerngruppe via Overhead mit der letzten Regieanweisung des Dramas konfrontiert, die konträr zu der in der Vorstunde erarbeiteten Beziehung des Tempelherrn zu Nathan steht. Indem die Schülerinnen und Schüler die schlussendliche Figurenbeziehung erfassen, sollte sich grund-sätzlich die Frage nach dem Weg dorthin aufdrängen, da sie aufgrund der bisherigen Kenntnisse über die Figurenanlagen nicht möglich scheint. Der Lerngruppe wird dieser Weg aufgezeigt und darüber mittels klarer Aufgabenstellung der heutige Untersuchungsgegenstand vergegenwärtigt. Die gemeinsame Sicherung der Analyseergebnisse aus der häuslichen Arbeit erfolgt in der Erarbeitungsphase in einem ersten Schritt, indem sich die Schülerinnen und Schüler diese gruppenintern vorstellen und mögliche Unterschiede diskutieren. Diese Phase des Vergleichs soll ein differenziertes Verständnis der Textgrundlage sicherstellen. Aufgabe ist es anschließend, den Weg bis zu dieser Neudefinition der Beziehung nachzuvollziehen und transparent zu machen. Die Reduktion des Gesprächsauschnittes auf die diesen Weg am deutlichsten kennzeichnende Replik fordert die Gruppen vorab zu erneuter Textarbeit und indirekt zur Überprüfung ihrer Interpretation heraus. Gemäß den Anforderungen zur Präsentation der Ergebnisse wird in den Gruppen auf der Basis dieser ‚endgültigen Interpretation die szenische Lesung vorbereitet, indem die Lernenden in ihren Rollen als Regisseure die sprachliche und körpersprachliche Ausgestaltung entsprechend planen. Die Rollen der Leser werden dabei selbstständig verteilt. In der Ergebnissicherung präsentiert jede Gruppe ihre Interpretation. Bei der gewählten Methode wird der Text, in Rollen aufgeteilt, so gelesen, als wenn er in einer konkreten Situation gespielt würde. Diese ist für die Lerngruppe als Generalprobe deutlich gekennzeichnet. Beim Gestalten mit szenischen Mitteln kann man mit Lautstärke und Intonation entsprechend akzentuieren. Insbesondere Gesprächsstrategen der Kommunikations-teilnehmer lassen sich darüber herausstellen. Als vorbereitende Arbeit müssen sich die Gruppen mit den Figuren vertraut machen, die Lage und Stimmung herausfinden, um so eine angemessene Sprechweise zu realisieren (siehe HA/Erarbeitung). Da die Lerngruppe noch Defizite in der sprachlichen Ausgestaltung zeigt, wird den Gruppen freigestellt, ob bzw. inwieweit zusätzlich mimische und gestische Mittel verwendet werden. 17 So soll es gelingen, die sich wandelnde Beziehungskonstellation zwischen den Figuren deutlich zu kennzeichnen. Die Sitzanordnung der Leser können die Schüler selbstständig entscheiden. Das Plenum verfolgt die Präsentationen aufmerksam und stellt anschließend ggf. Verständnisfragen. Nach jeder Präsentation wird das Plenum dazu aufgefordert, die Figurenbeziehung gemäß der präsentierten Replik in das Koordinatensystem einzuordnen. Damit wird die Erschließung der Umsetzung durch die Zuschauer sichergestellt. Je später die Replik innerhalb des Gespräches liegt, desto mehr müssen sich dabei die Figuren annähern. Mit Hilfe geeigneter Textbelege, die insbesondere für die Entwicklung des Tempelherrn relevant sind und an der Tafel hinzugefügt werden, können die Beiträge des Plenums durch die Regisseure ergänzt und ggf. überarbeitet werden. Dabei wird eine weitgehend von den Schülern (Regisseuren) moderierte Gesprächsrunde angebahnt, in welche die Lehrperson lediglich bei Korrekturen eingreift. Ich habe mich für das deutliche Einbeziehen der Regisseure entschieden, da sich die Lerngruppe derzeit noch in einem frühen Stadium des Kompetenzerwerbs im Rahmen des szenischen Interpretierens befindet und das Erfassen von Nuancen allein über die Darstellung gerade für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler noch eine Schwierigkeit darstellt. Nachdem alle Repliken präsentiert wurden und die Arbeit an der ‚Beziehungskurve abgeschlossen ist, sollen die Schülerinnen und Schüler vertiefend die Gesprächsstrategien Nathans als ‚Motor der Verständigung zusammen-fassen. Dies erfolgt unter Rückgriff auf den zu Beginn der Stunde herausgearbeiteten Weg, den Lessing beschreibt. Um die Relevanz der hierbei formulierten Erkenntnisse der Lerngruppe herauszustellen, wird die zusammengefasste Wegbeschreibung unter der Visualisierung an der Tafel fixiert. Mittels der Vorgabe einer Definition des interreligiösen Dialoges wird in der Transferphase der Schwerpunkt der Diskussion für die Lerngruppe akzentuiert. Nachdem die Lerngruppe nunmehr die Szene inhaltlich erschlossen hat, wird die Frage aufgeworfen, ob bzw. inwieweit die hier vorgestellte Entwicklung von Vorurteil und Ablehnung hin zu gegenseitigem Respekt und Freundschaft für heutige Leser und Zuschauer relevant sein könne. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, begründet zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Der Impuls ist dabei weitgehend offen gestaltet, um die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler in die Diskussion einbinden zu können. Gemäß den Erfahrungen mit der Lerngruppe könnten trotzdem Lisa D. und Jan diese Phase dominieren. 14 14 7. Verlaufsplan Zeit 8.55-8.59 Uhr geplantes LV erwartetes SchV präsentiert ein Koordinatensystem an der Tafel und Szenenbilder des Tempelherrn 4 und Nathans Einstieg Vanessa, ordnen Sie bitte die Figuren entsprechend Ihres Vorwissens in das Koordinatensystem ein und begründen Sie kurz Ihre Entscheidung. präsentiert die letzte Regieanweisung des Dramas: erfassen das Zitat inhaltlich hinsichtlich des Beziehungswandels ordnen beide Figuren im oberen Teil des Koordinatensystems ein und begründen ggf. mit dem Schlagwort ‚Freundschaft Hierbei handelt es sich um die letzte 3 Regieanweisung des Dramas. Ordnen Sie darüber Problem die Figuren neu ein. a- übernimmt die Zuordnung entsprechend der tisierung SchAussagen weit hinter dem Pfeil Bis dahin ist es für den Tempelherrn ein langer Weg. Begleiten Sie die Figur dabei zumindest ein Stück durch die Dramenhandlung und bringen sie ihren Weg auf die Bühne. Keine Panik, es ist nur die Generalprobe. 9.02-9.16 Reduzieren Sie dazu Ihre Gesprächsausschnitte Uhr auf die Replik, in der der Wandel am deutlichsten angebahnt wird. Organisieren Sie sich dazu 14 weitgehend selbst. Erarbeitu fordert ggf. zur Gruppenfindung auf ng kontrolliert die Hausaufgabe unterstützt einzelne Gruppen in der Erarbeitung 9.16-9.33 Bühne frei. Uhr begibt sich ins Plenum koordiniert ggf. Redebeiträge bittet das Plenum nach jeder Präsentation um Neubewertung der Beziehung und um Fixierung eines geeigneten Zitats durch die 17 präsentierenden Gruppen Ergebnis sicherun g/ Vertiefun Fassen Sie aufgrund Ihrer gewonnenen Erkenntnisse Lessings Wegbeschreibung zusammen. fixiert SchAussagen unter dem Koordinatensystem präsentiert ein Zitat: „Interreligiöser Dialog eröffnet die Einsicht, dass die Religionen in ihrer eigentlichen Substanz die gleiche Wahrheit anstreben und der Streit zwischen ihnen durch historische Einflüsse, mangelndes Wissen und Missbrauch für Zwecke der Politik entstanden ist. Aufgabe des Dialoges ist es, diese tiefe Einheit wieder ans Licht zu bringen. 7 Transfer geht an die Tafel und ordnet die Figuren gemäß des erarbeiteten Grades an Dialogbereitschaft in das Koordinatensystem ein begründet die Einordnung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorstunde und ggf. Verwendung geeigneter Textbelege (z.B. TH: „er kömmt zu keinem Juden – 528, „Jud ist Jude – 777; N: grenzenlose Dankbarkeit für Rechas Rettung) „Unter stummer Wiederholung allseitiger Umarmung fällt der Vorhang. 9.33-9.40 Uhr Medien gUG Tafel KU OHPFolie, Tafel GA (at) ABs SchV ABs Tafel gUG Tafel Begrüßung der Lerngruppe 8.59-9.02 Uhr Sozialform/ Arbeitsform stellen ggf. Verständnisfragen finden sich in ihren Gruppen diskutieren dramaturgische Entscheidungen aufgrund des Gesprächsausschnittes einigen sich auf eine Replik präsentieren nacheinander die vorbereiteten szenischen Lesungen Plenum hört aufmerksam zu, stellt ggf. Rückfragen und übernimmt die Neueinordnung im Koordinatensystem Regisseure organisieren die Moderation weitgehend selbst und erläutern ihre Entscheidungen bei falscher Zuordnung bzw. bei Nachfragen mit Hilfe geeigneter Textbelege deuten Nathans Gesprächsstrategien hinsichtlich ihres Erfolges (ggf. auch als Manipulation durch vermeintliche Unterwürfigkeit) stellen die verbindenden Gemeinsamkeiten der Figuren heraus, die erst im Austausch aufgedeckt werden (argumentieren ggf. mit dem interreligiösen Austausch) erst der interreligiöse Dialog vermag es Vorurteile zu überwinden, (wenngleich es sich hier nur um zwei Religionen gleichen Ursprungs handelt) eröffnet gleichzeitig Perspektiven auf das Andere und Fremde und die Erkenntnis, dass die jeweiligen Vorstellungen durchaus ähnlich sind OHPFolie Nehmen Sie kurz zu diesem Zitat Stellung und berücksichtigen Sie dabei die gesamte Szene. KU Beurteilen Sie, ob bzw. inwieweit die im Text vorgestellte Entwicklung von Vorurteil und Ablehnung hin zu gegenseitigem Respekt und Freundschaft für uns heute modellhaft sein kann. diskutieren die Wirkungsabsicht des Beziehungswandels: Prozess der Verständigung zweier Religionen war erfolgreich und stellt somit eine konkrete Möglichkeit zur „Besserung dar; 14 Hausaufgabe: Begleiten Sie den Tempelherrn durch die weitere Dramenhandlung. Arbeiten Sie dabei zu zweit. Entsprechende Schwerpunktszenen habe ich bereits für Sie ausgewählt, Sie brauchen nur noch Glück die richtigen zu ziehen. bietet der Lerngruppe Briefumschläge, in denen sich die Arbeitsaufträge befinden Annäherung durch entdeckte Gemeinsamkeiten; Hinweis auf das Funktionieren des Dialogs zweier Religionen gleichen Ursprungs eröffnet Perspektiven für weitere Dialoge argumentieren auf der Kenntnisgrundlage heutiger religiös motivierter kriegerischen Konflikte (Afghanistan, USA-Islam, ObamaRede in Kairo, etc.) für das Vorbildhafte des Textes und dessen Relevanz auch für heutige Leser und Zuschauer finden sich paarweise und nehmen sich je einen Umschlag 14 8. Literaturnachweise: Zur curricularen Vorgabe: Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Deutsch (EPA). Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 i. d. F. vom 24.05.2002. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin (Hrsg.): Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Deutsch. 1. Aufl., Berlin 2006. Fachwissenschaftliche Literatur: Lessing, G.E.: Erziehung des Menschengeschlechts. In: ders., Werke, Bd. 8, München 1970. Müller-Niebala, Daniel: Die Wendung zum Bessern. Habilitationsschrift, Lausanne 1999. Will, Timotheus: Lessings dramatisches Gedicht Nathan der Weise und die Philosophie der Aufklärungszeit. ( Modellanalysen Literatur), Paderborn 1999. Didaktische Literatur: Diekhans, Johannes (Hg.)/Schünemann, Luzia: Gotthold Ephraim Lessing „Nathan der Weise. Unterrichtsmodell (EinFach Deutsch), Paderborn 2003. Haaser, Ingrid: Gotthold Ephraim Lessing „Nathan der Weise. Klassische Schullektüre (Lehrerheft), Berlin 1999. Scheller, Ingo: Szenische Interpretation. Theorie und Praxis eines handlungs- und erfahrungsbezogenen Literaturun-terrichts in Sekundarstufe und II, Seelze-Velber 2004.