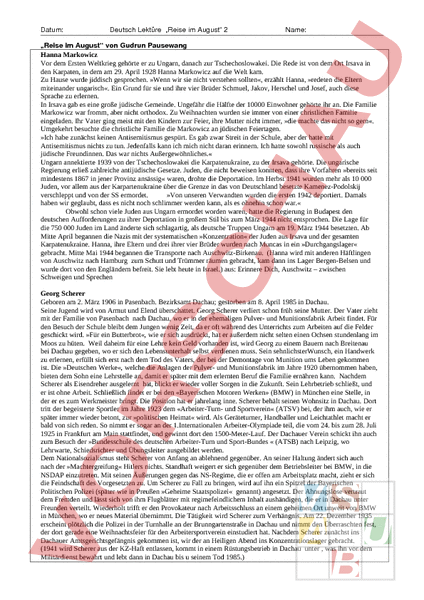Arbeitsblatt: Lektüre Die Reise im August 2
Material-Details
AB 2 zum Jugendbuch "Die Reise im August" von Gudrun Pausewang.
Deutsch
Leseförderung / Literatur
8. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
46622
1203
12
02.10.2009
Autor/in
skywalker (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Datum: Deutsch Lektüre „Reise im August 2 Name: „Reise im August von Gudrun Pausewang Hanna Markowicz Vor dem Ersten Weltkrieg gehörte er zu Ungarn, danach zur Tschechoslowakei. Die Rede ist von dem Ort Irsava in den Karpaten, in dem am 29. April 1928 Hanna Markowicz auf die Welt kam. Zu Hause wurde jiddisch gesprochen. »Wenn wir sie nicht verstehen sollten«, erzählt Hanna, »redeten die Eltern miteinander ungarisch«. Ein Grund für sie und ihre vier Brüder Schmuel, Jakov, Herschel und Josef, auch diese Sprache zu erlernen. In Irsava gab es eine große jüdische Gemeinde. Ungefähr die Hälfte der 10000 Einwohner gehörte ihr an. Die Familie Markowicz war fromm, aber nicht orthodox. Zu Weihnachten wurden sie immer von einer christlichen Familie eingeladen. Ihr Vater ging meist mit den Kindern zur Feier, ihre Mutter nicht immer, »die machte das nicht so gern«. Umgekehrt besuchte die christliche Familie die Markowicz an jüdischen Feiertagen. »Ich habe zunächst keinen Antisemitismus gespürt. Es gab zwar Streit in der Schule, aber der hatte mit Antisemitismus nichts zu tun. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Ich hatte sowohl russische als auch jüdische Freundinnen. Das war nichts Außergewöhnliches.« Ungarn annektierte 1939 von der Tschechoslowakei die Karpatenukraine, zu der Irsava gehörte. Die ungarische Regierung erließ zahlreiche antijüdische Gesetze. Juden, die nicht beweisen konnten, dass ihre Vorfahren »bereits seit mindestens 1867 in jener Provinz ansässig« waren, drohte die Deportation. Im Herbst 1941 wurden mehr als 10 000 Juden, vor allem aus der Karpartenukraine über die Grenze in das von Deutschland besetzte Kamenez-Podolskij verschleppt und von der SS ermordet. »Von unseren Verwandten wurden die ersten 1942 deportiert. Damals haben wir geglaubt, dass es nicht noch schlimmer werden kann, als es ohnehin schon war.« Obwohl schon viele Juden aus Ungarn ermordet worden waren, hatte die Regierung in Budapest den deutschen Aufforderungen zu ihrer Deportation in großem Stil bis zum März 1944 nicht entsprochen. Die Lage für die 750 000 Juden im Land änderte sich schlagartig, als deutsche Truppen Ungarn am 19. März 1944 besetzten. Ab Mitte April begannen die Nazis mit der systematischen »Konzentration« der Juden aus Irsava und der gesamten Karpatenukraine. Hanna, ihre Eltern und drei ihrer vier Brüder wurden nach Muncas in ein »Durchgangslager« gebracht. Mitte Mai 1944 begannen die Transporte nach Auschwitz-Birkenau. (Hanna wird mit anderen Häftlingen von Auschwitz nach Hamburg zum Schutt und Trümmer räumen gebracht, kam dann ins Lager Bergen-Belsen und wurde dort von den Engländern befreit. Sie lebt heute in Israel.) aus: Erinnere Dich, Auschwitz – zwischen Schweigen und Sprechen Georg Scherer Geboren am 2. März 1906 in Pasenbach. Bezirksamt Dachau; gestorben am 8. April 1985 in Dachau. Seine Jugend wird von Armut und Elend überschattet. Georg Scherer verliert schon früh seine Mutter. Der Vater zieht mit der Familie von Pasenbach nach Dachau, wo er in der ehemaligen Pulver- und Munitionsfabrik Arbeit findet. Für den Besuch der Schule bleibt dem Jungen wenig Zeit, da er oft während des Unterrichts zum Arbeiten auf die Felder geschickt wird. »Für ein Butterbrot«, wie er sich ausdrückt, hat er außerdem nicht selten einen Ochsen stundenlang im Moos zu hüten. Weil daheim für eine Lehre kein Geld vorhanden ist, wird Georg zu einem Bauern nach Breitenau bei Dachau gegeben, wo er sich den Lebensunterhalt selbst verdienen muss. Sein sehnlichsterWunsch, ein Handwerk zu erlernen, erfüllt sich erst nach dem Tod des Vaters, der bei der Demontage von Munition ums Leben gekommen ist. Die »Deutschen Werke«, welche die Anlagen der Pulver- und Munitionsfabrik im Jahre 1920 übernommen haben, bieten dem Sohn eine Lehrstelle an, damit er später mit dem erlernten Beruf die Familie ernähren kann. Nachdem Scherer als Eisendreher ausgelernt hat, blickt er wieder voller Sorgen in die Zukunft. Sein Lehrbetrieb schließt, und er ist ohne Arbeit. Schließlich findet er bei den «Bayerischen Motoren Werken» (BMW) in München eine Stelle, in der er es zum Werkmeister bringt. Die Position hat er jahrelang inne. Scherer behält seinen Wohnsitz in Dachau. Dort tritt der begeisterte Sportler im Jahre 1923 dem «Arbeiter-Turn- und Sportverein« (ATSV) bei, der ihm auch, wie er später immer wieder betont, zur »politischen Heimat« wird. Als Geräteturner, Handballer und Leichtathlet macht er bald von sich reden. So nimmt er sogar an der 1.Internationalen Arbeiter-Olympiade teil, die vom 24. bis zum 28. Juli 1925 in Frankfurt am Main stattfindet, und gewinnt dort den 1500-Meter-Lauf. Der Dachauer Verein schickt ihn auch zum Besuch der »Bundesschule des deutschen Arbeiter-Turn und Sport-Bundes « (ATSB) nach Leipzig, wo Lehrwarte, Schiedsrichter und Übungsleiter ausgebildet werden. Dem Nationalsozialismus steht Scherer von Anfang an ablehnend gegenüber. An seiner Haltung ändert sich auch nach der »Machtergreifung« Hitlers nichts. Standhaft weigert er sich gegenüber dem Betriebsleiter bei BMW, in die NSDAP einzutreten. Mit seinen Äußerungen gegen das NS-Regime, die er offen am Arbeitsplatz macht, zieht er sich die Feindschaft des Vorgesetzten zu. Um Scherer zu Fall zu bringen, wird auf ihn ein Spitzel der Bayerischen Politischen Polizei (später wie in Preußen »Geheime Staatspolizei« genannt) angesetzt. Der Ahnungslose vertraut dem Fremden und lässt sich von ihm Flugblätter mit regimefeindlichem Inhalt aushändigen, die er in Dachau unter Freunden verteilt. Wiederholt trifft er den Provokateur nach Arbeitsschluss an einem geheimen Ort unweit von BMW in München, wo er neues Material übernimmt. Die Tätigkeit wird Scherer zum Verhängnis. Am 22. Dezember 1935 erscheint plötzlich die Polizei in der Turnhalle an der Brunngartenstraße in Dachau und nimmt den Überraschten fest, der dort gerade eine Weihnachtsfeier für den Arbeitersportverein einstudiert hat. Nachdem Scherer zunächst ins Dachauer Amtsgerichtsgefängnis gekommen ist, wir der an Heiligen Abend ins Konzentrationslager gebracht. (1941 wird Scherer aus der KZ-Haft entlassen, kommt in einem Rüstungsbetrieb in Dachau unter was ihn vor dem Militärdienst bewahrt und lebt dann in Dachau bis seinem Tod 1985.) Datum: Deutsch Lektüre „Reise im August 2 Name: aus: Lebensläufe, Schicksale von Menschen, die KZ Dachau waren, Dachauer Dokumente Bd.2, 1990, Hgb. Verein Zum Beispiel Dachau Trage Stationen aus den Lebensläufen von den untenstehenden drei Personen ein: Alice Hanna Georg ich Datum: Deutsch Lektüre „Reise im August 2 Name: