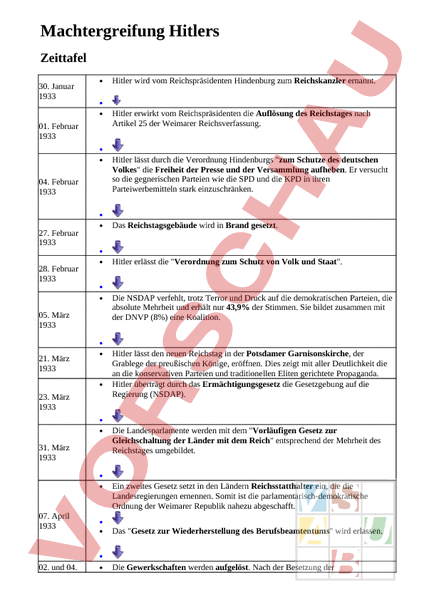Arbeitsblatt: Machtergreifung Hitlers
Material-Details
Machtergreifung Hitlers
Geschichte
Neuzeit
12. Schuljahr
7 Seiten
Statistik
47638
2196
30
20.10.2009
Autor/in
Robert Schuller
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Machtergreifung Hitlers Zeittafel 30. Januar 1933 • Hitler wird vom Reichspräsidenten Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. • • 01. Februar 1933 Hitler erwirkt vom Reichspräsidenten die Auflösung des Reichstages nach Artikel 25 der Weimarer Reichsverfassung. • • 04. Februar 1933 Hitler lässt durch die Verordnung Hindenburgs zum Schutze des deutschen Volkes die Freiheit der Presse und der Versammlung aufheben. Er versucht so die gegnerischen Parteien wie die SPD und die KPD in ihren Parteiwerbemitteln stark einzuschränken. • 27. Februar 1933 28. Februar 1933 • Das Reichstagsgebäude wird in Brand gesetzt. • • Hitler erlässt die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. • • 05. März 1933 Die NSDAP verfehlt, trotz Terror und Druck auf die demokratischen Parteien, die absolute Mehrheit und erhält nur 43,9% der Stimmen. Sie bildet zusammen mit der DNVP (8%) eine Koalition. • 21. März 1933 • • 23. März 1933 Hitler lässt den neuen Reichstag in der Potsdamer Garnisonskirche, der Grablege der preußischen Könige, eröffnen. Dies zeigt mit aller Deutlichkeit die an die konservativen Parteien und traditionellen Eliten gerichtete Propaganda. Hitler überträgt durch das Ermächtigungsgesetz die Gesetzgebung auf die Regierung (NSDAP). • • 31. März 1933 Die Landesparlamente werden mit dem Vorläufigen Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich entsprechend der Mehrheit des Reichstages umgebildet. • • 07. April 1933 • • Ein zweites Gesetz setzt in den Ländern Reichsstatthalter ein, die die Landesregierungen ernennen. Somit ist die parlamentarisch-demokratische Ordnung der Weimarer Republik nahezu abgeschafft. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wird erlassen. • 02. und 04. • Die Gewerkschaften werden aufgelöst. Nach der Besetzung der Gewerkschaftshäuser und der Verhaftung aller Funktionäre erfolgt am 04. Mai 1933 die Gründung der Deutschen Arbeitsfront (DAF). Mai 1933 • • 22. Juni 1933 • • 14. Juli 1933 • Dezember 1933 • • 30. Juni 1934 Das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien, oder auch Einparteiengesetz, wird erlassen. Die NSDAP erhält bei den Wahlen 92,2% der Stimmen. 7,8% der Stimmzettel sind ungültig. Die nationalsozialistische Parteilinke, eine Gruppe um Ernst Röhm, fordert die Zusammenführung der SA und der Reichswehr. Die angeblichen Putschversuche dieser Gruppe liefern Hitler den Vorwand zur Säuberung der eigenen Reihen, der viele alte politische Gefolgsleute zum Opfer fallen. • • 03. Juli 1934 August 1934 Verbot der SPD und Selbstauflösung der DDP. • Mit dem Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr wird das Vorgehen gegen Röhm und seine Gefolgsleute gerechtfertigt. Mit der Entmachtung der SA forciert Hitler nun den Aufbau der SS unter Heinrich Himmler. Mit dem Tod des Reichspräsidenten Hindenburg wird Hitler als Führer und Reichskanzler Parteichef, höchster Richter und Befehlshaber der Reichswehr. Genauere Erläuterungen der Zeittafel Die Präsidialkabinette und die Hitlerbewegung Im März 1930 beauftragte Reichspräsident (mehr zu diesem Amt) Hindenburg (mehr zu dieser Person) den Zentrumspolitiker Brüning mit der Bildung einer Regierung. Diesem Kabinett Brüning gehörte die SPD nicht mehr an. Hindenburg erteilte Brüning die Vollmacht gegebenenfalls auch ohne Mehrheiten ein Gesetz mittels des Notverordnungsartikels 48 der Weimarer Reichsverfassung durchzusetzen. Hindenburgs Vorgehen war zunächst ein politisches Verfahren, das im Rahmen der Verfassung lag, denn die Präsidialkabinette waren als Notprogramm von der Weimarer Reichsverfassung zugelassen worden. Nach Artikel 53 ernannte und entließ der Reichspräsident den Reichskanzler (mehr zu diesem Amt). Der Artikel 25 beinhaltete die mögliche Auflösung des Reichstages durch den Reichspräsidenten. Die Möglichkeit das Militär einzusetzen und Grundrechte aufzuheben, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, bot der Artikel 48. Die alten republikfeindlichen Eliten um Hindenburg hatten nicht vor die Weimarer Demokratie zu erhalten. Man legte alles daran, die SPD an den Rand zu drängen. Das Kabinett Brüning wurde von Franz Papens Kabinett der Barone abgelöst. Papen wurde nach fünfmonatiger Regierungszeit im November 1932 von Hindenburg abgesetzt und an seine Stelle trat der Reichswehrgeneral Kurt von Schleicher, der diesen Posten bis zum Januar 1933 bekleidete. Bis dahin hatten die alten Eliten versucht Hitler von der Macht fern zu halten. Sie ließen nur zu, dass die NSDAP durch häufige Neuwahlen 1928-1932 ihre Stimmen vermehren konnte. Hitlers Propaganda um den Begriff Volksgemeinschaft war auf die soziale Not und politische Orientierungslosigkeit der Masse abgestimmt und fand viel Gehör. Hindenburg musste sich nun entscheiden, ob Hitler als Nachfolger Schleichers in Frage kommen würde. Mit der Forderung Schleichers im Januar 1933 eine Militärdiktatur zu errichten war die Stunde der monarchistischen und völkischen Republikfeinde gekommen. Die Kamarilla um Hindenburg setzte den Führer der NSDAP, Adolf Hitler, als neuen Reichskanzler durch, indem sie als inoffizielle Berater erheblich Hindenburgs Entscheidungen beeinflussten. Am 30. Januar ernannte Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die alten Eliten unterschätzten Hitler und seine NSDAP. Sie sahen in ihm keine Gefahr, zumal seine Partei nach den letzten Wahlen als geschwächt galt, die NSDAP war in Hitlers Koalitionspartei in der Minderheit, da der Regierung neben Hitler nur noch Wilhelm Frick und Hermann Göring aus der NSDAP kamen, wobei die anderen fünf Minister dem Kabinett Papen angehörten. Außerdem versprach Hitler illegale Mittel nicht in Anspruch zu nehmen. Die NSDAP schien zähmbar zu sein. Der Beginn der Machtübernahme Eine absolute oder gar verfassungsändernde Mehrheit für die NSDAP zu erzielen, war nur durch Neuwahlen möglich, die Hindenburg zum 1. Februar gegen den Willen der DNVP und unter dem Druck Hitlers beschloss. Somit wurde der Reichstag am 1. Februar 1933 aufgelöst und Neuwahlen für den 5. März angesetzt. Es stand nun ein einmonatiger Wahlkampf bevor, den Hitler zu beeinflussen wusste. Der Wahlkampf der NSDAP Am 4. Februar 1933 erließ Hindenburg eine Verordnung zum Schutz des deutschen Volkes zur Kontrolle von Zeitungen und politischen Versammlungen. Dies schwächte vor allem die SPD und die KPD, da diese nun große Schwierigkeiten hatten, ihren Wahlkampf ungestört zu führen. Hermann Göring wurde kommissarischer Innenminister und verfügte als Polizeichef in Preußen über die Gewalt der SA, die er als Hilfspolizei einsetzte. Die NSDAP führte ihren Wahlkampf mit allen Mitteln der Propaganda und des Straßenterrors durch SA (mehr zu dieser Organisation) und SS (mehr zu dieser Organisation), die einen Schießbefehl gegenüber Staatsfeinden erhielten. Bei den Überfällen der SS und der SA griff die Polizei nun nicht mehr ein. Der Reichstagsbrand Am 27. Februar 1933 ging das Reichstagsgebäude in Berlin in Flammen auf. Diesen bis heute in seiner Urheberschaft umstrittenen Anschlag nutzte Hitler um Hindenburg dazu zu bewegen ihm die Freiheit zu erteilen per Notverordnungen nach Artikel 48 der Weimarer Verfassung regieren zu dürfen. Die erste, durch Hitler eingeführte Notverordnung, war die sogenannte Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, der so genannten Brandverordnung. Diese Brandverordnung setzte am 28. Februar die klassischen Grundrechte der Verfassung (Freiheit der Person, die Meinungs-, Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit, das Post- und Telefongeheimnis sowie die Unverletzlichkeit von Eigentum und Wohnung) außer Kraft und führte die Todesstrafe für Hoch- und Landesverrat ein. Somit wurde der Kern des Rechtsstaates, der Schutz der Privatsphäre des Bürgers vor willkürlichem Zugriff durch den Staat, unter Wahrung des gesetzmäßigen Weges aufgehoben. Die staatliche Willkürherrschaft wurde somit zur eigentlichen Verfassung des Dritten Reiches. Durch die Brandverordnung war die NSDAP in der Lage die KPD für den Anschlag nicht nur verantwortlich zu machen sondern auch Schritte gegen sie vorzunehmen. Im Reichstagsbrandprozess wurden zwar alle KPD Mitglieder, bis auf den Holländer van der Lubbe, freigesprochen, dennoch wurde die Hälfte der KPD-Funktionäre willkürlich verhaftet. Auch viele Anhänger der SPD wurden noch während des Wahlkampfes verhaftet. Die Wahlen am 5. März 1933 Trotz der massiven Unterstützung durch den Staatsapparat und erheblicher Spenden der deutschen Schwerindustrie (über 3 Millionen Reichsmark) erreichte die NSDAP in den Wahlen vom 5. März 1933 nur 43,9% der Stimmen und somit nicht die angestrebte absolute Mehrheit. Mit den Stimmen der DNVP reichte es allerdings zu einer solchen Mehrheit. Zentrum, SPD und KPD konnten ihre Stimmenanteile in etwa behaupten. Die NSDAP hatte vor allem bisherige Nichtwähler erreicht. Das Ermächtigungsgesetz Die Regierungskoalition hatte nun die absolute Mehrheit im Parlament, jedoch wollte Hitler mehr. Er strebte immer noch das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Staat, oder auch Ermächtigungsgesetz an. Dies beinhaltete, dass der Reichstag auf seine Kontroll- und alleinige Gesetzgebungsaufgabe verzichtet und der Regierung schrankenlose Gesetzgebungsmöglichkeiten eingeräumt wird. Von den im Reichstag noch verbliebenen Fraktionen, alle kommunistischen (81) und ein Teil der sozialdemokratischen (26) Abgeordneten waren bereits Ende Februar nach der Brandverordnung verhaftet worden, war die SPD entschieden gegen die am 24. März drohende Beseitigung des parlamentarischen Regierungssystems. Das Zentrum und alle anderen bürgerlichen Parteien glaubten Hitlers Versprechungen den Reichspräsidenten und die Länder nicht anzutasten. Um das Ermächtigungsgesetz zu verabschieden benötigte Hitler die Zweidrittelmehrheit im Parlament. Allerdings war dazu auch die Anwesenheit von zwei Dritteln der Abgeordneten notwendig, die sich aber zum Teil in Schutzhaft befanden. Hitler gelang es jedoch durch Änderung der Geschäftsordnung dies zu umgehen, sodass fortan alle unentschuldigt Abwesenden als anwesend gezählt wurden. Am 24. März stimmten fast alle Abgeordneten dem Ermächtigungsgesetz zu. Lediglich die SPD unter Otto Wels, der an diesem Tag die letzte freie Rede im Parlament hielt, stimmte geschlossen gegen das Gesetz. 444 von 647 Abgeordneten billigten das Gesetz. Damit hatte sich das Parlament selbst ausgeschaltet. Durch die Beseitigung der Gewaltenteilung wurde die Reichsregierung mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet und war nicht mehr an Verfassungsbestimmungen gebunden. Das Ermächtigungsgesetz sollte zunächst vier Jahre gelten, wurde aber 1937 und 1939 verlängert und 1943 von jeder Befristung befreit. Gleichschaltung der Länder und Gemeinden Am 05. März 1933, also am Tag der Reichstagswahlen, fing die Regierung unter Hitler an den Länder und Kommunen ihre Selbstverwaltungsrechte zu entziehen. Diese Gleichschaltung beinhaltete die Durchsetzung diktatorischer Herrschaft bis hinunter zur kleinsten Dorfgemeinde. Man nahm das Fehlen einer NS-Flagge auf dem Rathaus als Anlass die SA aufmarschieren zu lassen. Daraufhin befahl Reichsinnenminister Frick unter Berufung auf die Brandverordnung den Einsatz von Staatskommissaren. Am 31. März 1933 sorgte die Reichsregierung durch das Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich für die Anpassung der Mandatsverteilung in den Landesparlamenten an die Ergebnisse der Reichtagswahlen vom 05. März. Entweder die Regierungskoalition oder die NSDAP hatten automatisch die Mehrheit inne, da die Sitze der Kommunisten nicht mehr berücksichtigt werden durften. Da aber die Länderregierungen nun im Stande waren durch das Ermächtigungsgesetz ohne die Beteiligung der Landesparlamente Gesetze zu erlassen, waren diese Landtage bereits politisch bedeutungslos geworden. Anfang April wurden sogenannte Reichsstatthalter in den Ländern eingesetzt. Diese waren dem Reichskanzler unterstellt und kontrollierten in seinem Auftrag die Länder. Das Beamtentum Um eine effiziente Kontrolle der Staatsbürokratie zu erlangen, erließen die Nationalsozialisten am 07. April 1933 das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Somit wurden alle jüdischen, sozialdemokratischen, kommunistischen und betont christlichen Beamten aus dem Staatsdienst entfernt und nahezu alle höheren Positionen mit NSDAP-Mitgliedern besetzt. Die Auflösung der Gewerkschaften Die NSDAP schaffte es bis 1933 nicht, die freien Gewerkschaften nationalsozialistisch zu durchsetzen. Im März 1933 erhielten die Gewerkschaften in den Betriebsratswahlen mehr als drei Viertel der Stimmen und konnten sich somit klar gegen die nationalsozialistische Konkurrenz behaupten. Die Gewerkschaften hofften sich dem NS-Regime anpassen zu können. So versuchte sich der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Christlichen Gewerkschaften noch durch Loyalitätserklärungen das Wohlwollen der Nationalsozialisten zu sichern, doch diese bereiteten bereits deren Zerschlagung vor. Durch ein Reichsgesetz wurde der 1. Mai zum Feiertag der nationalen Arbeit. Die Erfüllung dieser alten Forderung der Arbeiterbewegung hatte den Zweck diese von den wahren Absichten der Nationalsozialisten abzulenken. Nach der großen gemeinsamen Mai-Feier von NS- und Arbeiterorganisationen wurden ein Tag später am, 2. Mai 1933, alle Gewerkschaftshäuser von SA und SS besetzt und die Gewerkschaftsführer in Schutzhaft genommen. Das Gewerkschaftsvermögen wurde beschlagnahmt. Die Auflösung der Parteien Im Sommer 1933, am 22. Juni, wurde die SPD zu einer volks- und staatsfeindlichen Organisation erklärt und verboten, nachdem das Vermögen der Partei bereits im Mai eingezogen worden war. Die Fraktionäre waren zu diesem Zeitpunkt entweder geflüchtet oder saßem in Konzentrationslagern, sodass die Partei in vielen Städten kaum noch existierte. Die bürgerlichen Parteien, wie die DDP, sahen ein, dass sie sich in Hitler getäuscht hatten und mussten von der Illusion ihn zähmen zu können loslassen. Sie lösten sich Ende Juni/Anfang Juli selbst auf. Am 14. Juli wurde mit dem Gesetz gegen die Neubildung von Parteien die Neubildung von Parteien verboten. Am 1. Dezember 1933 wurde das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat erlassen, das die NSDAP als alles beherrschende Staatspartei bestätigt. Der Reichstag diente von nun an nur noch als Kulisse für die Reden des Führers. Die Säuberung der eigenen Reihen Einer Hitlers Pläne war es aufzurüsten und somit die Wehrmacht zu vergrößern. Die SA-Führung unter ihrem mächtigen Chef Ernst Röhm drängte darauf die führende Rolle in diesem neu aufzubauenden Volksheer zu übernehmen. Jedoch sahen Hitlers Absichten anders aus. Er zog es vor mit den bewährten Kräften der alten Reichswehr auf den geplanten Krieg hinzuarbeiten. Es brach ein Machtkampf innerhalb der eigenen Reihen aus, den Hitler mit der gleichen Brutalität zu führen wusste, wie schon gegen seine alten Widersacher. Am 30. Juni 1934 ließ er den Stabschef, Röhm, weitere SA-Führer und einige konservative Gegner, wie den ehemaligen Reichskanzler Kurt von Schleicher, durch Kommandos der SS ohne Gerichtsurteil erschießen. Um gegebenenfalls sich erhebende SA-Mitglieder zu bekämpfen, standen Wehrmachtseinheiten der SS bereit. Offiziell warf man Röhm einen Putschversuch vor und seine Erschießung und die der anderen SA-Führer wurde als Niederschlagung eines Umsturzversuches gerechtfertigt. Dies führte zur Wiederherstellung der Autorität Hitlers innerhalb der eigenen Partei und zur Entscheidung des parteiinternen Machtkampfes zwischen der eher eher sozialrevolutionären SA und der elitären SS. Reichspräsident und Reichspräsident Reichspräsident war die Bezeichnung für das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches von 1919 bis 1945. Gemäß Artikel 43 der Weimarer Reichsverfassung wurde der Reichspräsident unmittelbar vom Volk gewählt. Die Amtszeit betrug sieben Jahre, wobei mehrfache Wiederwahl zulässig war. Für das Amt kandidieren konnten deutsche Staatsbürger, die das 35. Lebensjahr vollendet hatten. Im Gegensatz zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland hatte der Reichspräsident nicht nur repräsentative Aufgaben, sondern konnte durch die Auflösung des Reichstags (Artikel 25) und durch Entlassung und Ernennung des Reichskanzlers (Artikel 53) direkten Einfluss auf die Politik nehmen. In der Weimarer Republik (1918-1933) wurde der Reichskanzler vom Staatsoberhaupt nunmehr dem Reichspräsidenten ernannt und entlassen, doch war er zugleich dem Reichstag gegenüber verantwortlich. Der Reichskanzler konnte aufgrund dieser Konstruktion allerdings auch ohne parlamentarische Mehrheit regieren (Artikel 48 der Reichsverfassung von 1919 sah die sog. Notverordnungen vor, die nur vom Reichspräsidenten erlassen werden konnten). SA und SS Die SA (Sturmabteilung) wurde im Jahr 1920 als politische Kampftruppe der NSDAP gegründet. Mitglieder waren vor allem Angehörige des Freikorps und der Bürgerwehrverbände. Nach 1921 wurde die SA konsequent zur paramilitärischen Organisation umgeformt und diente seitdem zur Terrorisierung von politischen Gegnern und Juden. Die SA war die wichtigste Organisation, mit der Hitler unmittelbar nach der Machtübernahme seinen Terror entfaltete. Die SS (Schutzstaffel) war zwischen 1933 und 1945 die Organisation mit dem besten Überwachungsund Terrorapparat. Diese NS-Organisation übertraf alle anderen staatlichen und militärischen Institutionen an Macht, weswegen die NS-Diktatur auch als SS-Staat bezeichnet wird. Alle Aufgaben, die Hitler wichtig waren wurden der SS übertragen: die Sicherung der Macht in Deutschland und während des Krieges in den besetzten Gebieten sowie die Verfolgung und Vernichtung der Gegner. Die SS war daher die eigentliche Exekutive des Führers. Ihre Gründung fand im Jahre 1925 statt. Sie war ursprünglich als eine Art Parteipolizei ins Leben gerufen worden, die Heinrich Himmler seit 1929 befehligte. Im Januar 1933 bestand sie aus 56.000 Mann. Durch die Entmachtung der SA im Sommer 1934 übernahm die SS auch die Konzentrationslager.