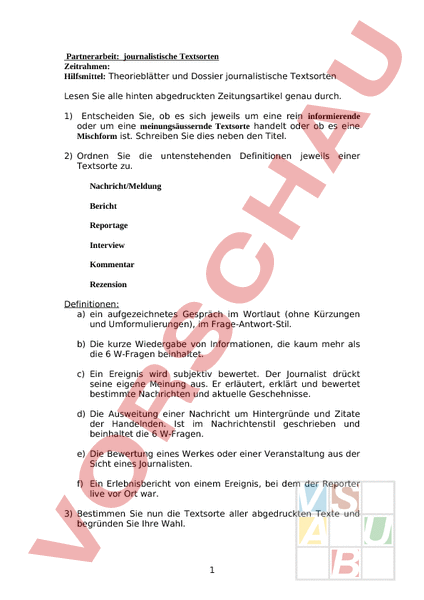Arbeitsblatt: journalistische Textsorten bestimmen
Material-Details
dies ist eine längere, Übugnstest-artige Aufgabe zur Bestimmung der journalistischen Textsorten.
Deutsch
Anderes Thema
11. Schuljahr
8 Seiten
Statistik
49896
535
9
27.11.2009
Autor/in
Helen Flury
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Partnerarbeit: journalistische Textsorten Zeitrahmen: Hilfsmittel: Theorieblätter und Dossier journalistische Textsorten Lesen Sie alle hinten abgedruckten Zeitungsartikel genau durch. 1) Entscheiden Sie, ob es sich jeweils um eine rein informierende oder um eine meinungsäussernde Textsorte handelt oder ob es eine Mischform ist. Schreiben Sie dies neben den Titel. 2) Ordnen Sie die Textsorte zu. untenstehenden Definitionen jeweils einer Nachricht/Meldung Bericht Reportage Interview Kommentar Rezension Definitionen: a) ein aufgezeichnetes Gespräch im Wortlaut (ohne Kürzungen und Umformulierungen), im Frage-Antwort-Stil. b) Die kurze Wiedergabe von Informationen, die kaum mehr als die 6 W-Fragen beinhaltet. c) Ein Ereignis wird subjektiv bewertet. Der Journalist drückt seine eigene Meinung aus. Er erläutert, erklärt und bewertet bestimmte Nachrichten und aktuelle Geschehnisse. d) Die Ausweitung einer Nachricht um Hintergründe und Zitate der Handelnden. Ist im Nachrichtenstil geschrieben und beinhaltet die 6 W-Fragen. e) Die Bewertung eines Werkes oder einer Veranstaltung aus der Sicht eines Journalisten. f) Ein Erlebnisbericht von einem Ereignis, bei dem der Reporter live vor Ort war. 3) Bestimmen Sie nun die Textsorte aller abgedruckten Texte und begründen Sie Ihre Wahl. 1 „Um diese Insel macht der Stress einen Bogen Textsorte: Begründung: „ManU-Fans randalieren Textsorte: Begründung: „Die Panik rächt sich Textsorte: Begründung: „Testkäufe zeigen Wirkung Textsorte: Begründung: „Das Problem sind die Männer Textsorte: Begründung: 2 „Reissende Stromschnellen Textsorte: Begründung: 4) Im Text „Um diese Insel macht der Stress einen Bogen sind vier Elemente mit (1), (2), (3) und (4) bezeichnet. Geben Sie die Fachausdrücke dafür an. (1) (2) (3) (4) 5) Markieren Sie im Text „Reissende Stromschnellen die für diese Textsorte typischen 3 Teile mit verschiedenen Farben und beschriften sie diese. 3 Berner Zeitung; 16.10.2009; Seite 35 Mauritius (1) Um diese Insel macht der Stress einen Bogen (2) Mauritius ist das Reiseziel für gestresste Vielarbeiter, denn das Meer, die Vielfalt der Insel und die exotische Küche lassen den Alltag rasch verblassen. Und heiraten lässt sich dort übrigens auch gut. (3) «Vite, vite, Madame», rufen die Männer vom Boot, das gerade dabei ist abzulegen. Vor lauter Robinson-Crusoe-Gefühl, das sich auf der menschenleeren Ilot Mangénie einstellte, hätte die Reisende beinahe das letzte Schiff zum Festland verpasst. Eine Nacht am Strand, direkt unter den Sternen, wäre so schlecht nicht gewesen. Doch das Wachpersonal sorgt mit strengem Blick dafür, dass alle Hotelgäste die Insel wieder verlassen. Damit das englische Paar gleich bei seiner Trauung unter freiem Himmel ungestört ist. Mauritius, rund 1800 Kilometer von Afrika entfernt, zieht heiratswillige Menschen an wie das Licht die Motten. «Wir haben Gäste, die kamen bereits als Kinder hierher und kehren dann später zurück, um sich hier das Jawort zu geben», sagt Karen, PR-Managerin des «Touessrok», des wohl bekanntesten Hotels der Insel, zu dem die Ilot Mangénie gehört. Hochzeitsinsel (4) Es ist verständlich, warum so viele gerade hier den Bund fürs Leben schliessen wollen: Das nur 2040 Quadratkilometer grosse Haupteiland des Inselstaats Mauritius ist traumhaft. Es bietet Berge, tropische Vegetation, schöne Hotels und viele, viele Strände. Beeindruckend ist auch die Küche, die indisch, kreolisch und französisch inspiriert ist. Ihre vielen Gewürze lassen einen die Insel förmlich auf der Zunge spüren: Piment, Minze, Kurkuma, Chili oder Koriander. Kein Curry kommt ohne die spezielle Gewürzmischung, Masala genannt, aus. Aber einen Nachteil hat auch Mauritius: Eine Reise dorthin hat ihren Preis. Vielfältige Insel Wer dreizehn Stunden von der Schweiz hierher fliegt, sollte nicht nur am Strand liegen. Selbst wenn das für gestresste Vielarbeiter verlockend sein mag. Ein Ausflug übers Land lohnt. Zum Beispiel in den Norden in den botanischen Garten von Pamplemousses. Hier liegt auch das Grab von Virginie, der der französische Autor Jacques-Henri Bernardin de Saint Pierre 1788 ein Denkmal setzte. Sie starb bei einem Schiffsuntergang und kam so nie mit ihrer Kinderliebe Paul zusammen, deretwegen sie aus Frankreich geflohen war. Sehr sehenswert ist auch die siebenfarbige Erde in Chamarel im Süden. Auf dem Weg dorthin passiert man Wälder aus Zuckerrohr, einer der Haupteinnahmequellen von Mauritius. Reisende kommen auch an riesigen Götterstatuen oder mal an einer Leichenverbrennung vorbei. Rund 50 Prozent der knapp über 1,2 Millionen Inselbewohner sind Hindus, die sehr gläubig sind. Grüne Insel Hässliche Flecken gibt es dagegen kaum. Der Tourismus im grösseren Stil begann erst in den 70erJahren, als die Insel direkt angeflogen werden konnte. Auf Menschenmassen hat man nie gesetzt. Das tut der Insel gut. Nachhaltigkeit und Ökologie werden dagegen seit längerem gross geschrieben. Im Hotel Sugar Beach zum Beispiel recycelt man Wasser, und das gebrauchte Öl aus der Küche liefert Energie für eine Firma, die hübsche Produkte aus Altglas herstellt. Die wiederum das Hotel kauft. Es klingt zwar kitschig, aber es ist tatsächlich so. Beim Blick an Palmen vorbei auf den Sonnenuntergang über dem Meer scheint der Alltag unendlich weit weg. Wie nur selten in einem Urlaub. Juliane Lutz ManU-Fans randalieren ba rnsley. Bei Ausschreitungen rund um das Ligacup-Achtelfinalspiel zwischen dem zweitklassigen Barnsley und Manchester United (0:2) gab es acht Festnahmen. Ein Teil der rund 4000 mitgereisten ManU-Fans stürmte am Dienstagabend am Rande des Ligapokalspiels eine Imbissbude im OakwellStadion, plünderte die Kasse und stahl Getränke und Lebensmittel, mit denen später Ordner und Polizei beworfen wurden. SI/DPA 4 Die Panik rächt sich Blick; 31.10.2009; Thomas Ley Redaktor Stell dir vor, es ist Schweinegrippe-Impfung, und keiner geht hin. Da tobt nun weltweit die Pandemie. Menschen sterben. Tausende erkranken. Doch die Schweizer lässt das kalt. Magere 27 Prozent wollen sich impfen lassen – wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ermittelt. Womöglich sinds noch weniger. Stimmt, die Schweizer sind viel zu impfskeptisch. Aber wahr ist auch, was BAG-Direktor Thomas Zeltner feststellt: «Es sind weit weniger Menschen erkrankt, als wir befürchteten.» Welche Untertreibung. Vor bis zu zwei Millionen Kranken hatte der Bund gewarnt! In Zahlen: 2 000 000! Die Rechnung dahinter: Alle Risikogruppen zusammen – Schwangere, Kinder, chronisch Kranke, Alte – sind zwei Millionen. Alles potenzielle Schweinegrippe-Opfer. Das ist, als würde der Bund uns warnen, dass nächste Woche eine Million Kinder Bauchweh kriegt. So viele leben nämlich bei uns – und die haben alle lieber zu viel Süsses als Spinat. Die Millionen-Panik rächt sich: Wir haben jetzt wohl sieben Mal mehr Impfstoff als benötigt. Paare verschoben ihre Kinderwünsche, weil der Bund von Schwangerschaften abriet. Und: Kaum einer will sich impfen lassen. Dabei bleibt die Schweinegrippe gefährlich. Tausende werden noch erkranken, Dutzende sterben. Nur: Was ist das schon, gegen «zwei Millionen»? Und umgekehrt? Fragen die Behörden. Wenn sie vor Tausenden Kranken gewarnt hätten – aber Hunderttausende krank wären? Würden wir nicht toben? Kaum. Wir würden es bedauern, uns einschränken, uns impfen lassen. Dafür muss man uns nämlich nicht einen Super-GAU an die Wand malen. Einfach mal so. Für alle Fälle. Testkäufe zeigen Wirkung Basler Zeitung; 27.10.2009 Weniger Alkohol an Junge verkauft Für Jugendliche ist es in vielen Orten der Schweiz nicht mehr so leicht, Alkohol zu kaufen – immer mehr Verkäufer zeigen Skrupel. Das Bundesamt für Gesundheit führt dies auf die zunehmende Zahl von Testkäufen zurück. Zum zweiten Mal hat das Forschungsinstitut Ferarihs im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und der Eidgenössischen Alkoholverwaltung (EAV) Alkoholtestkäufe in der Schweiz analysiert. 2131 Testkäufe waren im Jahr 2008 vorgenommen worden – fast doppelt so viele wie im Vorjahr (1176). Die Auswertung der Testkäufe zeigt ein zunächst widersprüchliches Ergebnis. So ist der Alkoholverkauf an Jugendliche in weiten Gebieten zurückgegangen, auch wenn im vergangenen Jahr insgesamt mehr jugendliche Testkäufer Alkohol erhielten als noch im Vorjahr. 2007 wurde den Jugendlichen noch in 27,7 Prozent der Fälle Alkohol verkauft, 2008 waren es 35,6 Prozent. Der Widerspruch löst sich auf, wenn man die Untersuchungsgebiete anschaut: In Kantonen, in denen bereits seit geraumer Zeit Testkäufe durchgeführt würden, ist der Verkauf von Alkohol an Jugendliche zurückgegangen. So zeigten die Kantone Baselland, Bern oder Zürich im Vorjahresvergleich eine deutliche Abnahme mit einer Tendenz gegen 25 Prozent. Diese Entwicklung lasse den Schluss zu, dass regelmässig durchgeführte Testkäufe nachhaltig wirkten, folgerte das Institut. Sie seien ein überzeugender Beitrag zur Durchsetzung von Jugendschutzbestimmungen. Die Zunahme der Alkoholverkäufe ist laut Studie vor allem in denjenigen Kantonen verzeichnet worden, wo im vergangenen Jahr erstmals Testkäufe durchgeführt worden waren. Die Verkäufer waren also nicht vorgewarnt – und schauten deshalb nicht so genau darauf, wie alt die Kundschaft war, die sich da alkoholische Getränke in den Einkaufskorb lud. Zu wenig Kontrollen. Nach wie vor ungenügend seien aber die Ausweiskontrollen und Nachfragen nach dem Alter, erklärte das Institut. So gebe es beim Verhalten des Verkaufspersonals wenig Veränderungen. Bei etwa 40 Prozent der Testkäufe werde der Ausweis kontrolliert, bei etwa 30 Prozent werde nach dem Alter gefragt und in den restlichen 30 Prozent werde Alkohol ohne jegliche Intervention verkauft. Das Management der Verkaufsstellen ist jedoch verantwortlich, das Personal regelmässig zu schulen und die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen zu gewährleisten. Die Schweizer Städte hatten sich erst unlängst in Umfragen für die Schaffung von Rechtsgrundlagen für beschränkte Alkoholverbote und Testkäufe ausgesprochen. SDA/AP 5 Basler Zeitung; 29.10.2009 «Das Problem sind die Männer» Die Verkehrspsychologin Jacqueline Bächli hat 99 Prozent männliche Klienten in ihrer Praxis Nicht nur Kleider, sondern auch Autos machen Leute. Verkehrspsychologin Jacqueline Bächli-Biétry begutachtet auffällige Lenker und betreibt verkehrspsychologische Forschung. BaZ: Frau Bächli, mit welchen Problemen haben Sie zurzeit am meisten zu kämpfen? Jacqueline Bächli-Biétry: Die Raserthematik steht für uns nach wie vor im Zentrum. Diese Unfälle sind häufiger geworden, weil PS-starke Autos immer billiger werden. Vor allem auch für die Personen, die gefährdet sind, zu schnell zu fahren. Dieses Problem ist allgegenwärtig. Was kann man dagegen tun? An erster Stelle stehen weiterhin Kontrolle und Strafe. Aber man muss auch Aufklärungsarbeit leisten und gewisse Kontrollmechanismen einbauen. Wenn ein junger Mensch mit übersetzter Geschwindigkeit einen Unfall verursacht, dann gefährdet er nicht nur andere, sondern er macht auch sein eigenes Leben kaputt. Wir reden hier vor allem von jungen Männern zwischen 18 und 25. Die sind auf der Suche nach Identität. Da ist die Risikobereitschaft gross. Die kann und soll man ausleben. Aber auf abgesperrten Rennstrecken und nicht im öffentlichen Verkehr. Haben diese jungen Männer meistens einen Migrationshintergrund? Zu 99 Prozent habe ich Männer in meiner Praxis. Das sind vorwiegend junge Männer aus der Unterschicht mit schlechten Perspektiven. Schweizer Eltern fällt es kaum ein, ihrem Jungen ein starkes Auto zu finanzieren. Die Hälfte der Raser, die wir beurteilen, stammt tatsächlich aus dem Balkan, aus Spanien, Portugal und der Türkei. Gibt es eine grundsätzliche Typologisierung des Autofahrers? Grundsätzlich wird zwischen zwei Arten von Fahrern unterschieden. Die einen haben einen sachlichen Bezug zum Auto. Diese benutzen das Auto, um von nach zu kommen, und wollen primär sicher ankommen. Die anderen versuchen sich mit dem Auto selber darzustellen. Sie wollen zeigen, dass sie das bessere Auto fahren. Sie haben einen emotionalen Bezug zum Auto. Kann man diese Typen noch genauer unterteilen? Es gibt emotionale Fahrer, die auch vernünftige Einstellungen und Sicherheitsbedürfnisse haben. Bei den Lenkern mit sachlichem Bezug gibt es aber auch jene, die sehr ängstlich sind. Auch die können den Verkehr gefährden. Sie interessieren sich gar nicht für den Verkehr und können mit ihrem Auto meist schlecht umgehen. Generell kann man sagen, dass etwa 30 Prozent der Autofahrer eine problematische Einstellung zum Fahren haben. Wenn Sie auf der Strasse ein Auto sehen, können Sie dann beurteilen, was für ein Fahrer darin sitzt? Bei extremen Autos, beispielsweise mit «Bügelbrettern» auf dem Heck oder überbreiten Reifen ist es äusserst unwahrscheinlich, dass ein Fahrer mit sachlichem Bezug zum Auto drin sitzt. Die ganz teuren Autos werden kaum von Rasern gefahren. Wie sieht es in zwanzig Jahren auf unseren Strassen aus? Es ist mittlerweile eine Illusion, dass man mit dem Auto die grosse Freiheit erleben kann. Früher war das Auto mehr ein Symbol für die Unabhängigkeit und Freiheit. Jetzt stehen die Leute ja immer mehr im Stau. In Zukunft wird die Kluft zwischen den «Grünen», die erdgasbetriebene Autos fahren werden, und denen, die Freude an ihrem Auto haben, wohl noch grösser. Diese Sorte Mensch wird nie aussterben. Es wird immer Leute geben, die sich über das Auto definieren. Ausser man kann sich das nicht mehr leisten. Das wäre möglich, wenn die grossen Wagen zu viel Benzin brauchen und dieser Luxus nicht mehr erschwinglich ist. Das Auto kann nicht zuletzt gewisse persönliche Defizite kompensieren. Hat das nicht auch Vorteile? Oder anders gefragt: Wo holen sich diese Menschen sonst ihr Selbstwertgefühl? Dann sollen sie Bungee-Jumping machen, aber nicht auf der Strasse andere gefährden. Im öffentlichen Verkehr ist das einfach zu gefährlich. Wenn man das auslagern könnte, wäre das kein Problem. Die Gesellschaft ist in dieser Hinsicht schon schizophren. Es gibt die Möglichkeit, ein 300 PS starkes Auto zu kaufen, und dann sagt man den Jungen, sie dürfen nur anständig und brav fahren. Es ist nur verständlich, dass ein junger Mensch mit dieser Situation nicht umgehen kann. Was fahren Sie persönlich für ein Auto? 6 Ich muss gestehen: Wir haben auch ein sehr grosses Auto, einen Jeep. Aber wir brauchen den für unseren Pferde-Transport. Wir haben aber eine Wechselnummer mit einem Smart. Und ich fahre privat noch einen ganz normalen Kombi, einen Ford Focus. Fahren Sie gerne Auto? Ich finde Autofahren cool und fahre sehr gerne Auto. Und ich verstehe die Leute, die das als Hobby ansehen. Eine entspannte Passfahrt in einem Cabriolet ist etwas Schönes. Reissende Stromschnellen «Delta» von Kornél Mundruczó hannes nüsseler Der Mensch ist gut, die Gesellschaft ist es nicht: Im ungarischen Drama weckt eine Geschwisterliebe den Hass einer kleinlichen Dorfgemeinschaft. 130, 110, 94 – keine Modelmasse, sondern die durchschnittliche Bevölkerungsdichte der Länder Slowakei, Ungarn und Rumänien. Was die Nationen verbindet, ist der zweitgrösste Strom Europas, die Donau. Mit schwindendem Gefälle entvölkern sich auch die Anrainerstaaten. Und wo weniger Menschen leben, gibt es auch mehr Platz, gerade für Aussenseiter und Träumer. Zu dieser Binsenwahrheit verleitet das aktuelle Filmschaffen aus Mittel- und Osteuropa: Im tschechischen «Country Teacher» von Bohdan Sláma trat ein schwuler Lehrer die Flucht aufs Land an, um mit sich selbst ins Reine zu kommen. Adrian Sitarus «Picnic» zeigte einen frustrierten Lehrer, der beim Ausflug an einen rumänischen Waldsee neuen Lebensmut fasste. Und im ungarischen Film «Delta» von Kornél Mundruczó, der am Einlauf der Donau ins Schwarze Meer spielt, baut nun ein Geschwisterpaar an einer gemeinsamen Zukunft, die von der lokalen Bevölkerung brutal zerschlagen wird. Knute. Stein des Anstosses ist das tabuisierte Verhältnis, das Mihail (Félix Lajkó) mit seiner Schwester Fauna (Orsi Tóth) eingeht. Der ehemalige Tierpfleger kehrt in sein Heimatdorf zurück, um ein Haus im rumänischen Mündungsgebiet der Donau zu bauen. Seine jüngere Schwester, die unter der Knute ihres Stiefvaters steht, hilft ihm dabei. Nach einer Vergewaltigung flüchtet Fauna zu ihrem Bruder, die zwei werden ein Liebespaar. Das geschieht fast wortlos, schliesslich geht es dem Regisseur nicht um die Psychologisierung einer «sexuellen Devianz», sondern um die Freiheit an sich, die auf keinerlei Normen Rücksicht nimmt. Die Strafe folgt umgehend und trifft die friedfertig Liebenden mit der Härte und Unausweichlichkeit einer griechischen Tragödie. Konvention. «Delta» ist, bei aller Hoffnungslosigkeit, ein unwiderstehlicher Film, der seine Schönheit aus grossartigen Landschaftsaufnahmen schöpft: Wie in einem Gemälde von Turner zerfliesst das Morgenlicht über dem weiten Fluss. Das faunische Liebespaar steht in Einklang mit dieser idyllischen Natur – der Mensch ist grundsätzlich gut, glaubt Mundruczó: Es ist die Enge gesellschaftlicher Konventionen, die aus seinem Herzen eine tödlich reissende Stromschnelle macht. Camera, Basel 7 8