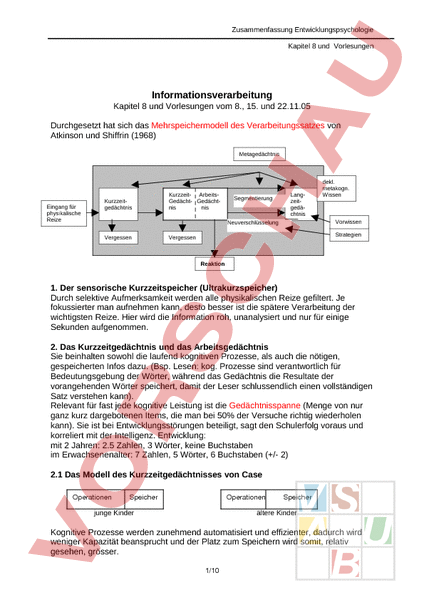Arbeitsblatt: informationserarbeitung
Material-Details
psychologie: informationsverarbeitung
Biologie
Gemischte Themen
klassenübergreifend
5 Seiten
Statistik
50576
666
5
09.12.2009
Autor/in
romina Gregorini
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Zusammenfassung Entwicklungspsychologie Kapitel 8 und Vorlesungen Informationsverarbeitung Kapitel 8 und Vorlesungen vom 8., 15. und 22.11.05 Durchgesetzt hat sich das Mehrspeichermodell des Verarbeitungssatzes von Atkinson und Shiffrin (1968) Metagedächtnis Eingang für physikalische Reize Kurzzeitgedächtnis Kurzzeit- ArbeitsGedächt- Gedächtnis nis Segmentierung Langzeitgedächtnis Vorwissen Neuverschlüsselung Vergessen dekl. metakogn. Wissen Strategien Vergessen Reaktion 1. Der sensorische Kurzzeitspeicher (Ultrakurzspeicher) Durch selektive Aufmerksamkeit werden alle physikalischen Reize gefiltert. Je fokussierter man aufnehmen kann, desto besser ist die spätere Verarbeitung der wichtigsten Reize. Hier wird die Information roh, unanalysiert und nur für einige Sekunden aufgenommen. 2. Das Kurzzeitgedächtnis und das Arbeitsgedächtnis Sie beinhalten sowohl die laufend kognitiven Prozesse, als auch die nötigen, gespeicherten Infos dazu. (Bsp. Lesen: kog. Prozesse sind verantwortlich für Bedeutungsgebung der Wörter, während das Gedächtnis die Resultate der vorangehenden Wörter speichert, damit der Leser schlussendlich einen vollständigen Satz verstehen kann). Relevant für fast jede kognitive Leistung ist die Gedächtnisspanne (Menge von nur ganz kurz dargebotenen Items, die man bei 50% der Versuche richtig wiederholen kann). Sie ist bei Entwicklungsstörungen beteiligt, sagt den Schulerfolg voraus und korreliert mit der Intelligenz. Entwicklung: mit 2 Jahren: 2.5 Zahlen, 3 Wörter, keine Buchstaben im Erwachsenenalter: 7 Zahlen, 5 Wörter, 6 Buchstaben (/- 2) 2.1 Das Modell des Kurzzeitgedächtnisses von Case Operationen Speicher Operationen junge Kinder Speicher ältere Kinder Kognitive Prozesse werden zunehmend automatisiert und effizienter, dadurch wird weniger Kapazität beansprucht und der Platz zum Speichern wird somit, relativ gesehen, grösser. 1/10 Zusammenfassung Entwicklungspsychologie Kapitel 8 und Vorlesungen 2.2 Das Modell des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley (1990) visuell räumlicher Notizblock phonologische Schleife Zentrale Exekutive Überwachung Subsysteme und Kontrolle der Aufmerksamkeit Messaufgaben: (schwierig f. Kinder) Zahlenspanne und Farbenspanne rückwärts, Mental fusion (Bsp. aus Teilbildern, welche man nacheinander sieht, ganzes Bild formen), Entscheidungsaufgaben (Bsp. Bildreihenfolge und jeweilige Bestimmung, ob roter Ball vorkommt od. nicht), Listening Counting Recall (Gehörte Wörter und Zahlen wiederholen) Vereinfachungen dieser Aufgaben bringen Verlagerung in die 2 anderen Teilsysteme mit sich grosse Bedeutung für Spracherwerb (Mutter- und Fremdsprache) phonologischer Speicher: hält Sprachinfos max. 1.5 bis 2 artikulatorischer Kontrollprozess: inneres Sprechen bringt Info zurück in phonol. Schleife (Bsp. Telefonnummer innerlich aufsagen) Beweis für Existenz: Silbenanzahl (Bett-Mondschein) und –Dauer (ChinesischWalisisch), sowie Artikulationsgeschwindigkeit wirken auf phonol. Schleife. Bsp: Effekte durch artikulatorische Suppression (Spannenaufgabe „blablabla aufsagen) und von unattended Speech (Präsentation von sprachl. Infos, welche nicht berücksichtigt werden soll während Spannenaufgabe) Messaufgaben: Word List and Digit Recall (Wortspanne u. Zahlenspanne), Nonwords nachsprechen (in Engl.: Visual-Spatial Sketch (VSSP) Bildung und Speichern von Bildinfos und Raum-Zeit-Beziehung, nimmt Infos durch Wahrnehmung und bildhafte Vorstellung auf. Ähnlich wie Schleife, auch hier unattended picture effect. VSSP wichtig für Orientierung, Planung und Durchführung raum-zeitlicher Aufgaben (Bsp. Memory) Messaufgaben: Corsi-Blocks-Recall, Visual Pattern Test ( Matrix, Bsp. In Raster von Quadraten „Weg von Farbwechsel wiederholen können, Film v. Räuber/PolizeiSpiel), Mazes Memory (Labyrinthe) Entwicklungsveränderungsdiagramme dieser Teilkomponente siehe Folie 19-21 (8.12.05) Phonol. Prozesse und Chunking (Strategien) werden zunehmend eingesetzt und durch Automatisierung effektiver (Bsp. Kinder beginnen Telefonnr. in Paaren aufzusagen, nicht mehr einzelne Buchstaben) VSSP erst am 7 J. eigenständige Funktion (vorher Umkodierung der RaumZeit-Infos in verbale Infos) Zen. Exekutive verbessert rasant Aufmerksamkeitssteuerung zw. 5 u. 10 J. Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit steigt inkl. Artikulationsgeschwindigkeit 2/10 Zusammenfassung Entwicklungspsychologie Kapitel 8 und Vorlesungen 2.2 Die Bedeutung des Arbeitsgedächtnis für die Entwicklung Biologische Grundlage für die Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses ist die Myelinisierung. Sie ist entscheidend für Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, welche in der Kindheit deutlich zunimmt und negativ beschleunigt ist (d.h. je länger die Zeit, desto langsamer die Reaktionsgeschwindigkeit, welche von der Infoverarbeitung abhängt). Die Altersunterschiede liegen nur im msek Bereich. Doch in komplexen, alltäglichen Situationen summieren sie sich auf und machen so grosse Unterschiede. Für die schulische Leistung im Allgemeinen (Sprechen, Lesen, Rechnen) ist die Korrelation zwischen Kapazitätsmessungen des Arbeitsgedächtnisses (Loop und zentrale Ex.) und standardisierten Leistungstests im Alter von 7 J. signifikant. D.h. durchschnittliche Schüler sind in allen Kapazitätsaufgaben besser als unterdurchschnittliche Schüler. Im Alter von 8 J. gilt dies jedoch nicht mehr. Zu den einzelnen Teilgebieten (nur in Bezug auf Arbeitsgedächtnis, allg. siehe 7. Entwicklung der akademischen Fähigkeiten) Sprechen: Grundschüler sind besser als Sprachheilschüler, weil Wortspanne und Sprechrate besser entwickelt sind. Korrelation von Arbeitsgedächtnis und Wortschatz/Grammatik ist bei 4- und 5jährigen signifikant (bei 3jährigen noch nicht). Kontrollgruppen von Grundschülern (KG) sind in der Satzspanne leistungsfähiger als Legastheniker (Leg) und Lese-Rechtschreibschwache Kinder (LRS). Jedoch bei der Bildbenennung sind Leg vor LRS und KG. Bei der Artikulationsgeschwindigkeit (Bsp. Wie schnell kann man „Utepe, utepe, utepe aufsagen?) ist die Reihenfolge LRS, Leg und zum Schluss KG. Rechnen: Die Qualität der mathematischen Leistung ist stark vom vorhandenen Mengen- und Zahlenvorwissen abhängig. Das Mengenvorwissen seinerseits, ist aber stark von der Intelligenz und der Gedächtniskapazität abhängig. Somit ist der Einfluss der Gedächtniskapazität auf die math. Leistung (wenn auch indirekt) grösser als z.B. Zahlenspanne. Weitere bedeutende Faktoren: Inhibitory process (hemmende Prozesse) verhindern, dass störende irrelevante Infos (Ablenkung( in Arbeitsgedächtnis aufgenommen werden. Diese Funktion, welche der Aufmerksamkeitssteuerung unterliegt, verbessert sich erst mit steigendem Alter während der Kindheit. D.h. kleine Kinder lassen sich viel mehr durch unbedeutsame Stimulis ablenken und sind deswegen auch weniger leistungsfähig. Executive functioning (Ausführungsfunktion im Sinne von gelernter Problemlösung) umfasst die hemmende Prozesse, Planungfähigkeit und kognitive Flexibilität. Auch diese Funktion wird mit steigendem Alter verbessert. 3/10 Zusammenfassung Entwicklungspsychologie Kapitel 8 und Vorlesungen 3. Langzeitgedächtnis Dies ist der unlimitierte, permanente Speicher von unserem Wissen über die Welt. Er besteht aus: prozeduales LZG motorische Abäufe (Bsp. Autofahren) semantisches LZG Faktenwissen/ bereichspezifisches Wissen,(unpersönlich) (Bsp. Kaffekochen) episodisches LZG Episodenwissen (pers.) (Bsp. Autobiographie) Besonderheit: Kindheitsamnesie (siehe Tutorium Einführung) Das Wissen eines Menschen ist in propositionalen Netzwerken (hierarchisch und nach Bedeutung geordnet) im LZG gespeichert. Knotenpunkte sind Propositionen, Argumente und Relationen, dazwischen bestehen Verknüpfungen (Assoziationen). Erinnert wird, was aktiviert ist. Um eine Sequenz, in welcher Geschehnisse einzuordnen sind, herzustellen, greifen wir auf „scripts (Vernetzung aller Daten zu einem Schlüsselbegriff) zurück (Bsp. Scrip mit „Hund –vier Beine, Gassi gehen, Dalmatiner etc.). Erwachsene haben ein dichteres Netzwerk, in dem sich Aktivierung gut ausbreiten kann und können sich deshalb besser erinnern. Unterschiede in Wissensstruktur können alleine schon Unterschiede zw. Kindern und Erwachsenen in Gedächtnisleistung erklären. Vergessen ist ein Misslingen des Abrufs, nicht eine Folge von „Zerfall. Kann der Weg zu einer Info nicht gefunden werden (obwohl neuronale Struktur zum Auffinden der Info immer besteht), helfen gewisse Techniken auf die Sprünge (durch Assoziationen). Bsp.: Mulitple Joice Fragen. Manchmal werden neue Infos auch zum falschen Wissen dazu gespeichert und werden dadurch beim Abruf falsch kombiniert. Grosse Analogie zu PC-Software, gleiche Vorgehensweise: Verstehen der Frage Suche nach bereits abgespeicherter Liste in Gedächtnis Vergleich Frage und Liste – Antwort (immer gleiches Schema, jedoch für komplexere Probleme, wie Rechnen, mehrere Zwischenschritte). 4. Strategien und Vorwissen 4.1 verschiedene Typen von Strategien Eine Gedächtnisstrategie ist eine potenziell bewusste, absichtliche und kontrollierbare kognitive Aktivität. Sie wird eingesetzt, um die Leistung in Gedächtnisaufgaben zu verbessern. Als Neuverschlüsselung der Infos, wirken Strategien zwischen dem Arbeits- und dem Langzeitgedächtnis. Enkodierstrategien (während Lernen) Rehersal (Wiederholung): einfache, vielseitige und effektive Str., welche sich relativ früh entwickelt (beginnt ab 8 J.) 1. Versuch: Kindergartenkinder und 2./6. Klässler mit Helm müssen Bilder auswendig lernen, Vl sieht nur Lippenbewegung beim Lernen der Kinder (Lippenbewegung Wörter still wiederholen Strategiegebrauch) 4/10 Zusammenfassung Entwicklungspsychologie Kapitel 8 und Vorlesungen Resultat: Kindergartenkinder zeigen keine Strategie/ 2.Kl. zeigen z.T. Strategien, jedoch oft unbewusst/ 6.Kl. zeigen Strategie Kinder, welche sich den Strategiegebrauch bewusst sind, haben bessere Wiedergabeleistungen als Kinder, welche Strategie unbewusst od. gar nicht angewendet haben Organisieren/ Kategorisieren: (nach Themen od. Oberbegriffen od. chronologisch, geografisch etc.) lässt sich gut untersuchen, weil messbar (quantifizierbar), kaum Vorwissenseffekt, Kinder machen es gerne. Stra. entwickelt sich automatisch in Grundschulalter (Bsp. für Versuch: an Tafel versch. Bilder sortieren) Elaborieren: Wortpaare lernen durch Zusatz von neuen Infos. (Bsp. zwei Vokabel bildhaft assoziieren) 6. Kl., welche diese Stra. erlernt hatten, erinnerten sich an doppelt so viele Wörter wie Kontrollgruppe (jedoch Stra. wird nicht auf neue Aufgaben übertragen). Stra. nur für ältere Kinder wirksam, bei jüngeren z.T. zu anspruchsvoll, bedarf intensive Übung Abrufstrategien (während Widergabe) Nutzung des Langzeitgedächtnisses interne Abrufhilfe: freie Widergabe (Bsp. Welche Bilder hast du gesehen? –kleiner Altersunterschied, weil Unterschied in LZGEntwicklung), Regkognition (Bsp. altes od. neues Bild? oft keinen Altersunterschied) externe Abrufhilfe: gelenkte Widergabe (Bsp. Gruppenname von Bildern sagen- meist grosser Altersunterschied, weil Unterschied in Strategiebenutzung) ABER: bereits Kindergärteler brauchen eigene, externe Erinnerungshilfen (Bsp. Schlittschuhe bereit legen, damit man sie n. vergisst) 4.2 Entwicklungsveränderungen im Strategiegebrauch Jüngere Kinder setzen selten spontan eine sinnvolle Strategie zur Verbesserung ihrer Gedächtnisleistung ein. Während der Schulzeit nimmt Effizienz zu, verschiedene Strategien müssen zuerst ausprobiert werden. Besonders während der Grundschule lernen Kinder sehr viel über Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Absicht, Wissen und Denken (metakognitives Wissen, siehe Metagedächtnis). Besonders wichtig ist, dass Kinder eine effektive kognitive Selbstregulation besitzen, um Ziel und Strategie zu identifizieren und erfolgreich zu Überwachen. Situationen in Schule scheinen ganz massgeblich die Strategieentwicklung zu beeinflussen ABER: In alltagsnahen Lebenssituationen sind Strategien und –Kompetenzen früher erkennbar (oft unbewusst). Bsp. Vorschulkinder berühren Dinge, an welche sie sich erinnern wollen (keine effektive Strategie, jedoch Beginn des Einsatzes eines Hilfsmittels) Um Stra. gewinnbringend einsetzen zu können, scheint das bewusste Strategiewissen verfügbar sein zu müssen. Probleme (deficency): Mediationsdefizit: Kinder können zwar zur Strategiebenutzung instruiert werden, Leistung wird aber n. besser Produktionsdefizit: Kinder können zwar zur effiz. Strategiebenutzung instruiert werden, setzen sie spontan aber nicht ein Nutzungsdefizit: Kinder setzten eine Strategie spontan ein (von sich 5/10 Zusammenfassung Entwicklungspsychologie Kapitel 8 und Vorlesungen aus), Leistung aber nicht verbessert Versuch: erst ab 3.Kl. und ab 3. Lerndurchgang ist Sortieren v. Bildern signifikant (d.h. Anordnung der Bilder nach System, n. zufällig). Jedoch 3.Kl. zeigen noch keinen Zusammenhang zw. Sortieren und Recall-Leistung (erst ab 8.Kl) Defizite sind immer in dieser festen Reihenfolge zu beobachten und wurden für jeden Strategie-Typ nachgewiesen. Multipler Strategieeinsatz ist für die Gedächtnisleistung oft nützlicher. ABER: Automatisierung der Strategien nur mit viel Übung, weil kognitive Ressourcen beansprucht werden Kinder lernen Strategien vor allem durch die Hilfe von Eltern/Lehrern und älteren, besser trainierten Kindern. Die Verbesserung des Strategieeinsetzens nimmt im Allgemeinen graduell zu. Wenn Kinder plötzlich den Vorteil einer Strategie verstehen kann die Verbesserung ausnahmsweise auch schrittweise zunehmen. 4.3 Vorwissen Vorwissen betrifft das bereichsspezifische Wissen (siehe LZG). Für die allermeisten Gebiete wissen Erwachsene mehr als Kinder, haben also engmaschigeres, reichhaltigeres propositionales Netzwerk. ABER: Kinder wissen in isolierten Wissensbereichen sehr viel, oft mehr, als Erwachsene (Bsp. Dinosaurier). Versuch: Experten-Novizen-Vergleich um isolierten Effekt von Vorwissen auf Gedächtnisleistung zu untersuchen. Bsp: Kinder als Schachexperten sind im Bereich Schachbrettaufstellungenmerken besser als erwachsene Novizen, sonst im Bereich Gedächtnisspanne nicht. Grund: Experten (hier Kinder) können schneller und grössere Informationseinheiten (chunks), die sie zusammen speichern, nutzen. Das gleiche Ergebnis ergibt sich auch bei sinnlosen Schachstellungen (Vorwissen wird weniger benötigt, trotzdem praktisch). Vorwissen hilft aber bei neuen, ähnlichen Aufgaben nicht. Allgemein klassifizieren Experten verschiedene Probleme anhand der betroffenen physikalischen Gesetzen (höhere Ebene), Novizen dagegen anhand von Oberflächenmerkmalen. Vorteile des Vorwissens: neues Wissen kann in vorhandenes Netzwerk eingebaut werden Strategien werden überflüssig und wenn sie trotzdem eingesetzt werden, sind sie effizienter, benötigen weniger kogn. Operationen Vorwissen kann den IQ-Unterschied aufheben (Bsp. Erinnern von Details aus Fussballgeschichte, Resultat noch eindeutiger, wenn inhaltliche Lücken nur durch Vorwissen gefüllt werden können) Wissen ist besser strukturiert Wissen besitzt stärkere Assoziationen Aktivierung verläuft automatisch (schnellerer Zugriff auf LZG) Gedächtnislücken werden durch Rekonstrukion leichter und sicherer geschlossen Zusammenhang und Konsequenzen von Vorwissen und schulischer Leistung 6/10 Zusammenfassung Entwicklungspsychologie Kapitel 8 und Vorlesungen Wissenslücken, die nicht geschlossen werden, können langfristigen Einfluss auf Leistung haben Effekt von IQ oft überschätzt, bereichspez. Wissen bedeutsamer Vorwissenseffekte können auch erklären, warum beruflicher Erfolg nur wenig mit Begabung zu tun hat –Wissen wird jahrelang und sukzessiv aufgebaut 5. Das Metagedächtnis Das Metagedächtnis ist der Motor der Gedächtnisentwicklung (Grundlage) und wirkt auf alle Teile des Gedächtnisses ein Das metakognitive Wissen wird unterteilt in: Deklaratives Metagedächtnis Faktenwissen über das Gedächtnis bezüglich Personenmerkmale, Aufgabencharateristik, einsetzbare Strategien und Interaktion zw. all diesen Punkten. (Welche Möglichkeiten stehen mir grundsätzlich zur Verfügung, eine Aufgabe zu lösen?) Bsp. Welche Strategie steht mir beim Vokabelnlernen zur Verfügung? Versuch: Kinder müssen verschiedene Strategien beurteilen- Messung der richtigen Einschätzung durch die Kinder. Die Bedeutung des dekl. Wissens ist sehr gross, weil es die Voraussetzung für den Strategiegebrauch ist (Bsp. IQ und Gedächtnisspanne nicht so bedeutsam für Recall) Prozeduales Metagedächtnis Wissen, wann welche Gedächtnisaktivität gebraucht wird, diese einsetzen, steuern und anpassen (Welche Möglichkeit nutze ich bei bestimmter Aufgabe? Wie nutzte ich diese Möglichkeit?) Bsp. Kann ich Strategie zum Vokabelnlernen auch beim Lernen im Zug gebrauchen? Weitere Unterteilung der Aufgaben des prozed. Gedächtnisses nach der Klassifikation von Nelson und Narens (1990) Überwachungsprozess (Monitoring): (Bsp. 1.Kl. überwacht Rechtschreibung und Wortbedeutung und korrigiert Fehler, manchmal ist Kontrolle noch defizitär, z.B. wenn richtiges Wort falsch korrigiert wird) Ab 8 J. funktioniert die metakognitive Überwachung recht zuverlässig; Ansätze schon vorher erkennbar. Verschiedene Prozesse: Ease-of-learning Judgement (Beurteilung d. Leistungsprognose): Die Überschätzung der eigenen Leistung und Leistung von Dritten, lässt mit dem Alter nach. ABER: hier ist die metakognitive Überwachung allgemein relativ schlecht. Judgement of Learning (Beurteilung des eigenen Lernens): Auch bei Sicherheitsurteilen (d.h. Wie sicher bist du, dass du das Gelernte sicher erinnern wirst?) lässt Überschätzung mit Alter nach, ist aber immer relativ hoch. Wenn das Gelernte Element für Element abgefragt wird, ist die Überschätzung noch höher, als wenn nach dem Gelernten allgemein gefragt wird Feeling-of-knowing Judgement (FOK) (Vorhersage, ob gerade nicht gewusst Inhalte später doch noch gewusst/ wiedererkannt werden). Die Überschätzung des FOK im Bezug auf richtige Antworten ist am grössten. Im Bezug auf Verwechslungen am zweitgrössten und im Bezug auf Auslassungen am drittgrössten. Die Überschätzung nimmt allgemein mit dem Alter ab (d.h. 77/10 Zusammenfassung Entwicklungspsychologie Kapitel 8 und Vorlesungen jährige haben fast keine Ahnung darüber, dass Antwort komplett falsch war). Confidence in retrieved answers (Vertrauen in abgefragte Antworten) Bei Sicherheitsurteilen (Wie sicher bist du, dass du das Gelernte sicher erinnert hast?) sinkt das Niveau der Sicherheit mit dem Alter. Innerhalb desselben Alters ist Sicherheit für richtig gegebene Antworten grösser als für falsche Antworten (wichtiger Zusammenhang zu Zeugenaussage, weil eben Sicherheit für falsche Antworten sehr tief ist- siehe Seelenlands.). Im Unterschied zum Niveau der Sicherheit, nimmt diese Differenzierung (zw. richtigen und falschen Antworten) mit dem Alter zu. Diese Effekte stimmen auch für andere Testformen (Bsp. Rekognitationstests) und andere Gedächtnismaterialien. Kontroll- und Steuerungsprozesse: Selection of kind of processing (Erfassung der Reproduktionsbereitschaft) Allocation of study time (Zuweisung von Lernzeit) Erst mit steigendem Alter (ab 10 J.) können Kinder zwischen einfacher und schwerer Aufgabe im Bezug auf Lernzeit differenzieren (d.h. 6 J. berechnet für beide Aufgaben gleich viel Zeit, 12 J. berechnet für schwierige Aufgabe viel mehr Zeit). ABER: Kinder ab 7 J. können die Einteilung alleine in einfach und schwierig machen, können dies aber nicht auf Zeiteinteilung übertragen. Termination of study (Beenden des Lernens) Selection of search strategy (Wählen einer Suchstrategie) Termination of search (Ende der Suche, Messindikator sind „Weiss nicht-Antworten) Bei Suggestiv-Fragen viel weniger „Weiss nicht-Antworten als bei offenen Fragen. Wird die Genauigkeitsmotivation mit Einführung einer Belohnung b. richtiger Antwort manipuliert, nehmen „Weiss nicht-Antworten zu (weil Kinder nicht mehr dem Erwachsenen „gefallen wollen, sondern im Hinblick auf Belohnung ja keine falschen Antwort geben wollen). Ohne Belohnung haben Kinder das Gefühl durch den sozialen Druck (Anwesenheit einer Autoritätspers.) eine Antwort geben zu müssen. Bei Erwachsenen spielt Belohnung keine Rolle mehr. Bei Suggestiv-Fragen steigen die „Weiss nicht-Antworten mit Belohnung noch viel extremer. Sogar bei nicht beantwortbaren Fragen nehmen „Weiss nichtAntworten mit Belohnung zu. Bei suggestiven, nicht beantwortbaren Fragen nehmen „Weiss nicht-Antworten mit Belohnung extrem zu. Bei Erwachsenen nehmen sie in dieser Situation extrem ab. (für besseres Verständtnis siehe Folien 16-18 v. 22.11.05) 8/10 Zusammenfassung Entwicklungspsychologie Kapitel 8 und Vorlesungen Klassifikation von Nelson und Narens Ease-of-learning Judgement Monitoring Judgement of learning Feeling-of-knowing Judgement Acquisitation (Erwerb) Vor dem Lernen Selection of kind of processing Control) Retention (Speicherung) während dem Lernen Erhaltung des Wissens Allocation of study time Confidence in retrieved answers Retrieval (Abfragen) selbstgerichtete Suche Selection of search strategy Output Termination of search 6. Die Ursprünge des Wissens Methode zur Erinnerungsleistung (1.Versuch): Babys lernen, dass Fussbewegung Mobile zum Drehen bringt. Nach einiger Zeit wird Versuch (ohne erneute Instruktion) wiederholt. Resultat für 2 und 3 Monate alte Babys: vergangene Ereignisse können erinnert werden, werden mit der Zeit aber vergessen. Jedoch kann Erinnerung durch Abrufhilfe wider aktiviert werden. Erinnerungsleistungen verbessern sich nach Geburt rasant, denn auch zuständige Gehirnareale wachse (Bsp. Hippocampus, welcher die Speicherung von Infos ermöglicht, ist mit 6 Monaten voll ausgebildet. Jedoch der frontale Cortex, welcher hilft, das Gespeicherte abzurufen, entwickelt sich erst in den ersten 2 Lebensjahren.) Methode zum Wissen über Kategorien: verschiedene Tiere aus versch. Kategorien werden Säugling gezeigt- Was länger angeschaut wird, ist neu. Resultat: Kategorien von Tieren werden erkannt. Die Kategorisierungsleistungen basieren aber zunächst auf perzeptueller Ähnlichkeit, aber die Erfahrung und das Vorwissen verbessern die Kategorisierung. Weitere Wissensbereiche von Säuglingen: Gesichter, übergeordnete Kategorien (Bsp. belebt vs. unbelebt) 7. Die Entwicklung der akademischen Fähigkeiten 7.1 Lesen Grundvoraussetzung ist das Kennen der einzelnen Buchstaben, welches auch ein guter Indikator für nachfolgende Leseleistungen ist. Zusätzlich braucht es die biologische Fähigkeit, die unterschiedlichen Laute der Buchstaben unterscheiden zu können (phonologisches Bewusstsein). Auch diese Funktion sagt Leseerfolg voraus und ist auch wichtig in nicht alphabetbasierenden Sprachen, wie Chinesisch. Das phon. Bewusstsein wird vor allem durch Gedichtvorlesen und Erklärungen während dem Vorlesen der Eltern gefördert. Später folgt die Worterkennung, welche zuerst durch lautes Buchstabieren erfolgt, danach nur noch durch Abrufen im Langzeitgedächtnis. Der Übergang ist aber fliessend. Weil wir gewisse Wörter bereits kennen, lesen wir sinnvolle Wörter viel schneller als sinnlose. Auch Buchstaben- und Wortlücken können wir füllen, weil wir das Wort- und Satzbild kennen. Dabei sind Wörter in offenen Sätzen (Bsp. Ich mag . viel schwieriger zu erkennen, als in limitierten Sätzen (Bsp. Der Hund jagt die . ). 9/10 Zusammenfassung Entwicklungspsychologie Kapitel 8 und Vorlesungen Kinder leiten die Bedeutung eines Satzes durch Umformen der Wortkombinationen zu Propositionen (Aussagen) od. Ideen her. Faktoren für ein besseres Leseverständ.: Je besser die Worterkennung, desto mehr Gedächtniskapazität kann dem Verständnis gewidmet werden. Arbeitsgedächtniskapazität steigt mit dem Alter und dadurch können mehr Infos beim Propositionenbilden gespeichert werden Kinder erweitern ständig ihr Allgemeinwissen über ihre physikalische, soziale und physiologische Umwelt und verstehen dadurch das Gelesene immer besser. Mit der Erfahrung können Kinder das Verständnis besser Überwachen (Monitoring) Mit der Erfahrung können Kinder öfters Lesestrategien verwenden 7.2 Schreiben Mit der Vergrösserung des Allgemeinwissens können Kinder auch detaillierter und spezifischer schreiben. Wichtig ist auch die Organisation des Geschriebenen: junge Schreiber verwenden oft die knowledge-telling Strategie, bei der sie Infos in der Reihenfolge schreiben, wie sie sie erinnern, nämlich ohne konkrete Struktur. Während dem Erwachsenwerden beginnt der Gebrauch der konwledge-transforming Strategie. Hier wird entschieden, welche Informationen aufgenommen werden und welche Organisation im Hinblick auf die Perspektive des Lesers die beste ist. Schreiben ist zu Beginn sehr anstrengend, weil man nicht nur auf den Inhalt des Geschriebenen achten muss (wie beim Sprechen), sondern sich auch auf Rechtschreibung, Grammatik und Satzstellungen konzentrieren muss. Diese Komponenten werden aber mit der Erfahrung einfacher. Schlussendlich lernen junge Schreiber noch wie Redigieren und auch dies verbessert, bei effektiver Anwendung, das Schreiben. 7.3 Rechnen Durch die Habituationsmethode weiss man, dass bereits Babys in der Anzahl von Objekten unterscheiden können. Mit 5 Monaten machen Kinder Unterscheidung zwischen 2 und3 Objekten, selten schon zwischen 3 und 4. Natürlich zählen die Kleinkinder die Objekte nicht, sondern unterscheiden sie durch Form/Farbe und ein natürliches Gespür für kleine Anzahlen. Dieses Zahlenverständnis (Ordinality), d.h. das Wissen darüber, das gewisse Werte grösser sind als andere, beginnt schon sehr früh (Bsp. Können 10 M. alte Kinder zwischen 2 Tellern mit 2 od. 3 Keksen wählen, nehmen sie das mit 3). Mit 3 J. sollten die 3 Prinzipien des Zählens vorhanden sein: One-to-one Prinzip: Pro zu zählendes Objekt gibt es nur ein Nummernnamen (Bsp. Kind, welches für 3 Obj. „1,2,A zählt versteht das Prinzip. Stable-order Prinzip: Nummernnamen haben immer gleiche Reihenfolge (Bsp. Kind, welches „1,2,4,5 zählt, versteht d. Prinzip) Cardinality Prinzip: Der letzte Nummernnamen während dem Zählen von Objekten gibt die gesamte Anzahl der Objekte an Mit 4 J. kennen die meisten Kinder die Zahlen von 1 bis 20. Auch einfache Additonsund Subtraktionsaufgaben können gelöst werden. Zuerst werden die Operationen an den Fingern abgezählt, danach still im Kopf gezählt und schlussendlich werden die Grundoperationen (1-9) im Langzeitgedächtnis abgerufen (mit 8/9 J.) 10/10